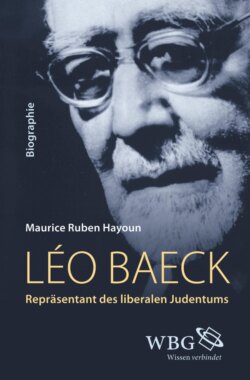Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Niedergang der jüdischen Tradition in Europa
ОглавлениеLeo Baeck wusste, dass die jüdische Tradition bei ihrer ersten Konfrontation mit der europäischen Kultur einige Jahrzehnte vor Mendelssohns Geburt einen beginnenden historischen Niedergang erlebte: Zwischen 1700 und 1750 – dem Jahr, in dem Mendelssohn seine hebräische Zeitschrift Kohelet Musar (Der Sittenprediger) gründete – waren die Würfel gefallen. Die darauf folgenden Jahre bestätigten diese Tendenz: Die traditionellen Studien und Positionen, die von den Rabbinern und Leitern der Talmud-Akademien besetzt wurden, waren im Niedergang begriffen. Im Allgemeinen optierten die zeitgenössischen Zeugnisse der Maskilim und jüdischen Philosophen entschlossen für die Moderne und gegen die Antike.
Dennoch kann man auf einige Erklärungen Bezug nehmen, die sich die Sache der alten Tradition zu eigen machten; so zum Beispiel der berühmte Talmud-Gelehrte Jonathan Eibeschütz, der sich (Ja‘arot devasch I, 48b) bitter über die Laienvorsitzenden der Gemeinschaft beklagte, die nichts als eigene Ehrenämter anstreben und eifersüchtig über ihre Privilegien wachen würden. Wenn man es gegenüber einem Rabbiner oder einem traditionellen Gelehrten an Respekt mangeln ließe, würden keinerlei Sanktionen gegen den Schuldigen ergriffen; wenn es sich aber nur um einen Gemeindeleiter handele, ginge man so weit, über die Zuwiderhandelnden den Bann auszusprechen.
Auch Jacob Emden (in Scha’are Schamajim, 76a) stigmatisierte den Willen der Juden seiner Zeit, sich gesellschaftlich an ihre christliche Umgebung anzupassen: Vor allem die Frauen rivalisierten mit ihren christlichen Nachbarinnen in Bezug auf Mode und Eleganz. Sogar die jüdischen Dienerinnen würden sich beteiligen. Jesaja 3,16 paraphrasierend, ruft er aus: „Ich fühle mich von den Töchtern Zions abgestoßen, die mit aufgerichtetem Halse gehen …“. Der Notar Nicolas von Bonn notierte, dass die Juden lernten, die deutsche Schrift zu lesen und zu schreiben, um ihre Kaufverträge besser aufsetzen zu können. Bis dahin hatten sie ihre Buchhaltung in hebräische Schriftzeichen transkribiert. Diese Mutation vollzog sich auf Kosten der traditionellen Bildung: Um für ihren Unterhalt zu sorgen, waren die wenig darüber erfreuten Familienväter gezwungen, ihre Söhne im Alter von dreizehn Jahren, wenn sie religiös als volljährig galten, arbeiten zu lassen – manchmal sogar noch früher. Dies beraubte die Talmudschulen ihres inständig ersehnten Nachwuchses. In seinen Erinnerungen lobt Jacob Emden eine seiner Ehefrauen, die sich um die religiöse Erziehung ihrer Kinder sehr gut kümmern würde. Doch alle jüdischen Familienmütter am Ende des 17. und Beginn des 18. Jahrhunderts waren nicht die Tochter oder Ehefrau eines Rabbiners!
Eibeschütz beklagt, dass man den Kindern – auch den Mädchen! – Französisch, Italienisch und Deutsch beibringe, sogar das Tanzen, aber nicht eine einzige Stunde für den Talmud fände, der damit in Gefahr geriete, außer Gebrauch zu kommen. Man könne, so fügt er hinzu, sich nicht damit zufriedengeben zu beten, ohne zu begreifen, was man da rezitiere. Auch könne man die Bildung der Kinder nicht unfähigen und inkompetenten Menschen anvertrauen. Selbst Mendelssohn beklagte sich bei einem seiner galizischen Schüler, Herz Homberg, über die Inkompetenz der traditionellen Lehrer, und vertraute die Erziehung seines ältesten Sohnes Joseph anderen Menschen an. Joseph war übrigens der einzige Sohn, der der jüdischen Tradition treu blieb.
Der Niedergang der Tradition betraf auch tiefste Bereiche der menschlichen Existenz: War es bei den Juden üblich gewesen, sich mit ungefähr achtzehn Jahren zu verheiraten, so geriet diese Praxis nach und nach außer Gebrauch. In einer seiner ersten Predigten in Hamburg kurz nach seiner Wahl prangerte Jonathan Eibeschütz das Verhalten jener an, die ihre Heirat abwarten würden, bis sie große Ersparnisse angehäuft hätten, um ihre Kinder ernähren zu können. Mendelssohn, der den fortschrittlichsten Flügel des Judentums seiner Zeit repräsentierte, nahm sich erst mit 33 Jahren eine Frau, und Naftali Herz Wessely, sein treuer Mitarbeiter und Lieblingsschüler, wartete sogar bis zu seinem 45. Lebensjahr.
Doch weder Emden noch Eibeschütz waren erbitterte Gegner der weltlichen Wissenschaften. Sie waren lediglich alarmiert über deren Entwicklung zum Schaden der traditionellen Fächer. Eibeschütz zitiert in seinen Schriften bestimmte astronomische Werke, bedient sich bei den Deisten, die es verstehen, die biblischen Wunder anzufechten, und interessiert sich für Neuheiten seiner Zeit. Was Emden angeht, so hinderte ihn die Tatsache, dass er den Führer der Verwirrten von Maimonides heftig bekämpfte, nicht daran, sich dessen Vokabular anzueignen und sich gelegentlich in der Sprache der mittelalterlichen hebräischen Übersetzer auszudrücken, der Tibboniden.
Was in den Erläuterungen dieser beiden Rabbiner auffällt, ist ein Satz, der sich mit kleinen unterschiedlichen Details bei beiden findet: „Lihiot me’orab ‘im habiriot bei Emden (mit den Kreaturen vermischt sein, d.h. mit den anderen Menschen); „Lihiot nivla’ im habiriot“ bei Eibeschütz (unter den Kreaturen eingeschlossen sein). Hier ist hervorzuheben, dass keiner von beiden Gojim, Nichtjuden, oder Ummot, Nationen, verwendet. Sie betrachten die Menschheit als eine einzige, unteilbare Einheit.
Mendelssohn hat zeit seines Lebens einen zweifachen Kampf geführt: gegen die Intoleranz der christlichen Welt und gegen die genauso heftige Intoleranz, auf die man inmitten der gegenüber jeglicher Neuerung oder Reform misstrauischen jüdischen Gemeinschaften traf.
Bei Erscheinen seiner kommentierten Übersetzung des Pentateuchs, des Bi’ur, musste Mendelssohn sehr verletzende Schmähungen ertragen. So konnte er die Heftigkeit mancher rabbinischer Reaktionen ermessen, die dem neuen Geist besonders feindlich gegenüberstanden: Das „Verbrechen“ von Mendelssohn und seinen Mitarbeitern war es, den Söhnen des Ghettos das Erlernen der deutschen Sprache und die Fähigkeit, die Bibel korrekt in diese Sprache zu übersetzen, zu empfehlen.
Am 19. März 1782 vollendete er sein berühmtes Vorwort zum Text des Rabbiners Menasse ben Israel für die Wiederzulassung der Juden in England. Es ist ein flammendes Plädoyer für Toleranz, auch unter den Juden selbst.
Ach! Meine Brüder! Ihr habt das drückende Joch der Intoleranz bisher allzuhart gefühlt, und vielleicht eine Art von Genugthuung darinn zu finden geglaubt, wenn euch die Macht eingeräumet würde, euern Untergebenen ein gleichhartes Joch aufzudrücken. Die Rache suchet ihren Gegenstand, und wenn sie anders nichts anhaben kann; so nagt sie ihr eigenes Fleisch. Vielleicht auch ließet ihr euch durch das allgemeine Beispiel verführen. Alle Völker der Erde schienen bisher von dem Wahne bethört zu seyn, daß sich Religion nur durch eiserne Macht erhalten; Lehren der Seligkeit nur durch unseeliges Verfolgen ausbreiten, und der wahre Begriff von Gott, der nach unser aller Geständniß, die Liebe ist, nur durch die Wirkung des Hasses mittheilen lassen. Ihr ließet euch vielleicht verleiten eben dasselbe zu glauben, und die Macht zu verfolgen war das euch wichtigste Vorrecht, das eure Verfolger euch einräumen konnten. Danket dem Gotte eurer Väter, dancket dem Gotte, der die Liebe und die Barmhertzigkeit selbst ist, daß jeder Wahn sich nach und nach zu verlieren scheinet. Die Nationen dulden und ertragen sich einander, und lassen auch gegen euch Liebe und Verschonung blicken, die unter dem Beystande desjenigen, der die Herzen der Menschen lenkt, bis zur wahren Bruderliebe anwachsen kann. O meine Brüder! Folget dem Beyspiel der Liebe, so wie ihr bisher dem Beyspiele des Hasses gefolgt seyd! Ahmet die Tugend der Nation nach, deren Untugend ihr bisher nachahmen zu müssen geglaubt. Wollet ihr gehegt, geduldet und von andern verschonet seyn; so heget und duldet und verschonet euch unter einander! Liebet; so werdet ihr geliebet werden!
1860, achtzig Jahre nach Veröffentlichung dieser unsterblichen Sätze, dichtete Moritz Rappaport aus Leipzig folgende Zeilen als Hommage an Mendelssohn:
„In Nacht und Stumpfsinn war das Volk versunken,
In’s Grab der Ahnen zog es sich zurück,
Da naht ein Moses mit den Geistesfunken
Als Flammensäule dem erstaunten Blick.
Er zieht voran ihm mit den milden Strahlen,
Und Israel folgt treu der lichten Spur,
und führt es durch das Meer uralter Qualen
In das gelobte Land hin der Kultur.
[…]
Nur mußt du selber kraftvoll dich erheben,
Und wirken, wie’s der Mann aus Dessau that;
Nach echter Bildung sei dein höchstes Streben,
Doch pfleg’ auch treu die alte, heil’ge Saat.
Erheb’ dich zu des Daseins klaren Höhen,
So wahrst du schön des todten Meisters Ruhm!
Und Hand in Hand, sich stets ergänzend, gehen
Die neue Zeit – das alte Judentum!“1
Es wird schwer sein, einen noch mehr lobenden schriftlichen Beleg zu finden: Das Gründungsereignis der Geschichte Israels dient dazu, die emanzipatorische und zivilisatorische Tätigkeit Mendelssohns zu rühmen. Das gelobte Land der Kultur – eine echte Spiritualisierung des alten Versprechens an den Patriarchen Abraham.