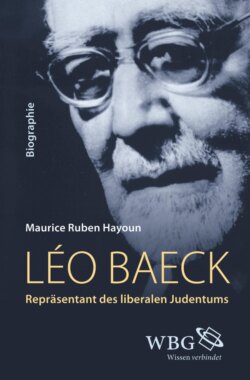Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Moses Mendelssohn
ОглавлениеDas erfolgreiche Integrationsmodell von Mendelssohn (aber nicht das seiner eigenen Kinder) ist immer noch einzigartig. Um zum Geheimnis dieses großen, den Praktiken seiner jüdischen Ahnen treu gebliebenen Philosophen zu gelangen, genügt es, ihm selbst das Wort zu erteilen. Er hat uns einen kleinen autobiographischen Abriss hinterlassen: 1774 auf Anfrage des Bibliothekars Jakob Spieß (gest. 1814) und 1782 in seiner Einleitung zu den Vindiciae Judaeorum (1656) des Amsterdamer Rabbiners Menasse ben Israel, die der Schüler und Freund Mendelssohns, der Arzt Marcus Herz, aus dem Englischen übersetzt hatte. Mendelssohn schreibt:
Ich bin im Jahre 1729 zu Dessau geboren. Mein Vater war daselbst Schulmeister und Zehngebotschreiber, oder Sopher. Unter Rabbi Fränkel, der damals in Dessau Oberrabbiner war, studierte ich den Talmud. Nachdem sich dieser gelehrte Rabbi, durch seinen Commentar über den hierosolymitanischen Talmud, bei der jüdischen Nation großen Ruhm erworben, ward er etwa im Jahre 1743 nach Berlin berufen, wohin ich ihm noch in demselben Jahre folgte. Allhier gewann ich durch den Umgang mit dem nachherigen Doctor der Arzneigelartheit, Herrn Aron Gumpertz (der vor einigen Jahren zu Hamburg verstorben), Geschmack an den Wissenschaften, dazu ich auch von demselben einige Anleitung erhielt. Ich ward hierauf in dem Hause eines reichen Juden Informator, hernach Buchhalter, und endlich Aufseher über desselben seidene Waaren-Manufactur, welches ich noch auf diese Stunde bin. In meinem drei und dreißigsten Jahr habe ich geheirathet, und seitdem sieben Kinder gezeugt, davon fünfe am Leben. Übrigens bin ich nie auf einer Universität gewesen, habe auch in meinem Leben kein Collegium lesen hören. Dieses war eine der größten Schwierigkeiten, die ich übernommen hatte, indem ich alles durch Anstrengung und eigenen Fleiß erzwingen mußte. In der That trieb ich es zu weit, und habe mir endlich durch Unmäßigkeit im Studiren seit drei Jahren eine Nervenschwäche zugezogen, die mich zu aller gelehrten Beschäftigung schlechterdings unfähig macht.
(Moses Mendelssohn an Johann Jacob Spieß, 1. März 1774)
In diesen wenigen Zeilen ist alles gesagt: über die bescheidenen Anfänge, wie er mit 14 Jahren sein Elternhaus verlässt, die unter Leitung eines bedeutenden Rabbiners absolvierten Studien und das Betreiben „profaner“ Wissenschaften aus eigenen Mitteln, wie ein echter Selfmademan. Diese nüchterne Beschreibung macht die zutiefst moralische Einstellung des großen Philosophen sichtbar: Er widmet den Menschen, denen er alles verdankt, eine Hommage: dem Mann, der ihm vertraute und ihn in seine Dienste nahm, dem großen Rabbiner Fränkel nämlich, der ihn nach Berlin holte; ohne diesen Schritt wäre er in seinem Heimatstädtchen Dessau dahinvegetiert. Außerdem Dr. Aron Gumpertz, der ihn lehrte, über die vier Ellen des Talmuds und des Midrasch hinauszugehen. Das ist bis auf wenige Details der Lebenslauf, dem Baeck ein Jahrhundert später folgen würde.
Was war Mendelssohn tatsächlich anderes als ein Maimonides, der sich mit der Leibniz-Wolff-Schule identifizierte und Spinoza mit kritischem Blick gelesen hatte? Diese maimonidische Nachfolge wurde durch den jüdischen Denker von Berlin weiter vorangetrieben, selbst nachdem er zur Galionsfigur der Aufklärung geworden war. Das persönliche Schicksal der beiden Moses zeigt einige Ähnlichkeiten. Während Mendelssohn weder die Persönlichkeit noch das kritische Werk des berühmten Amsterdamer Glasschleifers Spinoza literarisch aufnahm, widmete Baeck ihm seine Doktorarbeit und analysierte seinen Einfluss auf die deutsche Philosophie sehr genau.
Die beiden Moses, Maimonides und Mendelssohn, waren ständig sozio-religiösem Druck ausgesetzt und mussten Angriffe und Verleumdungen der Außenwelt oder aus den eigenen jüdischen Reihen überstehen. Nach seinem Aufenthalt in Fes, wo er wie ein Kryptojude gelebt hatte, wurde Maimonides angeklagt, zum Islam konvertiert zu sein. Was Mendelssohn angeht, so wurde er öffentlich von Johann Kaspar Lavater, einem enthusiastischen Züricher Diakon, angegriffen. Dieser forderte ihn auf, das zu tun, was ihm seine Courage, intellektuelle Redlichkeit und Liebe zur Wahrheit gebieten würden, nämlich das Judentum zu verlassen.
Maimonides schrieb den Führer der Verwirrten, um seine Religion gegen den neu-aristotelischen Sturm seiner Zeit zu verteidigen, Mendelssohn fühlte die Notwendigkeit, sein Werk Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum zu schreiben, um dem Europa der Aufklärung zu zeigen, dass die Religion Israels entgegen den antisemitischen Vorurteilen eben nicht exklusiv sei. Man neigt ein wenig dazu, das zu vergessen, doch das erste bedeutende Werk des jungen Rabbiners Leo Baeck, Wesen des Judentums (1905), wollte eine Antwort sein auf das provozierende Buch des protestantischen Theologen Adolf von Harnack (1851–1930) mit dem Titel Wesen des Christentums (1900). Man entdeckt damit bei den drei jüdischen Denkern Maimonides, Mendelssohn und Baeck eine Art Schicksalsgemeinschaft.
Der Weise aus Fostat und der Philosoph aus Berlin haben versucht, das Judentum ihrer jeweiligen Zeit zu „modernisieren“, beide stießen auf beträchtlichen Widerstand, der ihrer Reputation ein wenig schadete. Beide waren sozusagen „Außenseiter“: Sie waren keine Rabbiner, sie standen keiner jüdischen Gemeinde vor, waren keine Professoren (jedenfalls was Mendelssohn betrifft). Dennoch unternahmen beide große Anstrengungen, das zeitgenössische Judentum zu stärken.
Ohne identisch zu sein, sind ihre jeweiligen Auffassungen vom Judentum nicht weit voneinander entfernt. Mendelssohn unterschied im Wesentlichen drei Elemente im Schoß des Judentums: ein lehrmäßiges Element, das sich mehr oder weniger an die Naturreligion angeglichen hatte, eine Offenbarung, deren Inhalt ausschließlich gesetzgebend war (und in keiner Weise ein Korpus philosophischer Vorstellungen), und schließlich das durch die Geschichte übertragene Erbe. Dieser Wille, zu zeigen, dass die wesentlichen Doktrinen des Judentums nichts der Offenbarung verdanken, verrät eine solide Neigung Mendelssohns zur Autonomie der menschlichen Vernunft. Die genannte Dreiteilung des Judentums ist leicht zu verstehen: Die ewigen Wahrheiten, wie man es im 18. Jahrhundert nannte, konnten sich nicht auf die Offenbarung gründen, auf dieses einzigartige Ereignis, das nur einer kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten war und damit den Universalcharakter einschränkt. Nur Positivgesetze oder religiöse Vorschriften (Mitzwot) könnten Gegenstand einer Offenbarung sein, und schließlich könnten Wunder die ewigen Wahrheiten weder auf- noch entwerten. Leo Baeck trat in die Fußstapfen eines berühmten Vorgängers, als er zeigte, dass das Judentum keine Dogmen kennt.
Diesem universalistischen Zugang zum Judentum gab Mendelssohn wesentliche Bedeutung, und zwar aus folgendem Grund: Auf diese Weise mussten die Heiden, die sich aus purer menschlicher Vernunft zum Monotheismus bekehrten, das Recht auf die zukünftige Welt haben, mit anderen Worten: auf die ewige Glückseligkeit, ein Leben im Jenseits. Eine andere Unterteilung der fundamentalen Inhalte des Judentums hätte es Mendelssohn nicht erlaubt, seine universalistischen Ideale aufrechtzuerhalten. Vernunft oder Rationalität war ein unantastbares Prinzip des Jahrhunderts der Aufklärung. Auch ist erkennbar, dass Mendelssohn am Ende seines Lebens den Rückgriff auf eine klassische Philosophie mehr und mehr aufgab, um sich an eine Philosophie des gesunden Menschenverstandes zu halten, die sich weitestgehend auf die Vernunft stützte.
Bei Maimonides begegnet man fast demselben Glauben an den konzeptuellen Zugang zur Religion: der fundamentalen Einheit zwischen Offenbarung und Vernunft, zwischen religiöser Tradition und philosophischer Spekulation, und der Überzeugung, dass das Ergebnis dieser polaren Spannung für den Menschen auf der Suche nach Wahrheit nur gewinnbringend sein könne.
Die Maskilim, die jüdischen Anhänger der Aufklärung, vor allem diejenigen, die das hebräische Journal Ha-Meassef gründeten (1784), entwarfen das Bild eines Maimonides, der in dieser Form lediglich in ihrer erfinderischen Einbildung existierte. Dieser Wille, Maimonides in den Dienst der Haskala zu stellen, indem man eine direkte Linie zu ihrem eigenen zeitgenössischen Helden Mendelssohn zog, wurde von einer Typologie begleitet, die die beiden Moses einander gleichstellen wollte, den von Córdoba und den von Dessau/Berlin. Wenn man glaubt, den Einfluss eines Philosophen auf einen anderen identifiziert zu haben, muss man sich zunächst vergewissern, dass diejenigen, die diesen Einfluss sehen wollen, nicht das, was sie in ihrer Quelle finden wollen, einfach übertragen: Was über Maimonides im Verlauf des 14. Jahrhunderts vermutet wurde – wo der entstehende jüdische Averroismus in ihm einen Schüler des Averroes (gest. 1198) sehen wollte, der seinen wahren Namen verbarg –, geschah vielleicht am Ende des 18. Jahrhunderts erneut, als die Maskilim im Verfasser des Buches Führer der Verwirrten einen Anhänger der Säkularisierung sehen wollten. In den Zeitungsspalten von Ha-Meassef (1785, S. 81), konnte man den berühmten Satz aus jener Zeit lesen: „Von Moses [Maimonides] zu Moses [Mendelssohn] hat es keinen ebenbürtigen Moses gegeben.“
Diese Ähnlichkeit zwischen Maimonides und Mendelssohn, die von den jüdischen Anhängern der Aufklärung so geduldig gestrickt worden war, wurde von Leo Baeck als offensichtlich vorhanden betrachtet. Sie ist Teil seiner Postulate: Inspiriert durch die Bildung eines deutschen Juden schöpfte Leo Baeck aus Mendelssohn genauso viel wie aus Maimonides, der der breiten und tiefgehenden Reform des jüdischen Erziehungswesens als Bürge diente.
Doch wie alle reformatorischen und innovativen Denker konnten auch Maimonides und Mendelssohn nie im Namen des gesamten Judentums ihrer Zeit sprechen. In der hebräischen Korrespondenz von Mendelssohn finden wir einen Briefwechsel mit zwei bekannten ultra-konservativen Rabbinern seiner Zeit: Jacob Emden (1697–1776) und Jonathan Eibeschütz (1690–1764). Diese beiden Gelehrten bemühten sich, die alte Tradition vollständig zu bewahren, während Mendelssohn mit jeder Faser seines Körpers danach strebte, eine neue Welt entstehen zu lassen, in der das Judentum, seiner authentischen Tradition treu, sich mit dem Geist der Zeit versöhnen und dort seinen Platz finden würde. Im Grunde ist dies das gleiche Dilemma, das Leo Baeck seinerzeit erlebte, dessen größter Verdienst, wie wir noch zeigen werden, es war, die unterschiedlichen, teilweise einander entgegengesetzten Strömungen des zeitgenössischen Judentums zum gemeinsamen Wirken zu bringen. Es reichte nicht aus, um die Gefahren, die dem Judentum während der nationalsozialistischen Diktatur auflauerten, vollständig zu bannen, sollte sie jedoch etwas verringern.