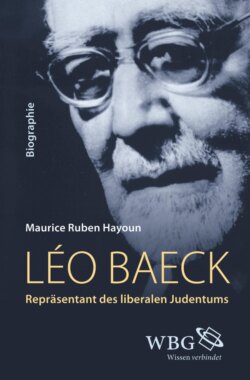Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Johann-Amos-Comenius-Gymnasium in Lissa
ОглавлениеJohann Amos Comenius oder Jan Amos Komensky (1592–1670) war ein tschechischer Pädagoge und Geistlicher. Ähnlich wie die Brüder der Brüder-Unität erlitt auch er Verfolgungen durch die Gegenreformation und fand Zuflucht in Lissa. Dort gründete er die Lehreinrichtung, die seinen Namen trägt. Die Atmosphäre von Toleranz und Öffnung, die in diesem Gymnasium vorherrschte, hinterließ bei Leo einen tiefen Eindruck. Comenius, ein Anhänger von Jan Hus, wurde mit zwölf Jahren Waise. Der fleißige und talentierte Schüler erregte die Aufmerksamkeit seiner Lehrer, die ihn unterstützten und ermunterten, ausgedehnte Studien zu betreiben. 1613 ist er in Heidelberg, wo er die Fakultät für Theologie besucht. Im Jahr darauf kehrt er in seine Heimat Mähren zurück und wird dort 1616 Pastor. Nur wenige Jahre darauf verwüstet der Dreißigjährige Krieg einen Großteil Europas, bis er 1648 durch den Westfälischen Frieden endlich beendet wird. Während des Krieges stecken spanische Truppen, der bewaffnete Arm der Gegenreformation, die Stadt Fulnek an, wo Comenius lebt. Er muss fliehen und Frau und Kinder zurücklassen, seine Bibliothek wird verwüstet. Entmutigt ließ er sich, seit 1624 erneut verheiratet, in Lissa nieder. Doch sein Ruf als großer Pädagoge war ihm vorausgegangen; sogar Kardinal Richelieu lud ihn nach Paris ein, doch Comenius lehnte das Angebot, in die Hauptstadt des Königreiches Frankreich zu gehen, höflich ab. 1642 sollte er René Descartes begegnen, den ein Enzyklopädist wie Diderot nicht besonders schätzte und in den Rang eines einfachen Theologen herabstufte! Comenius führte weiterhin ein herumirrendes Leben und ging zunächst nach England, bevor er nach Schweden zog, wo man ihm die Reform des Erziehungswesens anvertraute.
Wieder ereilte ihn ein schlimmes Schicksal: Seine zweite Frau verstarb plötzlich. Er heiratete ein drittes Mal. Ein gewalttätiger Angriff durch polnische Katholiken machte ihm ein weiteres Mal seine unsichere Lage bewusst. 1656 schließlich zog er nach Amsterdam, einem echten Friedenshort, wo das Einvernehmen zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften fest verankert war.
Die Pädagogik ist vielleicht der Bereich, wo sich Comenius die größten Verdienste erworben hat, denn man betrachtet ihn als Vater der modernen Pädagogik. Bildung und Kultur standen für ihn bei all seinen Beschäftigungen an oberster Stelle. In seinen Augen konnte nur eine Bildungsreform Europa von der tiefen Krise heilen, die der Dreißigjährige Krieg verursacht hatte. Die christliche Botschaft war seiner Ansicht nach folgendermaßen zusammenzufassen: Alle Menschen wurden nach dem Abbild Gottes geschaffen, folglich haben alle das Recht, Zugang zu einer Bildung zu haben, die es ihnen erlaubt, die heiligen Texte kennen zu lernen. Wörtlich schreibt er: „Zunächst wünschen wir, dass in dieser vollkommenen Weise nicht nur irgendein Mensch, wenige oder viele zum wahren Menschentum geformt werden, sondern alle Menschen, und zwar jeder einzelne, jung und alt, arm und reich, adelig und nichtadelig, Männer und Frauen, kurz jeder, der als Mensch geboren ist. So soll künftig die ganze Menschheit dieser vervollkommnenden Wartung zugeführt werden, alle Altersstufen, alle Stände, Geschlechter und Völker.“ Klar zu spüren ist hier die Überzeugung eines Mannes, der sehr jung zur Waise wurde und seinen sozialen Aufstieg und Erfolg ausschließlich seiner Bildung verdankte.
Comenius spricht häufig von der Idee der Pansophie, dieser Universalweisheit, die er in den Herzen und Köpfen der gesamten Menschheit verbreiten wollte. Das menschliche Wesen sollte sein ganzes Leben lang lernen, die Bildung sozusagen als Zyklus das gesamte Leben durchlaufen.
So ist es gut zu verstehen, dass Samuel Baeck seinen Sohn ohne Bedenken an einem Gymnasium anmeldete, in dem die humanistischen Ideale seines Gründers wörtlich genommen und verwirklicht wurden.
Bei dieser Geschichte aufgrund ihres Glaubens verfolgter Menschen darf man den bereits genannten Märtyrer Jan Hus nicht unerwähnt lassen. Dieser berühmte Theologe, der ein Reformator sein wollte, wurde 1415 während des Konzils von Konstanz auf den Scheiterhaufen geworfen. 1396 hatte er seinen Magister Artium erhalten und wurde Theologe, 1411 aber exkommuniziert, weil er die häretischen Vorstellungen von John Wyclif unterstützte. Tatsächlich hatte sich Jan Hus gegen den Ablasshandel aufgelehnt, die einzige Methode, die dem Papsttum einfiel, um den Krieg gegen die Ketzer zu finanzieren.
Jahre nach dem Schulbesuch in Lissa, 1913, vermittelte Baeck seiner Hörerschaft an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin einen Gedanken, der wohl direkt aus der den Namen Comenius tragenden Schule stammt: Ein Rabbi sei ein Lehrer, der sich beständig selbst fortbilde. Ist dies nicht das beste Zeugnis zugunsten eines interreligiösen und humanistischen Dialogs, in dessen Verlauf ein evangelischer Theologe ein Ideal vermittelt, das dank eines liberalen Rabbiners dauerhaft weitergetragen und das über lange Jahre die Zukunft des gesamten deutschen Judentums bestimmen wird?