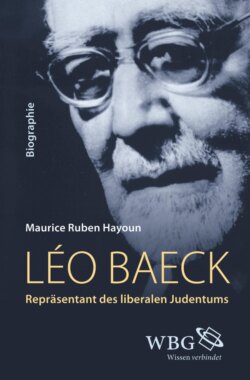Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Das Jahrhundert nach Moses Mendelssohn (1729–1786) Allgemeines
ОглавлениеLeo Baeck (1873–1956) wurde ein knappes Jahrhundert nach dem Tod des Mannes geboren, der einhellig als Begründer des Judentums in Preußen und später in Deutschland und Europa angesehen wird. Damit ist er der Vater des modernen Judentums, der Denker, der der Tradition der Vorfahren treu geblieben ist, ohne sich dem außergewöhnlich fruchtbaren Beitrag der europäischen Kultur zu verschließen.
Leo Baeck, dessen Leben wir hier nachverfolgen und dessen Werke wir vorstellen werden, ist also auch ein Erbe des Mendelssohn’schen Judentums. Seine schulische Erziehung erfolgte gemäß der Erziehungsreform, die von dieser Galionsfigur der Berliner Aufklärung initiiert worden war, und er musste sich mehrere Male in seinem Leben mit dem intellektuellen und spirituellen Vermächtnis seines berühmten Vorläufers auseinandersetzen, in der Hoffnung, den Juden dabei zu helfen, sich bestmöglich in ihre europäische Umgebung zu integrieren.
Mendelssohn befand sich an einem Scheideweg, als er die jüdische Identität oder, wie man in Deutschland zu sagen pflegte, das Wesen des Judentums definierte. Diese Problematik war auch mitten im Herzen und im Werk von Leo Baeck verankert.
Auch wenn es im Leben und Denken dieser beiden bedeutenden deutsch-jüdischen Gestalten bemerkenswerte Unterschiede gibt, so sind sie doch in vielen grundlegenden Punkten einig, darunter besonders in der Notwendigkeit für das Judentum, sich der Kultur der sie umgebenden Welt zu öffnen, weil es bei dieser kulturellen Konfrontation nichts zu befürchten gebe. Später wird, wie wir noch sehen werden, ein tiefgründiger Philosoph wie Hermann Cohen (1842–1918), der Baeck sehr inspiriert hat, sagen, dass das Judentum eine Kulturreligion sei, das heißt eine harmonische Verbindung aus beidem, Kultur und Religion.
Zu Beginn hatten weder Mendelssohn noch Baeck die Bestimmung, eine solch große Gemeinschaft zu einem Wendepunkt ihrer Existenz zu führen: Sollte man das Spiel der Emanzipation, das nach Jahrzehnten der Ausflüchte von den preußischen Autoritäten offen angeboten wurde, naiv mitspielen, jedoch ohne Hoffnung, auf diese Weise die bürgerlichen Rechte, die Staatsangehörigkeit oder die vollständige Integration zu erreichen? Oder sollte man ganz im Gegenteil dem Beispiel Heinrich Heines folgen, der empfahl, „den Talmud über Bord zu werfen“, um sich in die europäische Ethnie und Kultur zu versenken? Und schließlich zu verschwinden … Es ist bekannt, dass dieser Schriftsteller und Dichter seine Entscheidungen nie bis zum Ende geführt hat. In jungen Jahren war er Mitglied der Bewegung, die sich für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Judentum einsetzte, auf seinem Sterbebett bereute er bitterlich, dass er der Religion seiner Väter abgeschworen hatte, um Christ zu werden.
In der Debatte standen sich eine janusköpfige Emanzipation mit einem sichtbaren lächelnden Gesicht sowie einem verborgenen Fratzengesicht und eine jüdische Orthodoxie gegenüber, die man genauso gut eine „Stereodoxie“ nennen könnte, da sie sich nämlich hermetisch in ihren Positionen verschanzte und sich weigerte, auch nur eine Handbreit Terrain aufzugeben, auch nur die leiseste Konzession an die Moderne zu machen. Viele Male musste Leo Baeck sich fragen, wer in diesem manichäischen Schema, in dem das Denken dazu verdammt war, zwischen zwei antinomischen Kategorien hin- und herzuschwanken, Recht hatte. Wie wir im Verlauf des Buches sehen werden, hat Baeck einen ganz eigenen Weg gewählt, den der goldenen Mitte, der von seinem mittelalterlichen Vorgänger Moses Maimonides so eloquent empfohlen worden war.
Wenn man das intellektuelle Bemühen Baecks analysiert, mit dem er das Judentum seiner Zeit bereinigen, regenerieren und lebendig halten wollte, würde man sagen, dass es zwei Modelle gab: die beiden Moses-Modelle, eines aus dem 12. Jahrhundert n. Chr., welches Aristoteles wieder aufnahm, und eines Ende des 18. Jahrhunderts, das für ein subtiles, von der Natur her eigentlich instabiles Gleichgewicht zwischen der Treue zur jüdischen Identität und dem machtvollen und verlockenden Reiz der kulturellen Reichtümer Europas optierte. Sein ganzes Leben lang sann Baeck darüber nach, er, der jeden Morgen gemeinsam mit seinem Vater, einem für seine Zeit sehr aufgeklärten Rabbiner, sein tägliches Gebet verrichtete, eine Seite des Talmuds studierte und sich zum Abschluss in einen Text von Aischylos oder Sophokles versenkte, die er im Original las.
Doch kannte das Jahrhundert nach Mendelssohn noch weitere große Gestalten des Judentums, von denen eine bedeutender war als die andere. Es sind diese Persönlichkeiten, diese Denker und Philosophen, große Gelehrte, die wir in Erinnerung rufen, um das breite Spektrum darzulegen, das Leo Baeck durchlaufen hat und das von Moses Mendelssohn bis zu Martin Buber (gest. 1965) reichte.