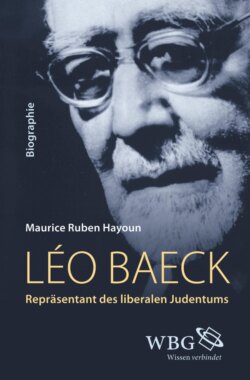Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lissa, Leszno, ein wichtiges Zentrum für Talmudstudien
ОглавлениеLeo Baeck wurde am 25. Mai 1873 in Lissa geboren, einer Stadt, die je nach Kriegsausgang und je nach Ausgewogenheit oder Unausgewogenheit der Friedensverträge und polnischen Teilungen mal deutsch, mal polnisch war. Zum ersten Mal erwähnt wurde die Stadt in historischen Dokumenten von 1393. Wie alle Provinzen, um die sich mehrere Staaten stritten, kannte auch diese Stadt viele Schicksalswendungen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde sie zum Refugium für Mitglieder der Brüder-Unität, die aus dem benachbarten Böhmen kamen. Diese massenhafte Immigration, vor allem von Webern und anderen Handwerkern, trug sehr zur Entwicklung des Marktfleckens bei. Das Vorhandensein zahlreicher protestantischer Kirchen machte aus ihr ein bedeutendes Zentrum des Buchdrucks. Der Dreißigjährige Krieg verstärkte die Einwanderung, zahlreiche Flüchtlinge aus Schlesien ließen sich in Lissa nieder. Wie so viele andere europäische Städte erlitt auch Lissa zwei Großbrände, die es 1655 und 1707 verwüsteten, nicht zu vergessen die Pestepidemie, die 1709 zahllose Opfer forderte. Bei der zweiten polnischen Teilung wurde die Stadt von Preußen annektiert und kam zum Großherzogtum Posen.
Im Verlaufe vieler Einwanderungswellen ließen sich die Juden in Lissa nieder, wo ein bedeutendes Zentrum für Rabbinerstudien entstand, mit großen halachischen Autoritäten wie Rabbi Akiba Eger (1761–1837) und Rabbi Jakob Lissa (1760–1832). Er war ein Enkel des berühmten Chacham Zwi, des großen Rabbiners der Aschkenasen-Gemeinde von Amsterdam zu Beginn des 18. Jahrhunderts, der für seinen unerbittlichen Kampf gegen die Anhänger des falschen Messias Sabbatai Zwi bekannt war (1626–1676). Rabbi Jakob Lissa (auch Lorbeerbaum genannt) hat zahlreiche Abschnitte des religiösen Gesetzbuches Schulhan Aruch kommentiert: Unter dem Titel Sefer Netiwot Hamischpat (Buch über die Wege des Rechts) wurde das Buch in den orthodoxen Milieus des 19. Jahrhunderts sehr geschätzt. Als würdiger Repräsentant dieses familiären Eifers fiel Jakob durch seinen Kampf gegen die Verfechter der Haskala auf, der jüdischen Aufklärung. Damit tat er es seinem berühmten Großvater Chacham Zwi gleich, der gegen die Krypto-Sabbatisten von Amsterdam einen gnadenlosen Kampf führte.
Die jüdische Bevölkerung Lissas stammte zu gleichen Teilen aus dem benachbarten Polen, aus Preußen und aus Böhmen und Mähren. Die Juden gründeten Talmudschulen und bildeten Gelehrte aus, an die aus ganz Europa Anfragen gestellt wurden, um religiöse Probleme zu lösen.
Doch wie in anderen Regionen Deutschlands oder Polens erlitten auch die jüdischen Gemeinden in Lissa zahlreiche Schicksalsschläge: 1709 zum Beispiel, bei der großen Pestepidemie, beschuldigte man die jüdischen Händler, die Felle aus Russland importierten, für deren Ausbreitung verantwortlich zu sein. Sie wurden zeitweilig aus der Stadt vertrieben; danach hörten die Ausschreitungen des Pöbels auf. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts profitierte die wirtschaftliche Expansion der Stadt auch von den Juden, deren Zahl 1765 ca. fünftausend betrug (etwa 15 % der Gesamtbevölkerung). Zu jener Zeit gab es in Lissa etwa neun jüdische Handwerkergilden: Metzger, Fleischer, Juweliere, Schneider, Sticker, Kürschner, Gerber etc. Da sie keine Erlaubnis hatten, mit Kleidung und anderen Textilprodukten Handel zu treiben, nahmen sie im Wollhandel eine wichtige Stellung ein. Sie importierten die Wolle aus der Ukraine und aus Russland. Bereits 1686 waren über zwanzig jüdische Händler aus Lissa auf der berühmten Leipziger Messe vertreten.
1920, als die Stadt im Zuge des Versailler Vertrages an Polen fiel, wurde sie wieder in Leszno umbenannt. Doch die Wirren des Zweiten Weltkrieges brachten Lissa in den Schoß des Hitlerreiches. Erst nach der Niederlage NS-Deutschlands nahm die Stadt erneut den polnischen Namen an. Das Schicksal eines solchen Ortes, der zwischen zwei Zugehörigkeiten hin- und hergeworfen wird und wo die unterschiedlichen Bevölkerungsteile gezwungen sind, zusammen zu wohnen und zu leben, erklärt einige Persönlichkeits- und Charaktermerkmale Leo Baecks, vor allem seinen offenen Geist, seinen Sinn für Toleranz, sein allgemeines Interesse an Kultur und anderen Glaubensrichtungen sowie seine Ablehnung jeder Form von Ausschließlichkeitsansprüchen. Wie wir noch sehen werden, war Lissa bekannt für die harmonische Koexistenz seiner verschiedenen Religionsgemeinschaften und für das herzliche Einvernehmen, das die Beziehung zwischen dem Pastor und dem Rabbiner kennzeichnete. Dies ist insbesondere beim Vater Baecks der Fall, der achtundvierzig Jahre lang Rabbiner der Stadt war und mit seinem evangelischen Kollegen eine aufrichtige Freundschaft pflegte.
Betrachtet man die historischen Bilder dieser Epoche, sieht man eine nette kleine Provinzstadt mit schönen Bürgerhäusern und Promenaden, an denen der Vater Baecks am Samstagnachmittag gern entlangspazierte. Die Stadt hatte große Kirchen, darunter eine Stiftskirche, ein Schlachthaus, eine hervorragende Kanalisation und ein Elektrizitätswerk. Doch vor allem die Bildungsinfrastruktur war bemerkenswert. Eine Reihe von Kupferstichen9 präsentiert Lissa als Schulstadt mit zahlreichen Bildungseinrichtungen, die einen exzellenten Ruf genossen. Dabei hatte die Stadt zur Zeit Baecks gerade einmal etwa zwanzigtausend Einwohner. An der Spitze der Bildungseinrichtungen stand sicherlich das Comenius-Gymnasium, gefolgt von zwei Lehrerseminaren (eins für Jungen, eins für Mädchen), außerdem gab es ein technisches und Berufslyzeum. Nicht zu vergessen die drei Elementarschulen: eine katholische, eine evangelische und schließlich eine jüdische, die Leo Baeck besuchte, bevor er sich ins Comenius-Gymnasium einschrieb.
Als bedeutende Stadt innerhalb des Großherzogtums Posen war Lissa auch durch sein reichhaltiges Vereinsleben sowie für seine musikalischen und literarischen Veranstaltungen bekannt, nach zeitgenössischen Berichten war sie die wichtigste Kulturstadt im südlichen Großherzogtum, die ihren Bewohnern jährlich etwa sieben Konzerte und sieben Vorträge bot, organisiert von über vierhundert Mitgliedern einer kulturellen Vereinigung.
In Lissa wurde 1814 ein Mann geboren, der zum überzeugten Anhänger der Revolution von 1848 wurde und dessen umherirrendes Leben ihn bis nach Paris führte, wo er 1882 starb: Ludwig Kalisch. Wenn ich über ihn spreche, dann deshalb, weil er uns eine bemerkenswerte Autobiographie hinterlassen hat, in der er ausführlich über seine Kindheitserinnerungen spricht10. Es ist eine lebendige Schilderung einer für immer verschwundenen Zeit: Wir erleben darin die jüdische Gemeinde von Lissa bis 1826, dem Jahr, in dem Kalisch beginnt, durch Deutschland zu reisen. Sein Zeugnis ist eine echte Fundgrube, um die Stadt und ihre Milieus kennen zu lernen.
Kalisch betont die jüdische Gelehrtheit, die sich in der Stadt seit dem 17. Jahrhundert herausbildet. Er spricht über seinen Urgroßvater, den seine Zeitgenossen aufgrund seines unbestreitbaren dialektischen Geistes „scharfschneidiges Schwert“ nannten und der immer von einer Schar Schüler umgeben war. Dieser heilige Mann hatte sein gesamtes Leben der Talmud-Gelehrsamkeit gewidmet. Er lebte innerhalb der vier Ellen des Talmuds und des Midrasch, kannte keine andere Wissenschaft und hielt seine traditionellen Kenntnisse für die Quintessenz des Wissens.
Als Junge erhielt er die Bildung, die den jüdischen Kindern von Lissa allgemein zuteil wurde, was zur Zeit Leo Baecks nicht mehr der Fall war. Die Talmud-Thora-Methode bestand darin, den Schülern das Lesen und Schreiben der hebräischen Sprache beizubringen. Es wurde kein weiteres akademisches, nichtreligiöses Fach gelehrt, mit Ausnahme des Rechnens und einiger mathematischer Ansätze. Gängig war die überbetonte Wichtigkeit des Auswendiglernens, vor allem zum Erlernen der Gebete.
Kalisch gibt zu, lieber die Bibel gelesen als den Talmud studiert zu haben, den er für sterbenslangweilig hielt. Wir erinnern uns hier an einen Zeitgenossen, der 1800 starb, Salomon Maimon, der diese Überrepräsentation der traditionellen Fächer in der jüdischen Schulbildung bitter beklagte und insbesondere die Talmud-Abhandlungen, deren gleichzeitig abstrakter und trockener Charakter ihn abschreckte. Nur der erzählerische Teil, die Talmud-Aggada, erlaube es der Einbildungskraft der Kinder, diesem abgeschlossenen, künstlichen Universum ein wenig zu entfliehen. Manchmal benutzt Kalisch harsche Worte, wenn er sich an diese Talmud-Akribie erinnert, die Haarspalterei betreibe, nicht ein Wort ohne einen Haufen Interpretationen stehen lasse, die aber mit dem offensichtlichen Sinn des Textes höchstens in weitestem Sinne zu tun habe. Doch vergisst er dabei nicht, die förderliche Rolle des Talmuds zu unterstreichen, wenn es darum geht, das Überleben des Judentums zu sichern, zu seiner Erhaltung beizutragen. Er befasst sich auch mit den erklärten Feinden dieser traditionellen Literatur, die er deutlich kritisiert: Diese „schweinsledernen Theologen“, so schreibt er, „die sich bei abtrünnigen Juden ihre Gelehrsamkeit zusammengebetteln.“ Sie täten besser daran, vor ihrer eigenen Tür zu fegen, denn „es sieht vor den Thüren der theologischen Hörsäle nicht sauberer aus als vor den Thüren der Talmudschulen.“
Insgesamt stellen uns die Beschreibungen Kalischs eine Welt von gestern dar, eine Welt von jüdischen Gemeinden in Osteuropa mit all ihren Werten, Traditionen und Gesetzen. Doch konnte diese Welt die Konfrontation mit dem neuen Geist und vor allem mit der Säkularisierung, die alle gesellschaftlichen Bereiche umfasste, nicht vermeiden, ganz zu schweigen von den immer wieder auftretenden Konflikten mit der christlichen Außenwelt. Der Alltag eines Juden in Lissa, wie Kalisch ihn beschreibt, beschränkte sich auf das Haus, die Synagoge und den Markt. Im Privatleben nahm die Familie all ihre Rechte wahr, das Familienoberhaupt regierte ohne Schwierigkeiten über seine kleine Welt, weil das Milieu ein vollständig jüdisches war. Im Grunde war dies der einzige Ort, an dem der jüdische Mensch im Frieden mit sich selbst war. In der Synagoge traf der Jude seine Glaubensbrüder und nahm am Leben der Gemeinde teil, was auch manche mehr oder weniger schwer zu ertragenden Zwänge mit sich brachte. Auf dem Markt war der Kontakt zu nichtjüdischen Menschen unvermeidbar. Die Autarkie der Gemeinde ging mit der wirtschaftlichen Autarkie nicht konform. Kalisch bedauert zutiefst, dass die christliche Welt nicht die mindeste Anstrengung unternehme, das Judentum so zu entdecken, wie es wirklich sei. Stattdessen, so schreibt er, fahre man fort, es nur wie „in einem Zerrspiegel“ zu sehen.
Ohne jemals den negativen Charakter von Salomon Maimons Beschreibung der Gemeinden in Polen und Litauen zu erreichen, enthüllt Kalisch einige wenig schmeichelhafte Aspekte seiner Zeitgenossen: Aberglaube, Angst vor dem bösen Blick, das Tragen von Amuletten, die Verbannung der Armen oder Analphabeten in den hintersten Winkel der Synagoge etc. Was für Relikte der Vergangenheit! Der Autor wusste sehr wohl, dass die Öffnung zur Außenwelt eine Notwendigkeit und die Integration der Juden in den Schoß der europäischen Kultur und Gesellschaft unumgänglich war. In Mendelssohn sah er den Mann, der den Weg zur Kultur und zur Emanzipation geöffnet habe, unter strikter Beachtung der traditionellen Werte.