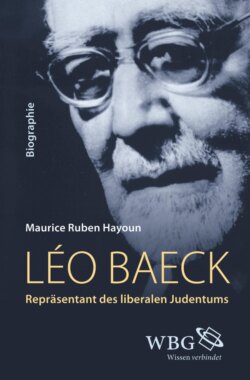Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Samson-Raphael Hirsch, ein Meister der Neuorthodoxie
ОглавлениеEine Klärung vorab: Die Neuorthodoxie ist nicht mit der Orthodoxie gleichzusetzen. Die Zugangsweise der beiden Richtungen ist nicht identisch. Wie der Name sagt, erneuert der Anhänger der Neuorthodoxie das auf ihn überkommene Erbe und gibt sich nicht damit zufrieden, es einfach ohne jegliche Änderung für sich zu übernehmen. Gleichzeitig strebt er danach, das eigentliche Wesen der Tradition nicht zu verleugnen.
Zu Beginn schien Hirsch nicht dazu prädestiniert zu sein, die Thesen der jüdischen Neuorthodoxie im Deutschland des 19. Jahrhunderts zu verteidigen: weder durch die religiösen Praktiken seiner Familie noch durch die traditionelle Ausbildung, die er von Kindesbeinen an erhielt. Sein Vater Raphael Hirsch trug keinen Bart und studierte den biblischen Text, zwei Anzeichen, die auf eine Übernahme der Ideale der Haskala schließen lassen. Schon in jungen Jahren strebte Hirsch eine Karriere als Rabbiner an; er verließ sogar die prestigeträchtige Universität Bonn, ohne seinen Doktor gemacht zu haben, und verwandelte sich in einen gefürchteten Tribun, indem er für eine jüdische Tradition kämpfte, die von allen Seiten bedroht war: von den Anhängern des Liberalismus und der Reformbewegung, laut Hirsch aber auch vom Clan einer reinen, harten Orthodoxie, die sich auf sich selbst zurückgezogen hatte und durch Rabbiner polnischer Herkunft verkörpert wurde, die sich als letztes Bollwerk der Halacha gegen den Geist der Aufklärung sahen. Diese Männer zeigten sich wenig geneigt, die Fortschritte der Wissenschaft und Technik in ihr Religionskonzept zu integrieren, und folgten freiwillig der sehr scharfen Formulierung eines Moses Sofer (gest. 1839), genannt Chatam Sofer (Hiddusche Thorat Mosche Sofer): „He’Haddasch assur min Hatorah.“ (Die Thora verbietet jegliche Neuerung.)
Einem jungen Juden, der in der wohlhabenden Stadt Hamburg geboren wurde, der würdigen Erbin einer reichen norddeutschen Tradition, wo jüdische Gemeinden, auch Sepharden, seit einer Ewigkeit heimisch waren, erschien das Judentum in verführerischen Farben der Öffnung des Geistes und intellektuellen Neugier. Beides stellte kein Problem dar, um sich mit einer jüdischen Seele zu vertragen. Diese Seele aber wurde durch die Aufklärung in ein schlechtes Licht gestellt (die Aufklärung wurde zum Feind der Religion), doch auch durch ein Mendelssohn’sches Erbe, das durch manchmal wenig gewissenhafte Erben weitgehend verbogen worden war. Daher ist es ganz natürlich, dass der junge Hirsch niemals eine Talmudschule, eine Jeschiwa, besuchte – was ihm seine Gegner zum Vorwurf machten, indem sie seine dürftige halachische Gelehrsamkeit kritisierten. Diese Geisteshaltung wurde durch die Rabbiner Bernays und Ettlinger bestätigt, die dafür bekannt waren, dass sie ihren Studenten gestatteten, Universitätsvorlesungen zu besuchen. Mit dem ihm eigenen Genie re-aktualisierte der junge Hirsch die Talmud-Formel, die sein gesamtes Tun zusammenfasst: „Thora im derech eretz“ (die Thora und der Weg der Erde, d.h. das weltliche Wissen). Die originale Formulierung, aus der antiken Rabbinerliteratur hinreichend bekannt, spricht von Talmud Thora (Studium der Thora) und wird häufig dem Rabbi Jehuda ha-Nasi (Rabbi Juda der Fürst) zugeschrieben, der als derjenige gilt, der die Mischna4 kodifiziert hat. Das heißt, dass sich der junge Hirsch eine angesehene Persönlichkeit als Schirmherrn holte, um das deutsche Judentum des 19. Jahrhunderts vorsichtig zu erneuern.
Warum sollte man ausgerechnet bei Samson-Raphael Hirsch von Neuorthodoxie sprechen? Weil die soziale und religiöse Ausgestaltung des Judentums im 19. Jahrhundert den jungen Hirsch zwang, sich mit Überzeugungen zu wappnen, um sich einen Weg zwischen den Anhängern einer reinen, einfachen Zurückweisung der Tradition und denjenigen zu bahnen, die der Sohn des Rabbiners Bernays, der berühmte Bonner Philologe Jacob Bernays (1824–1881), die „Stereodoxen“ nannte. Mit einem Wort: Hirsch verstand es, das Judentum wieder auf den neuesten Stand zu bringen und dabei das wahre Wesen der Religion seiner Ahnen zu bewahren. Er selbst formulierte dies mit einem französischen Wortspiel: „Nicht la foi, sondern la loi ist das Wesen des Judentums.“ (Nicht der Glaube, sondern das Gesetz). Um ein guter Jude zu sein, genügt es in den Augen Hirschs nicht, an den einen Gott zu glauben, sondern man muss auch und vor allem die göttlichen Gebote erfüllen. Dies ist wohl die zentrale Linie seines Denkens, die vor allem anderen eine Form der Orthopraxie bevorzugte, also die richtige religiöse Praxis, wie er sie selbst vorlebte: getreu der Halacha, sorgfältig im Kontinuum der jüdischen Tradition, die sich um einen dreifachen, untrennbaren Kern herum kristallisiert: den Gott Israels, das Land Israel und die Sprache Israels.
Das Werk von Samson-Raphael Hirsch hatte vor allem zum Ziel, der religiösen Praxis ein intellektuelles Substrat beizusteuern, statt den umgekehrten Weg zu gehen: Zunächst tat er das durch die Neunzehn Briefe über Judentum, 1836 in Altona erschienen, dann ab dem folgenden Jahr durch eine Art aktualisierter Kompilation des religiösen Gesetzbuches (Schulhan Aruch, auf Deutsch Der gedeckte Tisch), die den Titel Horeb – Versuche über Jisroels Pflichten in der Zerstreuung trägt; außerdem schrieb er Kommentare zu den Psalmen, zum Gebetbuch und zu weiteren biblischen Büchern.
Wie alle Errichter und Begründer von Denkschulen hatte auch Hirsch sein Programm in seinem Jugendwerk Neunzehn Briefe über Judentum dargelegt. Diese Schrift verstand sich als Plädoyer und Manifest, in dem der Autor versucht, Antworten auf Fragen zu geben, die ein junger, an allem zweifelnder Jude stellt.
Die Neunzehn Briefe sind gleichermaßen eine Antwort auf einen berühmten Philosophen, der seit einem halben Jahrhundert tot ist. Denn 1783, als er nur noch drei Jahre zu leben hatte, veröffentlichte Moses Mendelssohn das Buch mit dem vielsagenden Titel Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum. Darin legte er seine Auffassung eines aufgeklärten Judentums dar, das mit sich selbst im Reinen ist und seiner Ansicht nach mit den Idealen der Aufklärung übereinstimmt. Tatsächlich ist es ein Exposé ad extra, für ein europäisches Publikum bestimmt, während die Neunzehn Briefe sich als Plädoyer pro domo verstehen, als Versuch, eine ziemlich dejudaisierte Gemeinde wieder in ihren Schoß zurückzuführen und in der Tradition der Vorfahren zu verankern. Zwischen den Erscheinungsdaten dieser beiden Werke liegen dreiundvierzig Jahre, im Verlauf derer die Tradition mehr und mehr an Boden verloren hatte. Der Grund dafür lag in einer tiefen Krise der rabbinischen Autorität.
Hirsch unternimmt damit die Aufgabe einer Art Reconquista; die großen Momente seiner beruflichen Laufbahn erinnern gelegentlich an Leo Baeck, der ebenfalls in einer sehr kleinen Gemeinde anfing, bevor er in Frankfurt am Main Zugang zur großen Welt bekam. In seinen ersten Anstellungen als Rabbiner in Nikolsburg und Oldenburg ist Hirsch alles andere als überbeschäftigt und betreibt in seiner Freizeit sorgfältige Studien, genau wie Baeck, der die erste Fassung des Werkes Wesen des Judentums 1905 in der Kleinstadt Oppeln verfasste. Die Gemeinden, die in der Obhut von Hirsch lagen, taten sich weder durch intellektuelle Ambitionen noch durch überbordende spirituelle Suche hervor. Hirsch verwaltet die täglichen religiösen Pflichten seiner Gemeinde, sieht sich aber mit fürchterlichen Talmudisten konfrontiert, die in ihm eine Art modernistischen Rabbiner wittern, der seine wahre Natur nicht zeigen will.
1851, nach zehn Jahren mühevollem Leidensweg, kommt endlich die Stunde der Befreiung: Eine kleine Gemeinde in Frankfurt am Main, die den Wunsch hat, sich gegenüber einer den Idealen des Liberalismus und der Reform anhängenden Umgebung anders zu positionieren5, entschließt sich, einen Rabbiner zu berufen, der zwar noch sehr jung ist, aber schon viele Nachkommen hat, und von dem man weiß, dass er dieselben Ideale vertritt wie sie selbst. In Frankfurt wird Hirsch sein gesamtes Potential verwirklichen: Er konsolidiert seine Gemeinde, die sichtlich wächst, stattet sie mit einer wöchentlichen Zeitschrift aus (Jeschurun), die in alle Haushalte der Provinz geschickt wird, die sie bestellen, entlockt den zivilen Behörden ein eigenes Statut einer religiösen Gemeinschaft, vervielfacht die Menge der Predigten in blumiger deutscher Sprache, die seinen Schüler, den jungen Historiker Heinrich Grätz, berührt und anzieht. Dieser Heinrich Grätz wurde von Hirsch aufgenommen und wie sein eigener Sohn behandelt, beging aber den Fehler, eine zu kritische Darstellung der Genese des jüdischen Glaubens zu verfassen …
Hirsch war wohl weder der am tiefsten gehende Denker noch der repräsentativste Vertreter der jüdisch-deutschen Orthodoxie des 19. Jahrhunderts. Doch es war sein großes Verdienst, die Erwartungen derjenigen Juden herauszukristallisieren, die der Tradition am engsten verbunden waren. Die Symbolik, auf die er in seinem Bibelkommentar überreichlich zurückgreift, zeigt jedoch auch seine Grenzen. Sicherlich schrieb er in Horeb – Versuche über Jisroels Pflichten in der Zerstreuung Sätze, die seine Leser sehr beeindruckten: Die schönste Blüte der Wissenschaft, pflegte er zu sagen, sei nichts anderes als das Leben. Er verstand es, das Vorgehen der Wissenschaft des Judentums zu brandmarken – in seinen Augen hatte sie zu einer „Mumifizierung“ des Judentums geführt. Er ging so weit, zu schreiben: „Die Anhänger dieser Strömung betreiben die pathologische Anatomie eines verreckenden Judentums.“ Die historischen Analysen versuchten seiner Ansicht nach nichts anderes, als die Erinnerung an das Judentum in den Handbüchern zu bewahren.
Den biblischen Text aus sich selbst heraus erläutern, also ausschließlich auf die Thora zugreifen, um die Thora zu erläutern und zu verstehen, so lautet das grundlegende Theorem von Hirsch in seinem Bibelkommentar. Ein solches Prinzip bietet viele Vorteile, darunter den nicht unwichtigen, alles zu vermeiden, was der Tradition widersprechen könnte. Bei einer derartigen Forschung spielen die Philologie, die vergleichende und die historische Wissenschaft im Allgemeinen keine bedeutende Rolle. Erklärtes Ziel war vielmehr, „die ewigen und unwandelbaren Normen des jüdischen Lebens zu gründen“. Hirsch betrachtete die hebräische Bibel nicht als Buch, welches ein – vollendetes – Epos eines Zeugnis ablegenden Volkes schildert. Ganz im Gegenteil vertrat er die Ansicht, dass das jüdische Volk auch und vor allem eine Zukunft als „Träger der Hoffnung der ganzen Menschheit“ habe. Daher könne sich das Christentum nicht als Erbe des Judentums betrachten: Denn man könne nichts von einer Person erben, die noch lebendig sei! Diese Bemerkung ist unabdingbar, um das Ziel von Hirsch in seinem Kommentar zu begreifen: Es geht nicht darum, in der Thora notwendigerweise abstrakte philosophische Vorstellungen zu entdecken, um ein Gegengewicht zum Einfluss der zeitgenössischen Ideologien zu schaffen. Seiner Ansicht nach kann die Thora sich mit Bezug auf sich selbst definieren, in sich selbst die Legitimation für ihre Existenz und ihren Daseinsgrund finden. Daher müsse eine behauptete Überlegenheit des Christentums in Bezug auf das Judentum von vornherein als hinfällig bezeichnet werden.
Abraham Geiger, ehemaliger befreundeter Kommilitone von Hirsch an der Universität Bonn, doch dessen eingeschworener Feind auf dem Gebiet des Gemeindelebens, hatte eine Formel geprägt, der es nicht an Provokation fehlte: „Das Christentum ist nicht modern und die Moderne ist nicht christlich …“ So weit zum Zustand der Beziehungen zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, werden sich die Dinge mit Leo Baeck verändern.
Um sich von der Gedankenwelt Hirschs eine Vorstellung zu machen, werfen wir einen kurzen Blick auf seinen Kommentar des Pentateuchs. Die ersten Zeilen der Arbeit behandeln den Bericht von der Erschaffung der Welt und vom Aufenthalt im Paradies. Schon hier gibt Hirsch einen Überblick über das, was er die „phonetischen Verwandtschaften der hebräischen Sprache“ nennt. Der hebräische Begriff be-reschit enthält mit Sicherheit die Wurzel R-‘-SCH, die Hirsch mit zwei anderen Begriffen assoziiert, die fast gleich klingen, aber etwas ganz anderes bezeichnen, nämlich R-H-SCH und R-‘-SCH (Bewegung, Weg, Geräusch): Man sieht hier, dass die Vielfältigkeit und der innovative Charakter dieser Methode an ihre Grenzen kommen. Der Kommentator schlägt vor, den ja sehr strittigen ersten Vers der Genesis folgendermaßen zu übersetzen: „Am Anfang jedes Werdens, Gott war es, der da schuf.“ Er umging also die unlösbaren Probleme der Schöpfung in der Zeit, womit die gesamte jüdisch-philosophische Tradition des Mittelalters konfrontiert gewesen war, und wollte in dem Begriff be-reschit die Vorstellung eines absoluten Anfangs sehen, also den Beginn einer Zeit. Außerdem versucht er, in diesem Begriff die unendliche Vervollkommnungsfähigkeit des Universums und des Menschen zu entdecken. Er nimmt den Optimismus der jüdischen Tradition in Bezug auf die Schöpfung wieder auf: Der Mensch kann und soll sich harmonisch in einer Welt entwickeln, in der er berufen ist, glücklich zu sein. Hirsch zieht großen Nutzen aus den philosophischen und exegetischen Schriften der großen mittelalterlichen Lehrer, sowohl der rationalen wie der kabbalistischen. Doch der Verlauf seiner Argumentation stockt ein wenig beim göttlichen Willen, den er als absolut ansieht, als vollkommen autonom und losgelöst von jeglicher Einmischung, auch seitens der Weisheit eines Schöpfers. Mit anderen Worten: Gott vermag und will alles.
Im Wissen um die mühevollen Abhandlungen eines Maimonides über die notwendige Kongruenz der Weisheit und des Willens in Gott („Der göttliche Wille ist weise, daher wüsste er nichts zu wollen, was seine Weisheit verbietet oder für unmöglich erklärt.“) möchte Hirsch diese Klippe vermeiden und spricht von „einem absolut freien, allmächtigen und unwiderstehlichen Gotteswillen“.
Welchen Eindruck hat man von diesen exegetischen Beispielen? Die Aufklärung stellte für Samson-Raphael Hirsch kein nachahmenswertes Beispiel dar. Das so genannte aufgeklärte Judentum war für ihn nicht attraktiv. Auch wenn er nicht der einzige Vertreter der Orthodoxie im Deutschland des 19. Jahrhunderts war, so hat Hirsch doch großen Einfluss auf seine Zeitgenossen ausgeübt und die Ausbreitung der Reformbewegung, die sich von der Aufklärung leiten ließ, weitgehend eingedämmt.