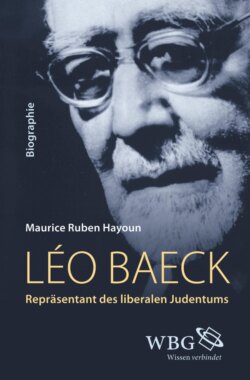Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Vater von Leo Baeck: Samuel Baeck (1834–1912)
ОглавлениеWenn man die familiäre Abstammung von Leo Baeck untersucht, stellt man fest, dass er sowohl von väterlicher als auch von mütterlicher Seite her aus angesehenen Rabbinerfamilien stammt. Ein solcher Stammbaum ist nicht ungewöhnlich, weil die Rabbinerfamilien eine gewisse Endogamie bevorzugten. Wie ihr Mann, so war auch Eva Baeck (1840–1926), geborene Placzek, das Kind eines Rabbiners, des großen Rabbiners von Mähren, Abraham Placzek. Der Weg des jungen Leo war damit fast schon vorbestimmt: Sein Urgroßvater väterlicherseits war Rabbiner von Holitsch in Ungarn gewesen, sein Großvater Nathan Baeck Rabbiner von Kromau in Mähren.
Was brachte den jungen Rabbinerschüler Leo Baeck dazu, plötzlich seine religiöse Ausrichtung zu ändern und zum Vorreiter einer, wenn auch gemäßigten, so doch gut belegten liberalen Richtung zu werden? Ob man es zugeben will oder nicht, diese Veränderung stellt einen Bruch mit dem väterlichen Vorbild und einer ganzen Reihe rabbinischer Vorfahren dar, die bis auf das Ende des 18. Jahrhunderts zurückgeht. Man könnte hierin die Widerspiegelung einer allgemeinen Entwicklung sehen, die das deutsche Judentum dieser Zeit insgesamt betraf: das langsame, aber unaufhaltsame Hinübergleiten zu Liberalismus und Reform. Dabei wurde Leo in einem strikt orthodoxen Milieu geboren und erzogen, und so begann er, indem er in die Fußstapfen seines Vaters trat, bevor er später ein wenig davon abwich.
Sein Vater Samuel wurde 1834 in Borkowitz/Mähren geboren, einer Region, die im 19. Jahrhundert als uneinnehmbare Festung der jüdischen Orthodoxie galt und vom Geist der Aufklärung verschont geblieben war. Die Haskala konnte sich nur sehr zögerlich verbreiten, so heftig war der Widerstand der konservativen Milieus. Doch die familiäre Verwurzelung in der Rabbinertradition hielt ihn in keiner Weise davon ab, sich eine solide weltliche Kultur anzueignen. Der Berufsweg des Vaters zeigt in gewisser Weise den des Sohnes bereits an: Im städtischen Gymnasium von Kromau ausgebildet, machte er 1853 in Preßburg sein Abitur. Parallel zu dieser allgemeinen Schulbildung durchlief der zukünftige Rabbiner den vollständigen Zyklus der Talmudstudien in der Jeschiwa von Nikolsburg (wo Samuel-Raphael Hirsch seine erste Anstellung als Rabbiner hatte) und an der Jeschiwa von Pressburg, deren unbestrittener Leiter Moses Sofer bis zu seinem Tod 1839 war.
Bis hierher gibt es keine besonderen Auffälligkeiten, abgesehen davon, dass Samuel Baeck anschließend nach Wien geschickt wurde, um orientalische Studien zu betreiben. Er schrieb sich auch für Philosophie und Geschichte ein. 1856 verteidigte er in Leipzig eine Doktorarbeit zum Thema Die Kultur der alten Hindus verglichen mit der Kultur der Hebräer. Nach seiner Rückkehr nach Mähren erhielt er eine erste Rabbineranstellung in Leipa, die ihm von dem Rabbiner bewilligt wurde, der niemand anderes als sein Schwiegervater war. 1864 wurde er zum Rabbiner von Lissa ernannt, wo er ein halbes Jahrhundert, bis zu seinem Tod 1912, seinen Dienst versah.
Der Rabbiner Samuel Baeck ebnete seinem Sohn den Weg, indem er sich im Leben der Stadt engagierte und mit dem begann, was man heute interreligiösen Dialog nennt. Er war ein echter Wegbereiter der jüdisch-christlichen Annäherung. Samuel wurde Mitglied des Verwaltungsrats des städtischen Gymnasiums und zahlreicher karitativer Vereinigungen, darunter der Vereinigung für die Waisen. Sein politischer Einfluss und sein Ruf als großer Pädagoge erlaubten es ihm, den Unterricht der jüdischen Religion in den preußischen Gymnasien einzuführen.
Auch als ins Stadtleben eingebundener Rabbi vernachlässigte Samuel seine Forschungsarbeiten nicht, wie zahlreiche Veröffentlichungen belegen. Nach seiner Doktorarbeit lieferte er Beiträge zu den berühmten Handbüchern, die August Winter und Jakob Wünsche herausgaben und die eine Art „Lagarde & Michard“ der jüdischen zeitgenössischen Literatur darstellten: Er besorgte eine Auslese hebräischer Texte aus der Zeit der jüdischen Antike bis in die ersten christlichen Jahrhunderte hinein, und zwar in kommentierter deutscher Übersetzung. 1875, als Leo knapp zwei Jahre alt war, veröffentlichte Samuel ein Werk über die Erzählungen und religiösen Prinzipien der Bibel, ein Buch, das 1886 erneut aufgelegt wurde. Etwas später verfasste er eine Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur vom babylonischen Exil bis auf die Gegenwart, womit er ein weitschweifiges Fresko lieferte, das damals in Deutschland als Gattung so beliebt war. Dieses Werk wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Frankfurt am Main noch einmal, in dritter Auflage, veröffentlicht.
Eine solche gleichzeitig pastorale wie wissenschaftliche Tätigkeit erregte die Aufmerksamkeit der preußischen Behörden, die den Rabbiner 1903 mit dem Roten Adlerorden auszeichneten.
Eine Ähnlichkeit im beruflichen Werdegang von Vater und Sohn ist zweifellos vorhanden, wobei Leo seinen Vater übertraf; dieser begnügte sich ein halbes Jahrhundert mit der Stellung eines kleinen Provinzrabbiners, während der Sohn sich aufmachte, die großen deutschen Metropolen Düsseldorf und Berlin zu erobern. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als er den Ruf eines bedeutenden geistlichen Widerständlers hatte, der bei seiner von den Nationalsozialisten verfolgten Gemeinde blieb, sollte er vom Kongress der Vereinigten Staaten stehende Ovationen erhalten.
Doch auch die Verdienste von Samuel Baeck sind unbestreitbar: Mit besonderer Sorgfalt kümmerte er sich um die Erziehung aller seiner Kinder und besonders Leos. Elf Geschwister gab es in der Familie, sechs Jungen und fünf Mädchen. Leo erinnerte sich immer tief bewegt an seinen Vater. Ernst Akiba Simon, eine bedeutende Persönlichkeit des deutschen Judentums zu dieser Zeit, bestätigte, dass Samuel den Tag mit dem Gebet beginne. Danach studiere er eine Seite des Talmuds und schließlich lese er einen ganzen Akt eines griechischen Tragödien- oder Theaterschriftstellers im Original.
So wie Samuel seine Schulzeit im Gymnasium von Kromau verbrachte, besuchte Leo das Johann-Amos-Comenius-Gymnasium in Lissa, seiner Geburtsstadt.