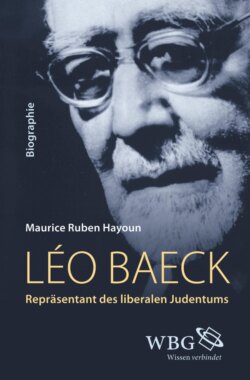Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die verschiedenen orthodoxen, historischen und Reformströmungen des deutschen Judentums
ОглавлениеHirsch hatte einen Schüler, der sich ihm entgegensetzte, nachdem er ihm zuvor geschmeichelt hatte. Es geht um Heinrich Grätz, den Gründervater der modernen jüdischen Historiographie, der sich in einen unversöhnlichen Kritiker der Neuorthodoxie seines alten Lehrers verwandelte. Die Geschichtsschreibung ist bei jeglicher Identitätssuche ein besonders sensibler Bereich, den die beiden Männer, der Lehrer und der ehemalige Schüler, unterschiedlich angingen. Grätz war der Autor eines programmatischen Diskurses, der 1845 unter dem provokativen Titel Construction der jüdischen Geschichte veröffentlicht wurde. Dieser junge Mann, noch keine dreißig Jahre alt, lässt uns über zweieinhalbtausend Jahre der jüdischen intellektuellen Geschichte im Sturmschritt durchlaufen, und als guter deutscher Jude, der er war, ging er bei seinen Untersuchungen bis zu Mendelssohn, der 1786 gestorben war. Bei der Geburt von Grätz waren seit dem Tod des großen Philosophen gerade einmal drei Jahrzehnte vergangen. Sicherlich gab es vor Grätz andere jüdisch-deutsche Historiker, wie zum Beispiel Isaak Markus Jost, doch niemand war zu einem solchen Grad der Gelehrsamkeit gelangt, auch wenn manche seiner Werturteile in der Folge bestritten werden sollten. Grätz starb 1891 in München, nachdem er ein solide gezimmertes jüdisches Bewusstsein wieder auf die Beine gestellt hatte. Es gab eine heftige Kontroverse zwischen ihm und dem Nationalhistoriker Heinrich von Treitschke: Niemand kam Grätz zu Hilfe, nicht einmal einer seiner Glaubensbrüder, so sehr waren sie durch den offenkundigen Antisemitismus gelähmt, der das Universitätsleben belastete. Lediglich der große Spezialist für das antike Rom, Theodor Mommsen, handelte nach den Begriffen von Ehre und Wahrheit, indem er Grätz verteidigte und öffentlich für ihn Partei ergriff.
In gewisser Weise hat der heftige Streit zwischen Hirsch und seinem früheren Schüler Grätz einen paradigmatischen Wert. Er zeigt die Spannungen in den verschiedenen jüdischen Gemeinden, die sich unerbittlich hin zu Liberalismus und Reform entwickelten. Der bereits genannte Abraham Geiger, Autor einer durch die akademischen Autoritäten gelobten Arbeit über Mohammed und das Judentum, sollte der führende Kopf der deutschen Liberalen und Reformer werden.
Was im Leben und Werk Geigers am meisten auffällt, ist sein Wille, die Wissenschaft in den Dienst des Lebens zu stellen, mit anderen Worten: die jüdische Religion aus den Früchten der Wissenschaft des Judentums Nutzen ziehen zu lassen. Dies ist das Prinzip, das das gesamte Denken und Leben eines Mannes durchzieht, der unaufhörlich für die Vorstellung, die er sich von seiner Religion machte, tätig war. Die jüdische und die nichtjüdische Historiographie haben von ihm nichts behalten außer Streitigkeiten und Polemiken, in die er sich einbrachte, ohne sich aber mit dem wirklich nutzbringenden Beitrag dieses weisen Rabbiners näher zu beschäftigen.
Am 24. Mai 1810 in einer orthodoxen Familie in Frankfurt am Main geboren, verlor der junge Geiger seinen Vater Michael Lazarus, als er dreizehn Jahre alt war. Es war sein achtzehnjähriger Halbbruder Salomon, der sich um seine Ausbildung kümmerte, ohne ihm je seine eigene Auffassung vom Judentum aufzwingen zu wollen. Salomon war orthodoxer Jude, der die biblischen Vorschriften peinlich genau befolgte und jeder reformatorischen Anwandlung feindlich gegenüberstand. Er lebte bis 1878 und überlebte damit seinen jüngeren Bruder, der 1872 starb, verhehlte aber niemals seinen Stolz auf ihn, einen Gelehrten, dessen Ausführungen er in keiner Weise teilte. Unter Salomons Leitung machte sich der junge, talentierte Abraham mit Bibel und Talmud vollständig vertraut. Mit neunzehn Jahren gelang es ihm, sich an der Universität von Heidelberg einzuschreiben, wo das Studium der orientalischen Sprachen und der Philosophie einen tiefen Eindruck bei ihm hinterließ. In Heidelberg machte er Bekanntschaft mit anderen jüdischen Studenten, die parallel zu ihren Universitätsstudien darüber nachdachten, Rabbiner zu werden: Gemeinsam studierten sie die traditionellen Texte. Zu diesem Kreis gehörte auch Berthold Auerbach, der eine Zeit lang den Beruf des Rabbiners ergreifen wollte, bevor er seiner Berufung als Dichter und Schriftsteller folgte. Nach einem kurzen Sommersemester verließ Geiger Heidelberg wieder und ging nach Bonn. Dort beschränkte er sich nicht auf die Disziplinen, die er schon studierte, sondern fügte ihnen noch die klassische Philologie, die Astronomie und sogar die Zoologie hinzu. Die Geisteswissenschaften aber blieben sein Hauptinteresse. Seine fortwährende Lektüre der Werke Lessings, Schillers und Goethes stärkten sein historisches Bewusstsein. Er war davon überzeugt, dass die Entdeckung eines wahrhaft historischen Judentums sämtliche in der Religion Israels anzutreffenden Missstände beenden würde. Dies vertraute er seinem geschätzten Freund Joseph Naphtali Deremburg an, der nach Paris emigriert war und dort einen Lehrstuhl an der École Pratique des Hautes Études erhielt, und außerdem Zunz, der bereits als Gründervater der Wissenschaft des Judentums galt. Als er 1833 seinen Doktortitel in der Tasche hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als eine Anstellung als Rabbiner zu finden: Da er in Frankfurt großen Erfolg hatte, machte die Nachbarstadt Wiesbaden ihm ein Angebot. So wurde Geiger ein Herr Rabbiner Doktor, einer derjenigen, die damals die Gemeinden in Deutschland bevölkerten. Doch seine überbordende Energie und seine Ambitionen für das Judentum seiner Zeit konnten sich mit einer solchen Stellung nicht zufriedengeben. 1838 reichte er seinen Rücktritt ein, nachdem er 1835 seine Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie gegründet hatte – und außerdem lange über die Möglichkeit nachgedacht hatte, in Heidelberg oder Marburg eine Fakultät für jüdische Theologie einzurichten. Doch 1837 gab es in Wiesbaden ein Ereignis mit schwerwiegenden Folgen: Der junge Geiger – erst 25 Jahre alt – hatte eine Art Rabbinerkonferenz einberufen, an der vierzehn seiner Kollegen tatsächlich teilnahmen. Doch die Ergebnisse des Treffens waren gleich null. Geiger begriff, dass seine Vorstellungen noch keinen Widerhall fanden.
1838 machte sich die große orthodoxe Gemeinde von Breslau auf die Suche nach einem rabbinischen Gelehrten, und Geiger beschloss, dorthin zu fahren und vor den Vorstandsmitgliedern zu predigen, die ihn trotz vehementer Proteste des alten örtlichen Rabbiners Salomo Abraham Tiktin einstimmig wählten. Unglücklicherweise stellte sich eine starke Opposition aus dem ultraorthodoxen Kern der Gemeinde dem jungen Rabbiner in den Weg, der sich damit abfand, sich der Forschung widmete und zumindest vorübergehend auf die Autorität als Rabbiner verzichtete. Zwischen 1845 und 1855 veröffentlichte Geiger zahlreiche Werke. Einige Jahre vor seinem Tod endlich durfte er in Berlin eine Rabbiner-Hochschule leiten. Er starb 1872, drei Jahre vor der Geburt Leo Baecks, der – nach vielversprechenden Anfängen im orthodoxen Seminar von Breslau – seine Rabbinerstudien im Institut Geigers in Berlin vollenden sollte.