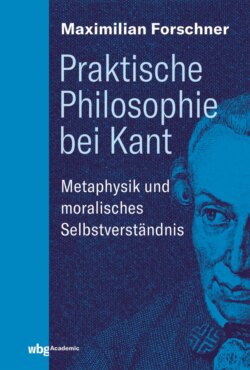Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kritik, Transzendentalphilosophie, Metaphysik
ОглавлениеKant hat 1781 und 1787 jeweils eine Vorrede und eine Einleitung an den Anfang seines epochemachenden Werkes Kritik der reinen Vernunft gestellt. Wie die Vorreden, so sind auch die Einleitungen der Auflage A und der Auflage B erheblich voneinander verschieden. Der Unterschied zeigt sich im Umfang: Die Einleitung B ist doppelt so lang wie die Einleitung A. Der Unterschied zeigt sich in den Überschriften, mit denen die Texte strukturiert sind und ihren Inhalt signalisieren: Die Einleitung A exponiert die Idee und die Einteilung der Transzendentalphilosophie, die Einleitung B entwickelt, wie die Überschrift ihres Abschnitts VII zeigt, »die Idee und Einteilung einer besonderen Wissenschaft unter dem Namen einer Kritik der reinen Vernunft«. Der heutige Leser mag sich fragen, ob mit den Titeln »Transzendentalphilosophie« und »Kritik der reinen Vernunft« dasselbe oder Verschiedenes gemeint ist, und wenn Verschiedenes, wie das eine sich zum anderen verhalten mag. Tatsächlich enthalten die beiden Einleitungen bezüglich der Begriffe »Kritik« und »Transzendentalphilosophie« keine nennenswerten Differenzen. Unter »Transzendentalphilosophie« versteht Kant in Einleitung A und B »das System aller Prinzipien der reinen Vernunft«,4 und die »Kritik« soll die Propädeutik hierzu sein, nämlich die Entwicklung der vollständigen Idee bzw. des gesamten Planes dieser Transzendentalphilosophie, ohne dass der Plan bereits gänzlich ausgeführt würde. Kant wollte, wie er in der Vorrede zur zweiten Auflage klarstellt, mit seinen Änderungen im Ganzen ohnehin nur gewisse Dunkelheiten in der Darstellungsweise der ersten Auflage beheben.5
Zwischen der Auflage A und der Auflage B der KrV liegt die Veröffentlichung von Schriften, die zum Verständnis dessen beitragen, was Kant in der Auflage B gegenüber jener von A klargestellt sehen möchte. 1783 hatte Kant die Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik zum besseren Verständnis des Kernanliegens und der Grundzüge der KrV nachgereicht. 1785 kommt die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten heraus. Und 1786 legt Kant die Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft vor. Damit scheint eingelöst zu sein, was Kant bereits vor mehr als 20 Jahren dem Kollegen Lambert als in Bälde erfolgend in Aussicht gestellt hatte. In der Vorbereitung der zweiten Auflage der KrV arbeitet Kant daran, das in der ersten Auflage in der transzendentalen Methodenlehre über Freiheit, Gott und Sittlichkeit Gesagte im Sinne einer gegenüber der Kritik der reinen theoretischen Vernunft gleichgewichtigen und sachlich hinreichenden Kritik der reinen praktischen Vernunft auszudifferenzieren. Am 21. November 1786 erschien in der »Jenaer Allgemeinen Literaturzeitung« (Nr. 276) der (wohl von Kant selbst stammende) Hinweis, dass
»zu der in der ersten Auflage enthaltenen Kritik der spekulativen Vernunft in der zweiten Auflage noch eine Kritik der reinen praktischen Vernunft hinzukommen [wird], die dann ebenso das Prinzip der Sittlichkeit wider die gemachten oder noch zu machenden Einwürfe zu sichern und das Ganze der kritischen Untersuchungen, die vor dem System der Philosophie der reinen Vernunft vorhergehen müssen, zu vollenden, dienen kann«.6
Diese Kritik der reinen praktischen Vernunft ist Kant wohl in der Vorbereitung der zweiten Auflage dem Umfang nach aus den Fugen geraten. Die zweite Auflage der KrV erscheint im Frühjahr 1787 deshalb ohne sie. Die neue Vorrede ist »im Aprilmonat 1787« datiert;7 sie enthält den eindeutigen Hinweis: »Bis hierher (nämlich nur bis zu Ende des ersten Hauptstücks der transzendentalen Dialektik) und weiter nicht erstrecken sich meine Abänderungen der Darstellungsart«.8 Ende Juni desselben Jahres schreibt Kant an Christian Gottfried Schütz, den Herausgeber der Allgemeinen Literaturzeitung: »Ich habe meine Kritik der praktischen Vernunft so weit fertig, dass ich sie denke künftige Woche nach Halle zum Druck zu geben.«9 Die KpV ist demnach ganz offensichtlich als Bestandteil der Kritik der reinen Vernunft gedacht und im Zusammenhang von deren Überarbeitung zur 2. Auflage entstanden.10
Kant hat, wie gesagt, von Anfang an die »Kritik der reinen Vernunft« als Entwicklung des gesamten Plans der Transzendentalphilosophie vom »System der Philosophie der reinen Vernunft« als vollständig ausgeführtem Plan der Transzendentalphilosophie klar und deutlich unterschieden sehen wollen. Was nicht so klar ist, und auch in der Kantliteratur nicht immer klar in Erscheinung tritt, ist dagegen Kants Unterscheidung von »Transzendentalphilosophie« und (kritischer) »Metaphysik«.
Kant hat nach der Kritik dem Publikum ein transzendentalphilosophisches System sowohl der spekulativen als auch der praktischen Weltweisheit vorzulegen in Aussicht gestellt.11 Bereits in der Vorrede zur 1. Auflage der KrV schreibt er: »Ein solches System der reinen (spekulativen) Vernunft hoffe ich unter dem Titel: Metaphysik der Natur, selbst zu liefern.«12 Geliefert hat Kant allerdings nur noch die Metaphysik der Sitten. Die Metaphysik der Natur, zu der er 1786 die Metaphysischen Anfangsgründe publizierte, blieb Projekt.13
Die naturphilosophische Grundlegungsschrift von 1786 belegt Kants eindrucksvollen Versuch, »den Bereich apriorischer Grundsätze der Physik noch über das in der Kritik der reinen Vernunft Gesagte hinaus zu erweitern und näher zu bestimmen«.14 Worin diese Erweiterung und nähere Bestimmung im Wesentlichen besteht, macht eine von vielen überlesene Unterscheidung deutlich, die sich in der Einleitung B am Ende des ersten Abschnitts findet:
»Von den Erkenntnissen a priori heißen aber diejenigen rein, denen gar nichts Empirisches beigemischt ist. So ist z. B. der Satz: eine jede Veränderung hat ihre Ursache, ein Satz a priori, allein nicht rein, weil Veränderung ein Begriff ist, der nur aus der Erfahrung gezogen werden kann.«15
Kant unterscheidet also reine synthetische Urteile a priori von nichtreinen synthetischen Urteilen a priori.16 Reine synthetische Urteile a priori enthalten ausschließlich apriorische Begriffe. In nichtreinen synthetischen Urteilen a priori sind auch Begriffe im Spiel, die »nur aus der Erfahrung gezogen werden können«. Was Kant an kritischer materialer Metaphysik entwickeln wird, als Metaphysik der Natur und als Metaphysik der Sitten, hat ganz wesentlich mit nichtreinen synthetischen Urteilen a priori zu tun, in denen elementare Erfahrungsbegriffe, mit denen wir die Natur und den Menschen beschreiben, in Sätze eingehen, die einen Geltungsanspruch erheben, der nicht empirisch begründbar ist.
Unter »Transzendentalphilosophie« will Kant dagegen eine Wissenschaft verstanden wissen, die lediglich aus analytischen und reinen synthetischen Urteilen a priori besteht, eine Wissenschaft, in die »gar keine Begriffe hineinkommen müssen, die irgendetwas Empirisches enthalten«.17 Doch mit diesem Hinweis zur Unterscheidung von Transzendentalphilosophie und (kritischer) Metaphysik habe ich schon etwas vorgegriffen. Kommen wir auf die einführende Erläuterung von Kants philosophischem Grundanliegen zurück.