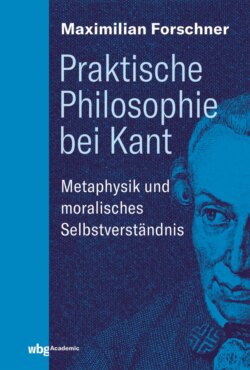Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Die Verheißung der Vernunft
ОглавлениеReligion, so wie Kant sie in den Reflexionen ihrem Begriff und ihrer Funktion nach erstmals bestimmt, ist ausschließlich Vernunftreligion, das ist eine Religion, die ganz und gar aus einem vernunftgeleiteten Selbst- und Weltverständnis entwickelt wird und zur Stützung eines derartigen Selbst- und Weltverständnisses gedacht ist.
Ausgangspunkt ist einmal die an der Idee der Gerechtigkeit orientierte Vernunft-Prämisse einer notwendigen Verbindung von Wohlverhalten und Wohlbefinden, einer Verbindung, die die erfahrbare Natur der Dinge und Menschenwelt nicht bietet, und die zu bewirken die Kräfte des Menschen übersteigt.190 Werden die Prinzipien und Richtlinien des Wohlverhaltens nicht den empirischen Bedingungen des Wohlbefindens nachgeordnet und angepasst, sondern in Form des Primats einer moralisch verstandenen Tugendforderung aufrechterhalten, dann führt dies von selbst zur Eröffnung der Vernunftperspektive des Ideals einer »anderen« Welt. »Die andere (intellektuale) Welt ist eigentlich die, wo Glückseligkeit genau mit der Sittlichkeit zusammenstimmt: Himmel und Hölle […]. Die andere Welt ist ein notwendig moralisches Ideal.«191
Ausgangspunkt ist zum Zweiten der Gedanke, dass der Mensch der Glückseligkeit bedürftig ist und bleibt, dass er als vernünftiges Wesen sein Streben nach Glück zwar der Bedingung der Glückwürdigkeit unterstellen muss und kann, dass er aber als endliches, bedürftiges, sinnliches Vernunftwesen sein Verlangen nach Glück nicht dem Bewusstsein bloßer Glückswürdigkeit aufzuopfern oder mit diesem selbst zu befriedigen vermag. Denn, so Kant nach zähem Ringen mit den »Systemata der Alten« vergleichsweise kategorisch: »[V]on der bloß moralischen Glückseligkeit oder der Seligkeit verstehen wir nichts.«192
Gewiss: »Das Prinzip der Selbstliebe ist zwar das allgemeine subjektive der Triebfedern, aber nicht der Beurteilung der Handlungen und ihres objektiven Werts.«193 Aber es ist eben doch subjektiv-allgemein, das heißt an die Natur des Menschen unlöslich gebunden und als wesentliche subjektive Motivationsquelle in all seinem Handeln im Spiel. Objektive Beurteilungs- und Beweggründe und subjektive Triebfedern bzw. Motive des Handelns gilt es genau zu unterscheiden.194 Aber ohne subjektive Triebfedern handelt der Mensch nicht, und diese, so der jetzige Stand kantischer Überlegungen, müssen »alle von der Glückseligkeit […] hergenommen sein«.195 So gesehen dürfen moralische Gebote jedenfalls nicht der Aussicht auf Glückseligkeit Abbruch tun, wenn sie für den Menschen sinnvolle und zumutbare Weisungen sein sollen. Der Mensch kann nicht gegen seine sinnlich-vernünftige Natur handeln und sein Verlangen nach Glück aufgeben.
Dabei gilt es, zwischen selbstsüchtiger, allemal auf den eigenen Vorteil bedachter Eigenliebe und (unverdorbener) Selbstliebe zu unterscheiden.196 Die Eigenliebe ist eine »ausschließende Selbstliebe«; die mit den »motiva auxiliaria« verbundene Selbstliebe ist es gerade nicht. Sie ist mit der Idee des absolut Wertvollen und zuhöchst Guten in Einklang zu bringen.197 Das Gesetz der Moralität verleiht den Bestrebungen der Selbstliebe ein Korsett der Einheit, über die sie von sich aus nicht verfügen. »Aus Selbstneigung entspringen Handlungen, die nicht notwendig Einheit unter sich und andern haben.«198 Das Gesetz, unter das das subjektive Glücksstreben gestellt wird, besagt nun, dass das Streben nach Glück, soll es objektiv vernünftig sein, die Bedingung erfüllen muss, des erstrebten Glückes auch würdig zu sein. »Der Gebrauch der Freiheit, der ein Grund der Glückseligkeit nach einer allgemeinen Regel ist, ist die Würdigkeit glücklich zu sein. Uns liegt es ob, die Glückseligkeit einer Regel zu unterwerfen.«199
Durch die Anwendung des moralischen Gesetzes auf sich und seine bedürftige sinnliche Natur modifiziert sich der natürliche Wunsch nach Glück zum Wunsch, sich des erstrebten Glücks auch würdig zu erweisen. Denn aus der Perspektive unparteilicher Vernunft ist das Glück eines moralitätsfähigen und glücksbedürftigen Wesens nur dann zu billigen, aber nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten auch zu fordern und nach Billigkeitsgesichtspunkten zu erwarten, wenn dieses sein Glück verdient. Umgekehrt wird das moralische Gesetz nur zum subjektiv wirksamen Handlungsmotiv, wenn es sich derart mit dem Streben nach Glück verbindet. »Wodurch werden die sittliche[n] Bedingungen motiva, d. i. worauf beruhet ihre vis movens und also ihre Anwendung aufs Subjekt? Die Letztere[n] sind erstlich das mit der Moralität wesentlich verbundene motivum, nämlich die Würdigkeit, glücklich zu sein.«200 Da »Tugend […] keinen sichern Vorteil bei sich führt: so muss man ihre Bewegungsgründe mit dem Nutzen, den sie schafft, vereinigen«.201 Denn die subjektiven Bedingungen der Ausübung moralischer Gesetze »bestehen in der Übereinstimmung mit unserem Verlangen zur Glückseligkeit«.202 Und dies besagt: Das sittliche Handlungsmotiv der Glückswürdigkeit muss sich mit der subjektiven (plausiblen) Erwartung verbinden, dass Glückswürdigkeit sich tatsächlich als notwendiger und zureichender Grund von Glück erweist, um wirksames Handlungsmotiv des Menschen sein zu können. Ohne solche Erwartung wäre unbedingte Moralität dem Menschen, so wie er ist, nicht zumutbar, die uneingeschränkte Tugendliebe eine Torheit und ein ausgefeilter Epikureismus die vernünftigere Option. In die Stelle der subjektiven Erwartung tritt angesichts einer mangelnden empirischen Stütze Religion als reiner Vernunftglaube, das heißt als von der Vernunft zu Zwecken ihrer Autoritätssicherung unter Menschen gegebene Hoffnung und Verheißung der Wirklichkeit und Verwirklichung des höchsten Guts »in einer anderen Welt«. Ohne diese »Zusage« der Vernunft im Menschen verlöre das moralische Gesetz für ihn die Rechtskraft des unbedingt Verpflichtenden. »Die moralischen Gesetze haben wohl das principium obligandi in sich, aber obligieren nicht ohne Religion, weil sie nicht durch ihre Natur Verheißung der Glückseligkeit bei sich führen.«203
Doch der Verpflichtungscharakter des moralischen Gesetzes dehnt sich damit keineswegs auch auf den Vernunftglauben aus. Die Religion ist weder Grund noch Inhalt einer Pflicht, sondern eine Zusage, eine Verheißung der Vernunft als Gegengewicht gegen die empirisch plausible Furcht des Glücksverlusts, die mit der Einlösung von Pflicht verbunden sein mag. »Die Verheißung obligiert nicht, sie benimmt nur die Ausrede der Selbstliebe, welche ein Recht hat, alles mit seiner Glückseligkeit als einstimmig zu fordern.«204
Kants Argumentation für die (objektiv gültige) »Verheißung der Vernunft« findet sich in einer vergleichsweise ausführlichen Reflexion im Zusammenhang:
»Man nennt Vorliebe […] den Wunsch, sich selbst oder […] andern glücklich zu sehen ohne Beziehung auf das Urteil, ob man dieser Glückseligkeit würdig sei. Wer ohne Vorliebe […] urteilt, urteilt unparteiisch. Unser Wunsch ist jederzeit in Ansehung unserer selbst parteiisch […]. Aber ohnerachtet alles eigenliebigen und unablässigen Wunsches können wir doch das Vernunfturteil nicht unterdrücken, dass zwar die Begierde zur Glückseligkeit natürlich vor dem Wunsche, es [sc. der Glückseligkeit würdig, M. F.] zu sein, vorhergehe, gleichwohl das Letztere vor dem Ersteren in dem Urteil der Vernunft vorhergehen müsse: dass die erste Frage sein muss, ob die Person gut sei, und die zweite nur: ob ihr Zustand gut und glücklich sei. Wir würden eine Welt verachten und eine Regierung der Welt, worin es anders geordnet wäre. Die Würdigkeit glücklich zu sein ist zwar nicht unser unmittelbarer Wunsch, aber die erste und unnachlassliche Kondition, unter welcher die Vernunft ihn billigt. Es scheint aber auch, als wenn die Vernunft uns in diesem Gebot auch etwas verspreche. Nämlich dass man hoffen könne glücklich zu sein, wenn man sich nur so verhält, dass man derselben nicht unwürdig ist. Denn da der ohne Zweifel ein Tor […] sein würde, welcher sich eigensinnig einer Regel unterwürfe, ob er gleich wüsste, dass er seinen Zweck viel besser erreichen würde, wenn er gelegentlich Ausnahmen davon machte: so würde folgen, dass man auch wohl ein Dupe […] der Tugend sein könne: ein unausstehlicher und ungereimter Gedanke.«205
Religion als Vernunftglaube begegnet also der Gefahr, dass der kategorische Anspruch moralisch-praktischer Vernunft sich im Blick auf die Glücksbedürftigkeit des Menschen als absurd erweist. Diese Verheißung und dieser Glaube der Vernunft zur Stützung der Vernünftigkeit ihres eigenen moralischen Anspruchs an den Menschen impliziert das Verständnis moralischer Gesetze als Gebote eines Gottes, dessen Einsicht unbegrenzt, dessen Wille gut und allvermögend ist,206 der als unparteilicher Richter über die Gesinnungen und Anstrengungen der Menschen urteilen und die von der Vernunft verheißene Entsprechung von Glückswürdigkeit und Glück letztendlich herstellen,207 und der schließlich der Unzulänglichkeit des Menschen zur Heiligkeit nach Maßgabe von dessen Anstrengung helfend entgegenkommen wird.208
Es ist dies nach Aussage der Reflexionen ein zuversichtlicher Glaube, der nicht den kategorischen Anspruch moralisch-praktischer Vernunft begründet, sondern der sich aus der Anwendung dieses Anspruchs auf den Menschen in seiner naturgegebenen Verfassung nach Gesichtspunkten unparteilicher Vernunft notwendig ergibt. Es ist dies zum Zweiten ein Glaube, der die Reinheit der Tugendgesinnung nicht aufhebt, sondern nur dazu dient, dem Hindernis der Moralität im Menschen, das in der Furcht vor dem Verlust des Glücks besteht, in Gestalt einer Hoffnung etwas entgegenzusetzen.209 Es ist zum Dritten ein Glaube, der dem Menschen in der Größe seiner moralischen Bestimmung und ebenso in seiner natürlichen Schwäche gerecht wird, der sowohl der Gefahr theoretischer wie praktischer Selbstüberschätzung als auch der Tendenz zur Unlauterkeit und selbstverliebter Nachsicht begegnet. Und es ist schließlich ein rationaler Glaube, der allem Aberglauben und den »unmoralischen Hilfsmitteln der Religionsobservanzen« den Boden entzieht. Andererseits aber auch nur ein Glaube, eine Hoffnung, eine Verheißung, ein Versprechen der Vernunft, keineswegs ein theoretisch gesichertes Wissen.