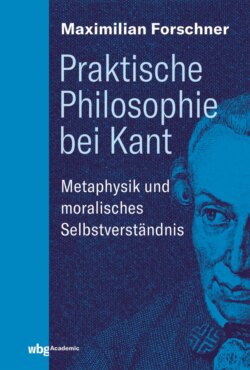Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Das Glück der Selbstzufriedenheit in dieser Welt
Оглавление(A) Kants Weg zu einer »kritischen« Metaphysik der Sitten soll hier über die Reflexionen seines handschriftlichen Nachlasses gefunden werden. Die publizierten Schriften vermitteln uns über ihn kein sonderlich klares Bild. Die Beschäftigung mit Kants handschriftlichem Nachlass ist für das Verständnis (der Entwicklung) seines publizierten Werkes eben deshalb von besonderem Interesse, weil diese Reflexionen, wie zu zeigen sein wird, uns eine Theorie, die wir im Resultat kennen, in entscheidenden Schritten ihres Entstehens präsentieren.1
Gewiss stellen uns Gedanken eines großen philosophischen Autors und Lehrers, die nicht zur Publikation bestimmt waren, vor spezielle Probleme der Interpretation: Sie sind fragmentarisch, vorläufig, mitunter rein hypothetisch, nicht selten vergröbernd, aufs Prinzipielle reduziert, mehr thesenartig als schulgerecht begründet und gelegentlich stark okkasionell, das heißt an einen zufälligen Kontext der täglichen Lehrtätigkeit und Lektüre gebunden. Dabei ist nicht immer sicher entscheidbar, ob ein Satz einen eigenen Gedanken oder lediglich eine notierte Lesefrucht darstellt.
Gleichwohl scheint mir bei einem Philosophen vom Range Kants, dessen veröffentlichtes Werk seiner sogenannten kritischen Phase für die Philosophie in fast all ihren Disziplinen umwälzend und neuorientierend wirkte und sich auch heute noch ungebrochener Autorität erfreut, der Blick in seinen handschriftlichen Nachlass für das Verständnis (der Entwicklung) seines Denkens unverzichtbar. Die Gründe sind folgende: (a) Die Reflexionen zeigen deutlicher Kontinuität, Wenden und Brüche in der Entwicklung seiner Gedanken hin zu einer (vorläufig) abschließenden Position als dies die in teilweise großen Abständen publizierten Schriften tun. (b) In ihren oft ermüdenden Wiederholungen manifestieren sie zum Teil klarer als das publizierte Werk Art, Gewicht und Konstanz der Probleme, um deren Lösung er sich vorrangig bemühte. (c) Ihre meist lapidare Form zeigt Prämissen »nackt«, ohne eine literarische Einkleidung, die den Blick auf das Wesentliche verstellen kann. (d) Sie dokumentieren im Unterschied zu den Veröffentlichungen den Spielraum alternativer Konzepte, die Kant für erwägenswert hielt und zeitweise selbst zu vertreten geneigt war. (e) Sie enthalten im Fall der Prinzipien der Moral ein Konzept, das neben dem publizierten einen eigenständigen Rang besitzt und im Blick auf eine zentrale systematische Problemstellung der Allgemeinen Ethik der eingehenderen Prüfung wert sein dürfte.
Das gemeinte Problem betrifft die Verhältnisbestimmung von Glück und Moralität und spezieller die Frage nach der Motivation moralischen Handelns. Warum moralisch sein wollen? Diese elementare und unabweisbare Frage glaubte die philosophische Ethik von ihren griechischen Anfängen bis in die Neuzeit hinein nur im Rückgang auf das (wahre) Glück des Menschen beantworten zu können. Moralität ist für Glück konstitutiv; und glücklich sein wollen wir selbstverständlich alle. Der »kritische« Kant hat bekanntlich mit diesem »Eudämonismus der Moral« gebrochen. Ethik wird zur philosophischen Sittenlehre; sie verliert durch ihn den primären Charakter einer Theorie menschlichen Glücks und wird vorrangig zu einer Theorie der Moralität bzw. der Pflicht. Seine kritische Metaphysik der Sittlichkeit leitet der Gedanke, dass die Gründe und Normen moralischen Verhaltens und die Gründe und Regeln menschlicher Glückssuche ganz verschiedene, jedenfalls genau zu unterscheidende Dinge sind.
Dieser Unterschied betrifft auch das Hauptmotiv moralischen Handelns. Allein die Vernünftigkeit des moralisch Gebotenen selbst bzw. die Achtung vor dem moralischen Gesetz, ohne Rücksicht auf eigene Glückseligkeit,2 ist, so Kant, wahres Motiv, wenn menschliches Handeln (auch) subjektiv gut sein soll. Die Theorie beruht auf einer trennenden Unterscheidung der empirischen von einer nichtempirischen, intelligiblen, nur durch die Vernunft erfassbaren Dimension der menschlichen Person. Moralität wird zum unbedingten Anspruch ihres nur gedanklich fassbaren Kerns, während im Streben nach Glück sich die naturale Selbstliebe des empirischen, bedürftigen, sprachfähigen Lebewesens Ausdruck verschafft. Bis heute möchte ein erheblicher Teil der Ethik-Forschung3 wesentliche Aspekte von Kants Theorie der Moralität bewahrt wissen, ohne auch dessen dualistischer Unterscheidung von empirischem und intelligiblem Ich Rechnung tragen zu müssen. Nun hat Kant das Projekt einer Konzeption (irdischen) menschlichen Glücks, die seinen Begriff von Moralität einschließt, auch selbst verfolgt, eine Konzeption, in der zwar die metaphysische Unterscheidung von sensiblem und intelligiblem Ich noch keine explizite Rolle spielt, wohl aber bereits eine platonisch gefärbte Anthropologie4 am Werk ist. Und er hat das Projekt in einer Phase verfolgt, in der er bereits eine einigermaßen klare Vorstellung von seiner kritischen Transzendentalphilosophie (jedenfalls in theoretischer Hinsicht) besaß und die praktische Philosophie in enger Parallele zur theoretischen realisieren zu können dachte.5
Dieses Konzept lässt sich, wie ich im folgenden ersten Schritt zu zeigen versuche, mosaikartig aus Reflexionen vorwiegend der 70er Jahre6 in seiner eigenartigen Struktur rekonstruieren. Ich möchte nicht behaupten, Kant habe die dabei zutage tretende Position in der Zeit kurz vor der Veröffentlichung der KrV dezidiert vertreten. Doch da ich mich durchweg auf Reflexionen im Behauptungsmodus stütze, meine ich, dass er sie ernsthaft ins Auge gefasst hat. In einem zweiten Schritt werde ich dann versuchen, die Gesichtspunkte herauszuarbeiten, die Kant dazu bewogen haben, die Idee eines Glücks moralischer Selbstzufriedenheit zugunsten jener eines reinen Vernunftglaubens definitiv zu verabschieden.
(B) Mit vier Zitaten scheint mir die zunächst zu rekonstruierende Position im Umriss beschreibbar zu sein:
1. »Die Freiheit ist ein schöpferisches Vermögen. Das Gute aus Freiheit ist daher ursprünglich.«7
2. »Die Moralität ist die innere Gesetzmäßigkeit der Freiheit, sofern sie nämlich sich selbst ein Gesetz ist.«8
3. »Die Moralität besteht in den Gesetzen der Erzeugung der (wahren) Glückseligkeit aus Freiheit überhaupt.«9
4. »Glückseligkeit ist eigentlich nicht die (größte) Summe des Vergnügens, sondern die Lust aus dem Bewusstsein seiner Selbstmacht zufrieden zu sein.«10
Zum ersten Satz: »Die Freiheit ist ein schöpferisches Vermögen. Das Gute aus Freiheit ist daher ursprünglich.« Mit Rousseau und im Sinn der Neuzeit sieht Kant in der Freiheit die wesentliche Eigenschaft des Menschen. Der freie Wille macht das Spezifische des geistbegabten Wesens und damit den Kern der Person aus. Freiheit ist demnach auch als das eigentliche Prinzip menschlicher Sittlichkeit anzusehen. Kant entwickelt diesen Gedanken zunächst in kommentierenden Bemerkungen zur schulphilosophischen Lehre von der imputatio practica, der juridischen und moralischen Zuschreibung von Handlungen und Zurechnung von Handlungsfolgen.11 Freiheit wird darin primär als Gegenbegriff zu Natur verstanden und besagt Unabhängigkeit vom Zwang der Natur bzw., wie Kant es zumeist in platonisierender Sprache ausdrückt, vom »Zwange der Sinnlichkeit«.12 Gemeint ist fürs Erste der schlichte Sachverhalt, dass tierisches Leben über Instinktanlagen naturgesetzlich gesteuert wird, während menschliche Willkür durch die Fähigkeit zu Überlegung und Entscheidung das Leben selbst zu führen vermag.13 Freiheit ist dabei wesentlich charakterisiert durch das Merkmal der Ungebundenheit, das heißt der Fähigkeit, stets auch anders sich zu verhalten, als man sich tatsächlich verhält. »Das Vermögen zum Gegenteil ist immer da.«14 Kant erweitert allerdings den schulphilosophischen Gedanken der Indeterminiertheit des Menschen um ein wichtiges, ein Rousseau’sches Element: Er bezieht die Ungebundenheit nicht nur auf die Wahl der Mittel, er interpretiert sie auch als Freisein des Menschen von einem inhaltlich vorgegebenen Endziel des Lebens, in dem sein Streben zur Erfüllung gelangt. Der Mensch hat, in Kants Worten, eine »zu allerlei Gestalten fähige Natur«.15 Er findet eine »natürliche Unbestimmtheit in der Art und Proportion seiner Vermögen und Neigungen«16 vor; er wird Urheber auch der Ziele seines Handelns nach Begriffen.17 Kant sieht also den Menschen von Natur dazu bestimmt, sich mit der Wahl der Strebensziele in der Welt auch seine ihm adäquate Lebensform selbst zu schaffen.
Und ein weiterer Aspekt, der die Rede vom Zwang der Natur erklärt, ist von Bedeutung: Der Mensch gefällt sich in dieser unabhängigen Tätigkeit der Welt- und Selbstgestaltung. Ja, sein Streben findet befriedigende Erfüllung nur in Zielen, die er selbst konzipiert, sich vornimmt und realisiert. Unter diesem Gesichtspunkt spricht Kant in einem programmatischen Entwurf »Zur praktischen Philosophie« davon, der Mensch sei »durch die Natur bestimmt […] selbst der Urheber seiner Glückseligkeit und sogar seiner eigenen Neigungen und Fertigkeiten zu sein, welche diese Glückseligkeit möglich machen«.18 Freiheit vom Zwang »tierischer Sinnlichkeit« bedeutet für Kant dementsprechend nicht nur Herrschaft des Verstandes über den unmittelbaren Eindruck der Sinne und den durch Lust/Unlust-Empfindung evozierten unwillkürlichen Verhaltensimpuls, im Sinn der Fähigkeit, »einen Teil der Sinnlichkeit mit dem Ganzen proportionierlich zu vergleichen«19 und entsprechend zu handeln. Freiheit bedeutet auch die Fähigkeit des Menschen, bewusst und sua sponte auf etwas aus zu sein, was in keinerlei Motivationszusammenhang steht mit seinen unwillkürlichen Tendenzen der Selbst- und Arterhaltung, der Lustsuche und Unlustvermeidung.20 In Kants Worten: Freiheit bedeutet Unabhängigkeit von »empirischer Selbstliebe«,21 »von empirischen Bedingungen der Antriebe«,22 von aller »Naturbestimmung« überhaupt.23 Nicht darin unterscheidet sich der Mensch grundlegend vom Tier, dass er anstelle von Instinktausstattung über Verstand verfügt, sondern darin, dass er die Ziele seines Strebens unabhängig von Vorgaben seiner Natur selbst zu setzen vermag, dass er in der Bestimmung seines Wollens nicht »physisch genötigt« ist: »Wenn ein Wesen auch vermittelst seines Willens wozu bestimmt würde, der Wille selbst aber würde bestimmt, so würde er gerne tun und doch physisch genötigt sein.«24 Freiheit ist so gesehen für Kant die Fähigkeit zu selbstmächtiger Schöpfung der Beschaffenheit des eigenen Lebens und Erlebens des Lebens in der Welt.
Diese Eigenschaft verleiht ihrem Träger den Grund eines Werts, der dem gegenüber völlig andersartig ist, was wir meinen, wenn wir Dinge, Vorgänge oder Sachverhalte in der Welt als schön, gut oder angenehm bezeichnen. Es ist das derart die Welt und sich selbst gestaltende Person-Sein, das Kant in Abgrenzung zu allen übrigen Objekten des Strebens oder Wohlgefallens mit dem Ausdruck »Würde« charakterisiert.25 Entitäten, denen Würde zukommt, sind das Vornehmste, was es für uns gibt.26 Und Person-Sein im Sinn schöpferischer Freiheit ist Ursprung oder Bezugspunkt all dessen, was wir sonst noch wertvoll nennen. Dieses wird so nur genannt und ist es durch seine spezifische Relation und in dem Maß seiner Nähe zu personaler Freiheit. »Natur«, so heißt es in einer Reflexion aus dem Anfang der 70er Jahre, »hat keinen eigentümlichen Wert«;27 und wenig später: »das Gute im Physischen ist immer relativ«.28 Demjenigen, was nicht Person ist, wird lediglich der Stellenwert des Materials bzw. Mittels zuerkannt, in dem oder durch das sich die Person in ihrer Freiheit realisiert.29
Der (nur) relative Wert des Physischen wird von Kant dabei zweifach bestimmt: als Mittel zum Genuss des Lebens und als Mittel bzw. Material des Gebrauchs der Freiheit; wobei der gute Gebrauch, den die Person von ihrer Freiheit und den Dingen in der Welt macht, die oberste Bedingung all dessen darstellen soll, was wir vernünftigerweise gut nennen und billigen. Und dieser Gebrauch der Freiheit wird praktisch gedacht. Die Aktualisierung der Fähigkeit des Menschen zur Theoria, zur bedürfnisenthobenen Erkenntnis und Betrachtung der Natur und ihrer Prinzipien, ehedem für das Göttliche im Menschen und als eine, wenn nicht die Quelle seiner ihm möglichen Glückseligkeit angesehen, verliert gegenüber der Aktualisierung schöpferischer und gestaltender Freiheit an Gewicht und wird in den Rang eines bloßen Vergnügens herabgestuft:
»Die Welt ist von keinem Wert, wo nicht vernünftige Wesen sind, von denen sie gebraucht wird (und nicht bloß angeschaut wird); der bloß beliebige Gebrauch der Welt gehet auf das Vergnügen des Lebens […]. Allein die oberste Bedingung dieser Absicht ist der gute Gebrauch, den sie von sich selbst und den Dingen der Welt machen.«30
»Zweck an sich selbst«, das heißt um seiner selbst willen schätzenswert und der bedingungslosen Achtung und Sorge würdig, ist ein Wesen nur im Blick auf die Freiheit seines Willens. Kognitive Eigenschaften des Geistes sind in diese Selbstwerthaftigkeit nur eingeschlossen, soweit sie Bestandteil der Freiheit bzw. einer bestimmten Qualifikation der Freiheit sind.
»Verstand ist nur mittelbar gut, als ein Mittel zu anderem Guten und zur Glückseligkeit. Das unmittelbare Gute kann nur bei der Freiheit angetroffen werden […]. Gleich wie die Freiheit den ersten Grund von allem enthält, was anfängt, so ist sie auch, was die selbständige Bonität allein enthält.«31
Die Freiheit der Person ist ursprünglicher, schöpferischer Grund des Guten in zweifacher Hinsicht. Durch eine Selbstqualifizierung konstituiert sie das, was wir vernünftigerweise zuhöchst schätzen und unter allen Umständen billigen: die »Bonitaet (der) freien Willkür«32. Und durch diese Selbstqualifizierung bewirkt sie für die Person Wesentliches von dem, wonach alles Lebendige auslangt, das überhaupt nach etwas strebt: Glückseligkeit. Sie wird zu einem »innern Quell der Glückseligkeit, den Natur nicht geben kann und wovon wir selbst Urheber sein«.33 Kant scheut sich nicht, diese neuzeitlich gewichtete Differenz von Physischem und Freiheit bezüglich der Prinzipien menschlichen Lebens und Tätigseins in einer Sprache auszudrücken, die der platonischen Zweiweltenlehre entstammt: Soweit Natur unser Tun bewegt, sind wir pathologisch bestimmt, erleiden wir das Leben; soweit wir der »Freiheit subordiniert« sind,34 ist unser Leben »von reinen und himmlischen Ursprüngen«.35 Entsprechend zu differenzieren ist das Vergnügen, das der Befriedigung von Bedürfnissen entspringt, von der Lust, die mit einem Handeln aus Freiheit verbunden ist: »Diese Wollust ist vom Himmel genommen und das Ambrosia der Götter.«36
Zum zweiten Satz: »Die Moralität ist die innere Gesetzmäßigkeit der Freiheit, sofern sie nämlich sich selbst ein Gesetz ist.«37
Freies Person-Sein ist sowohl faktisch als auch rechtmäßig Gegenstand eigentümlicher Wertschätzung, aber nicht nur von Achtung, sondern auch von Verachtung, je nach seiner Qualifikation. Denn es ist Ursprung dessen, was wir umstandslos gut, wie dessen, was wir absolut schlecht nennen. Das absolut Gute nun, die »Bonität« bzw. die Moralität der Person, soll, wie es die wohl gewichtigste Reflexion dieser Phase ausdrückt, in ihrer »wohlgeordnete[n] Freiheit« bestehen.38 Als solche ist sie »das größte und eigentlich absolute Gut in jedem Verhältnisse«.39 Und umgekehrt gilt, dass »aus der Regellosigkeit das größte Böse« entspringt.40 Freiheit und Ordnung, beides im Verein, macht für Kant den Inhalt des Begriffs »absolut gut« aus. Die Synthese realisiert sich in dem, was er in dieser Phase (im Anschluss an Jean-Jacques Rousseau) den allgemeinen Willen einer Person nennt.
Von Freiheit der Person kann im Fall der Moralität nur die Rede sein, wenn die Ordnung ihres Handelns selbstgegeben ist – dies meint die Wendung »innere Gesetzmäßigkeit« –, aber auch, und darin besteht die Pointe Kants, wenn das durch das Gesetz gesicherte Gut wiederum Freiheit ist – dies meint die Wendung, sie sei »sich selbst ein Gesetz«. Kant bestimmt Moralität ausschließlich in Begriffen der Identität, der Anerkennung und Erhaltung von Freiheit. Ausgeblendet wird auch inhaltlich alles, was in irgendeiner Form durch Natur vorgegeben ist. Moralität ist »die Freiheit unter allgemeinen Gesetzen der Willkür«,41 und diese haben nichts anderes zum Inhalt als die Bedingungen, »unter denen allein die Freiheit mit sich selbst stimmen kann«.42
Das Mit-sich-selbst-Stimmen der Freiheit will Kant offensichtlich in Anlehnung an die Unterscheidung von numerischer und qualitativer Identität verstanden wissen. Ein Wesen ist moralisch gut, wenn es seine Freiheit mit sich selbst und mit der Freiheit anderer Wesen einstimmig macht. Und diese Einstimmigkeit der Freiheit des moralischen Subjekts ist eine Leistung seiner Vernunft.
Man mag sich das Gemeinte, das Kant als »Vollkommenheit der Freiheit« bezeichnet,43 folgendermaßen verdeutlichen: Ein Wesen, das von Natur ungebunden und in der Lage ist, sich selbst Ziele zu setzen, muss seine Zielsetzungen unter einheitsstiftende Grundsätze stellen, um sich selbst eine Identität als freies Wesen zu geben. »Das Erste, was der Mensch tun muss, ist, dass er die Freiheit unter Gesetze der Einheit bringt; denn ohne dieses ist sein Tun und Lassen lauter Verwirrung.«44 Wer dies nicht tut, unterliegt permanentem Wandel, ist fragmentiert, schwankend, fremdbestimmt, keine bestimmte Person in ihrer Geschichte. Man ›hat dann keinen sicheren Grund, mit sich selbst zu rechnen‹;45 man kann sich und anderen nur unter Voraussetzung einer derartigen Einheit einen »eigenen Willen« zusprechen.46 Und ein Mensch mit eigenem Willen will in allem, was er an empirischen Sachverhalten in der Welt erstrebt, auch und vor allem die Erhaltung dieser seiner Einheit und Selbständigkeit. Wenn wir also einem Menschen Moralität zusprechen, dann haben wir eine Einheit seines Wollens im Auge, die sich in all seinen Handlungen und Äußerungen dokumentiert, eine Einheit seiner Ziele, die von den Polen bloßer Kompatibilität bis zu wechselseitiger Beförderung reicht, die aus selbstgegebenen Grundsätzen resultiert und von dem obersten Grundsatz geleitet und begleitet wird: Wahrung der eigenen Identität als freies Wesen in allem, was man tut.
Der zweite Aspekt von Moralität ist der der qualitativen Identität von Freiheit. Freiheit stimmt in diesem Sinn mit sich überein, wenn das freie Subjekt alles mit sich qualitativ Identische, also die Freiheit aller anderen freien Subjekte, genauso schätzt, behandelt und behandelt wissen will wie die eigene; sei es in Nichteinmischung, sei es in Kooperation oder Solidarität.
Das Mit-sich-selbst-Stimmen der Freiheit im Sinn numerischer Identität ist Sache des Verstandes, auf die durchgängige Konsistenz des eigenen Lebens bezogen und beschränkt. Die Einstimmigkeit der Freiheit im Sinne qualitativer Identität ist eine Forderung praktischer Vernunft. Denn unter ihr verstehen wir nach Kant »das principium konstitutiver oder objektiver Grundsätze«,47 das heißt die Lösung der freien Willkür aus ihrer Beziehung auf einen privaten Endzweck,48 das Übersteigen der subjektiven Perspektive,49 die Bildung eines objektiven, allgemeinen Willens, der objektiv und allgemein ist genau darin, dass er das Wollen aller freien Subjekte berücksichtigt und unter Bedingungen der Gleichbehandlung stellt. Moralität ist demnach durch eigene Vernunft geordnete Freiheit. »Das System ist also ein rationales System der mit sich selbst allgemein einstimmigen Freiheit.«50
Zum dritten Satz: »Die Moralität besteht in den Gesetzen der Erzeugung der (wahren) Glückseligkeit aus Freiheit überhaupt.«51 Dieser Satz steht im Unterschied zu den bisherigen noch völlig quer zu Kants publizierter kritischer Moralphilosophie. Er behauptet einen Zusammenhang zwischen Moralität und Glückseligkeit, der dann strikt geleugnet wird. Weder lässt sich, so die Kritik der praktischen Vernunft, »zwischen äußerst ungleichartigen Begriffen, dem der Glückseligkeit und dem der Tugend, Identität ergrübeln«52 noch ein strenger empirisch-kausaler Zusammenhang feststellen. Die Analytik der Kritik der praktischen Vernunft versucht gerade nachzuweisen, dass die Maximen der Tugend und die der eigenen Glückseligkeit »einander in demselben Subjekt gar sehr einschränken und Abbruch tun« können.53 Und schlichte Weltkenntnis scheint uns zu sagen, dass Natur und Mitmenschen den Tugendhaften nur recht zufällig ein glückliches Leben führen lassen. Der notwendige Zusammenhang von beidem ist vielmehr ein selbstevidentes Postulat unparteiischer Vernunft, die erfahrungsunabhängig fordert, dass Glückseligkeit genau in Proportion zur Sittlichkeit verteilt sein soll, die uns auch diesbezügliche Anstrengungen abverlangt, aber keinen zureichenden Erfolg in der erfahrbaren Welt verspricht und deshalb die Hoffnung auf einen jenseitigen Ausgleich Grund und Nahrung gibt.
Ganz anders die zitierte Reflexion. Die Kernthese Kants in dieser Phase seines Denkens lautet: Moralität des Menschen ist Bedingung der Möglichkeit seiner irdischen Glückseligkeit. Er scheint sich mit ihr noch einigermaßen bruchlos in die ethische Tradition der Griechen einzureihen.54 Doch zum adäquaten Verständnis dieser These scheinen mir folgende Klärungen angebracht:
Kant fasst nicht etwa in völliger Übereinstimmung mit den antiken Vorbildern Glückseligkeit als fragloses Endziel allen menschlichen Strebens auf, dem sittliche Tüchtigkeit dann nach dem Schema einer Zweck-Mittel- oder Teil-Ganzes- oder Identitäts-Relation zugeordnet wird. Für ihn ist zunächst einmal »wohlgeordnete Freiheit« bzw. die Moralität der Person höchster, unvergleichlicher Wert und unbedingt verpflichtendes Ziel. Schon 1762 nennt Kant im Anschluss an den Philosophen und Theologen Christian August Crusius den Begriff der Verbindlichkeit (obligatio) grundlegend für alle Ethik, bezieht den moralischen Verpflichtungsanspruch auf einen »an sich notwendigen Zweck«, nämlich die Vollkommenheit der Freiheit, und grenzt ihn vom imperativen Modus der Regeln geschickten Verhaltens zur Beförderung der Glückseligkeit ab.55 Der Begriff des Glücks, der etwas zum Inhalt hat, wonach wir von Natur aus unvermeidlich streben, sei nicht geeignet, den unbedingten Verpflichtungscharakter und unvergleichlichen Wert zu erklären, den wir mit Moralität verbinden.56 Die Reflexion 7202 sagt nun auch unmissverständlich, Moralität hänge nicht von der Glückseligkeit als dem Zwecke ab,57 und erklärt pointiert, die Gesetze der Freiheit müssten »unabhängig von der Absicht auf eigene Glückseligkeit gleichwohl die formale Bedingung derselben a priori enthalten«.58
Die Moralität eines Menschen ist, so Kant, die formale Bedingung a priori seiner Glückseligkeit. »Die Bedingung a priori« besagt zunächst: Sie ist conditio sine qua non59 in einem universellen Sinn. Für alle Menschen gilt: ohne Moralität keine Glückseligkeit; und sie ist die Bedingung, das heißt die einzige Bedingung dieser Art. Der Ausdruck »formal« hat zwei verschiedene Konnotationen. Zunächst steht er im Gegensatz zu »material« und ist in Analogie zur Unterscheidung von Form und Materie in Kants Theorie der Erfahrungserkenntnis gebildet.60 Wie im Theoretischen das Material des sinnlich Gegebenen durch die Form des Verstandes geprägt werden muss, um Wirklichkeitserkenntnis zu ermöglichen, so muss im Praktischen die innere Gesetzlichkeit der Freiheit Wahl und Erstrebensmodus empirischer Ziele bestimmen, um richtiges Handeln und Fühlen zu ermöglichen. Und in Parallele zur theoretischen Erfahrungserkenntnis spricht Kant davon, dass die Materie menschlicher Glückseligkeit sinnlich, die Form derselben intellektuell sei;61 wobei dem moralischen Gefühl offensichtlich (noch) eine Vermittlungsstellung zugedacht ist.62 In diesem Zusammenhang meint »formal« dann, dass Moralität über den moralischen Sinn und sein Gefühl allen Elementen des Erlebens des Lebens in der Vielfalt und dem Wechsel seiner Aktivitäten und Widerfahrnisse eine für die Glückseligkeit erforderliche einheitsstiftende Form verleiht.
Mit dem zweiten Bedeutungselement von »formal« nähert Kant sich dem scholastischen Begriff von forma an: Er spricht explizit davon, Moralität mache das Wesen des Glücks aus.63 Nun benennt im Praktischen der Ausdruck »apriorisch« Grundbegriffe und Grundsätze, die natur- und widerfahrnisunabhängig unsere auf die empirische Welt bezogenen Wert- und Verpflichtungsurteile begründen und unser Handeln ebenso orientieren wie motivieren. Moralität sei formale Bedingung a priori der Glückseligkeit besagt also dann: Das glückliche Erleben des Lebens ist notwendig und essentiell bedingt durch die erfahrungs- und widerfahrnisunabhängige Einstellung der Moralität; das heißt, in allem Tun und Lassen moralisch sein zu wollen, was auch immer geschehen möge. Dies meint die schwächere Formulierung, Moralität sei »die Bedingung a priori, unter der man allein der Glückseligkeit fähig sein kann«64 und die stärkere Formulierung, Glückseligkeit sei »Produkt der eigenen Menschenvernunft«.65
Zum vierten Satz: »Glückseligkeit ist eigentlich nicht die (größte) Summe des Vergnügens, sondern die Lust aus dem Bewusstsein seiner Selbstmacht zufrieden zu sein.«66
Wenngleich Kant von Moralität als formaler Bedingung a priori der Glückseligkeit bzw. ihrer ursprünglichen Form oder der »Funktion der Einheit a priori aller Elemente der Glückseligkeit«,67 ja gar ihrem Wesen spricht, so will er doch Glückseligkeit von Moralität genau unterschieden wissen. Soweit der Begriff der Glückseligkeit selbst betroffen ist, scheinen zwei Gesichtspunkte seine Betonung des Unterschieds zu bestimmen. Einmal wird eingeräumt, Moralität sei zwar »die wesentliche formale Bedingung der Glückseligkeit«, aber es seien auch »noch andere materiell (wie bei der Erfahrung) erforderlich«,68 wenngleich letztere in ihrem Beitrag zum Glück nur als »Accidentien« anzusehen sind.69 Zum anderen versteht Kant, anders als etwa die aristotelisch-scholastische Tradition, unter Glückseligkeit in keiner Weise bestimmte (unbehinderte) Aktivitäten des Subjekts aufgrund entsprechender Neigung, Fähigkeit und Tüchtigkeit, sondern ein Befinden des Subjekts, und zwar keinen objektiven Zustand, sondern eine exklusiv subjektive Befindlichkeit, das heißt eine Art und Weise, wie sich das Subjekt selbst fühlt. Glücklich sein – und dieses Vorverständnis hält sich bei Kant durch – heißt in einem scheinbar schlichten psychologischen Sinn: Zufrieden sein mit seinem Leben im Ganzen, an ihm durchgängig und in jeder Hinsicht Gefallen haben. »Glückseligkeit ist das Bewusstsein einer immer währenden Zufriedenheit mit seinem Zustand.«70
Moralität nun erfordert eine Definition in Begriffen qualifizierter Aktivität und entsprechender Tüchtigkeit; Glück, lediglich als bestimmtes Gefühl verstanden, lässt sich dagegen nur als Folge, Wirkung oder Begleitphänomen bestimmen, sei es von Einstellungen und Aktivitäten, sei es von Widerfahrnissen des Subjekts. Man wünscht deshalb durchaus Verschiedenes, wenn man glücklich sein und wenn man moralisch sein will, und es ist die Frage, wie beide Wünsche in einer Person verbunden zu denken sind.
Die von Kant gedachte Synthese hat eine eigenartige teleologische Struktur. Moralität muss »über alles und zwar schlechthin gefalle[n]«,71 der Wunsch nach Moralität demnach unabhängig sein »von der Absicht auf eigene Glückseligkeit«.72 Das Verlangen nach Glückseligkeit darf also nicht die Rolle des dominanten Bestimmungsgrunds und Motivs für Moralität spielen.73 Andererseits kann der Mensch als endliches, bedürftiges Wesen gar nicht umhin, auf Glück aus zu sein.74 Dieses Ziel bzw. dieser Wunsch lässt sich nicht abtun oder beseitigen, wohl aber nachordnen. Der moralisch gut gesinnte Mensch sieht und wünscht seine eigene Glückseligkeit als nicht primär intendierte Folge von Moralität, und zwar in Form eines Wissens um den Selbstbeglückungseffekt des Bewusstseins eigener Moralität – Glückseligkeit aus Freiheit – und in Gestalt einer zusätzlichen Hoffnung auf jenseitigen Ausgleich für möglicherweise entgangenes sinnliches Vergnügen und erlittenen Schmerz.75
Glücklich wird man nach dieser Theorie also nur, wenn man sein Streben nach Glück dem Wunsch nach Moralität nachzuordnen versteht. Wer dagegen Moralität bejaht und wünscht um der Glückseligkeit willen, wird beides verfehlen. Glückseligkeit ist gewusste, gewünschte und erhoffte Nebenwirkung moralischer Einstellung und Lebensführung.
Menschliches Glück speist sich nach Kants Reflexionen aus zwei ungleichartigen und ungleichgewichtigen Quellen, »aus dem, was Natur darbietet«,76 und aus der Tugend als einer bestimmten »Eigenschaft der freien Willkür«.77 Menschliches Leben ist ein Gebilde aus Natur und Freiheit. Entsprechend ist die Qualität des Erlebens des Lebens im Gefühl durch beide Faktoren bestimmt und bestimmbar. Der eine bedingt, was Kant, mitunter terminologisch fixiert, das Vergnügen, der andere, was er Selbstzufriedenheit nennt. Das Verhältnis von beiden ist so zu denken, dass ohne Selbstzufriedenheit kein gelungenes Erleben von Vergnügen möglich ist, dass Selbstzufriedenheit ihrerseits nicht des Vergnügens bedarf, den Mangel desselben weitgehend zu kompensieren vermag, und, soweit sie dazu nicht zureicht, auf ein vernunftgestütztes Erhoffen eines jenseitigen Ausgleichs zurückgreifen kann.
Unter »Natur« versteht Kant in diesem Zusammenhang sowohl die aller Erziehung und Bildung sowie Überlegung, Entscheidung und Handlung vorgängige »individuelle[n] oder auch spezifische[n] Beschaffenheit unseres Subjekts«78 als auch die nichtmenschliche Natur im Sinn all dessen, was ohne unser Zutun in der Welt besteht und geschieht. Natur nun bietet »Materialien zum Wohlbefinden«,79 zeichnet primär verantwortlich für das Vergnügen als der Materie80 bzw. dem Empirischen81 der Glückseligkeit. Im Anschluss wohl an Ciceros commoditas et iucunditas vitae,82 aber auch an die zeitgenössischen Empiristen spricht Kant von der Annehmlichkeit des Lebens: Diese besteht letztlich darin, dass das Leben sich in leiblich-sinnlicher Hinsicht als lustvoll erlebt. Das Subjekt erweist sich in diesem Genuss seines Daseins als wesentlich passiv, rezeptiv, von empirischen Gegebenheiten abhängig.83 »Wir haben ein Wohlgefallen an Dingen, die unsere Sinne rühren, weil sie unser Subjekt harmonisch affizieren und unser ungehindertes Leben oder die Belebung fühlen lassen.«84
Das Vergnügen resultiert also aus einem harmonischen Zusammenspiel von individueller und spezifischer, im Kern naturaler Beschaffenheit des Subjekts und den Dingen, mit denen wir in Kontakt treten und die wir in Erfahrung bringen. Kant beschreibt es, in engem Anschluss an antike, insbesondere epikureische Konzepte, mit den Ausdrücken »Belebung« und »ungehindertes Leben«. Gemeint ist wohl die Lust der Bedürfnisbefriedigung in ihrer zweifachen Form: als Lust, die den Prozess der Befriedigung eines Bedürfnisses begleitet, und als Lust, die das vom Bedürfnisdruck freie und wache Leben erlebt. Kants zentrale These lautet nun: Der Mensch, der sein Glück in die größtmögliche Annehmlichkeit des Lebens setzt, wird sein Ziel unweigerlich verfehlen.
Die Argumente für diese These sind weitgehend der traditionellen Hedonismuskritik entnommen.85 Der Gebrauch der Vernunft »nach sinnlicher Anlockung ist unzuverlässig. Zudem ist es keine wahre Freiheit wobei das principium nicht von Sinnen unabhängig ihnen allein ein Gesetz gibt.« Mit andern Worten und etwas ausführlicher gesagt: Wer als Mensch die Zufriedenheit mit seinem Leben im Ganzen von der größtmöglichen Summe des Vergnügens erwartet, hat (a) kein klares, präzises und konsistentes Konzept dessen, was er will, begibt sich (b) in Abhängigkeit von Dingen, die keine bestimmte Grenze haben, die dauerndem Wandel unterliegen und seiner Verfügungsgewalt sich weitgehend entziehen, und verfolgt (c) ein Endziel, das seinen eigenen Wert als freies Vernunftwesen unterbietet.86 »Seinen Zustand angenehm zu finden, beruht auf dem Glück, aber sich über die Annehmlichkeiten dieses Zustandes als Glückseligkeit zu erfreuen, ist dem Wert derselben nicht angemessen.«87 Das Wohlgefallen an seinem Dasein im Ganzen kann hauptursächlich nur aus etwas resultieren, was der Mensch sicher weiß, uneingeschränkt in seiner Hand hat und seiner Würde entspricht: Aus der Haltung eines moralischen Souveräns zu sich selbst als empirisch-bedürftiges Lebewesen. Seine freie Willkür selbst unter die Gesetze eines allgemein gültigen Willens zu bringen, ist für ein endliches vernunftfähiges Subjekt notwendiger und zureichender Grund der Selbstbilligung und hat ein erhebendes Selbstwertgefühl zur Folge.88
Um die Quelle dieser Zufriedenheit ist ein präzises und sicheres Wissen möglich. Und sie verdankt sich unabhängig von wechselnden Lebensumständen ganz und gar unserer Freiheit; sie ist selbstgewirkt. Kant spricht deshalb vom moralischen Selbstwertgefühl als einer »Spontaneität des Wohlbefindens«89 bzw. »einem Produkt der Spontaneität«.90 Die oberste implizite Prämisse seiner Argumentation besteht offensichtlich in dem Gedanken, dass ein im Vollsinn des Wortes vernunftfähiges Wesen sich darin und im Ganzen nur darin gefällt und gefallen kann, vernünftig zu sein.91
Dieses Wohlgefallen an sich selbst hat im Fall des moralischen Gefühls einen dreifachen Aspekt: einen theoretischen, einen moralisch-praktischen und einen außermoralisch-praktischen. Das Subjekt gefällt sich, weil es seinen Ansichten Konsistenz verleiht,92 weil es sich moralischen, das heißt absoluten Wert gibt,93 und weil es sich gegenüber naturalen Determinanten seines Strebens unabhängig, überlegen und stark erweist.94 Kant verweist damit95 auf einen ebenso schlichten wie wichtigen Gedanken: »Glückseligkeit zu einem Produkt der Spontaneität zu machen«96 verläuft innengewendet über Selbstbeherrschung, während der Weg, Zufriedenheit in der Sicherung und Maximierung des (sinnenbasierten) Vergnügens zu suchen, außengewendet in die gesteigerte Anstrengung technischer und pragmatischer Weltbeherrschung führt.
Glückseligkeit als Zufriedenheit mit seinem Leben im Ganzen schließt das Bewusstsein ein, dass diese Zufriedenheit das gesamte Leben begleitet. Sie setzt im Erinnern von Vergangenem, im Erleben von Gegenwärtigem und Vorwegnehmen von Kommendem eine Einheit des Bewusstseins voraus, die die Integration empirisch bedingter Verschiedenheiten in Gedanken, Absichten und Gefühlen zu »einer einzigen […] empirischen Glückseligkeit«97 möglich macht.98 Diese Einigung kann auf emotionaler Ebene nur das selbstgewirkte moralische Selbstwertgefühl leisten. Wie im Theoretischen das »ich denke« alle meine Erfahrungen muss begleiten können, um eine Einheit des Bewusstseins der Erfahrungswelt zu ermöglichen,99 und wie im Praktischen der allgemeine Wille als »transzendentale Einheit im Gebrauch der Freiheit« die Einheit unserer empirischen Zwecksetzungen bedingt,100 so ist moralische Zufriedenheit mit sich selbst »gleichsam apperceptio iucunda primitiva«,101 das heißt der widerfahrnisunabhängige emotive Konstitutionsrahmen für eine mögliche empirische Glückseligkeit.102 Dies besagt nicht, Moralität habe sinnliches Vergnügen zur Folge.103 Es besagt allerdings, dass Zufriedenheit des Menschen mit seinem Zustand als endliches, bedürftiges, verletzbares Verstandes- und Sinnenwesen wenn, dann nur im Rahmen einer moralischen Lebenseinstellung und Lebensführung möglich ist. Da sie den Einzelnen befähigt, »auch ohne Lebensannehmlichkeiten zufrieden zu sein und glücklich zu machen«,104 setzt sie ihn zu sinnlichem Vergnügen und empirischer Selbsterhaltung in ein gelassenes Verhältnis und befreit sinnliches Vergnügen von der ihm unter menschlichen Lebensbedingungen selbstdestruktiven Last, Endziel des Strebens zu sein.105
Zum anderen ist optimale empirische Wohlfahrt unter gesellig lebenden Menschen nur dann möglich, wenn diese einmütig ihr Zusammenleben nach Grundsätzen der Moralität ordnen: »Es ist wahr, die Tugend hat den Vorzug, dass sie aus dem, was Natur darbietet, die größte Wohlfahrt zuwege bringen würde.«106 In Anlehnung wohl an Platons Politeia, stärker noch an Rousseaus Contrat Social, glaubt Kant, das Optimum empirischer Wohlfahrt für jeden sei möglich nur in einem System gegenseitig vermittelter Bedürfnisbefriedigung, in dem die einzelnen Menschen miteinander in Nichteinmischung, Kooperation und Solidarität nicht nur durch Rechtsgesetze, sondern auch moralisch verbunden sind.107 Und wie Rousseau sieht Kant auch das einigermaßen Utopische dieser Bedingung.108 Die Religionsschrift wird dazu später Differenzierteres sagen.109
Wer nun moralisch gut ist auch unter Bedingungen defizienter gesellschaftlicher Moralität,110 weiß sich, so Kant, von Gaben der Natur, des Schicksals und der Mitmenschen weitgehend unabhängig111 und bezieht seine Zufriedenheit aus dem Bewusstsein des eigenen moralischen Werts, das zugleich ein Bewusstsein ist, »seiner Selbstmacht zufrieden zu sein«.112