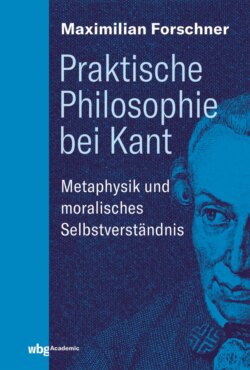Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Die »Lehre der Alten« und das christliche Ideal der Heiligkeit
ОглавлениеIm Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der Lehre »der Alten« vom summum bonum präsentiert Kant seinen moralischen Vernunftglauben in den 70er Jahren im Unterschied zum kynischen Ideal der Einfalt, zum epikureischen der Weltklugheit und zum stoischen der Weltweisheit als Ideal der Heiligkeit, als das wahre christliche Ideal des Lehrers des Evangeliums.
Den Ausgangspunkt von Kants Religionsphilosophie bildet, das ist durch Wortlaut und zeitliche Folge der Reflexionen eindeutig belegbar, das subjektive Problem der Triebfeder bzw. des Motivs moralischen Handelns und, mit ihm engstens verbunden, das objektive Problem einer gerechten Weltordnung. War er zunächst während seines Syntheseversuchs von Stoa und Epikureismus der Meinung, dass die menschliche Natur nur eine gemischte, eine »unreine« Motivation zu moralischem Handeln zulässt, so glaubt er dann, dass sein Konzept des moralischen Glaubens sowohl die Reinheit der Motivation durch objektive Beweggründe der Tugendliebe rettet als auch das unhintergehbare Faktum der subjektiven, auf Glück gerichteten Triebfeder des Handelns berücksichtigt und ihr Recht wahrt; nämlich dadurch, dass er die (vollkommene) Realisierung des höchsten Guts in eine andere, absolut gerecht regierte bzw. geordnete Welt verlegt. Aus den 60er Jahren stammt folgende Reflexion:
»Die Schwäche der menschlichen Natur besteht in der Schwäche des moralischen Gefühls verhältnisweise gegen andere Neigungen. Daher die Vorsehung sie mit hilfsleistenden Trieben als analogis instinctorum moralium vergrößert hat, e. g. Ehre, Storge [= Liebe], Mitleiden, Sympathie oder auch mit Strafen. Wenn diese die Bewegungsgründe zum Teil sind, so ist die Moralität nicht rein. Die Moral ist chimärisch, welche alle diese motiva auxiliaria ausschließt.«210
In die Zeit von 1776 bis 1778 dagegen gehören folgende Reflexionen:
»Epikur wollte der Tugend die Triebfeder geben und nahm ihr den innern Wert. Zeno wollte der Tugend einen innern Wert geben und nahm ihr die Triebfeder. Nur Christus gibt ihr den innern Wert und auch die Triebfeder […]. Die Triebfeder aus der andern Welt ist auch schon an sich selbst der Entsagung auf allen Vorteil gleich […]; die andere Welt ist ein notwendig moralisches Ideal. Ohne dieses ist die moralische Gesetzgebung ohne Regierung. Sie allein geht auf den innern Wert der Handlungen. Durch die gehoffte Belohnung der andern Welt wird die Tugend uneigennützig und hat doch eine Stütze oder Zuflucht. Die Triebfeder ist den Sinnen so weit als möglich entzogen.«211
»Es ist wahr: ohne Religion würde die Moral keine Triebfedern haben, die alle von der Glückseligkeit müssen hergenommen sein. Die moralischen Gebote müssen eine Verheißung oder Drohung bei sich führen. Die Glückseligkeit ist in diesem Leben nicht ihre Aufmunterung; überdem ist die reine Gesinnung des Herzens das, was den eigentlichen moralischen Wert ausmacht; diese aber wird niemals von andern recht erkannt, oftmals gar verkannt. Es hat sicherlich keinen Menschen gegeben, der mit gänzlicher Gewissenhaftigkeit über die Reinigkeit seiner Sitten wachte und der nicht zugleich hoffte, dass einmal diese Sorgfalt von großer Wichtigkeit sein werde und von einer die Welt regierenden höchsten Weisheit erwartete, es werde nicht umsonst sein, dieser genauen Beobachtung sich gewidmet zu haben. Allein das Urteil über den Wert der Handlungen, sofern sie Beifalls und der Glückseligkeit würdig sind, muss doch von aller Erkenntnis von Gott unabhängig sein.«212
Nicht der Begriff der Moralität und das Urteil über den moralischen Wert von Handlungen ist von der Überzeugung von der Existenz eines Gottes abhängig, wohl aber die Triebfeder zu moralischem Handeln; aber nicht nur die subjektive Triebfeder, sondern auch die Einsicht in die objektiv-unbedingte Verbindlichkeit moralischer Gesetze:
»Wäre kein Gott, so würden alle unsere Pflichten schwinden, weil eine Ungereimtheit im Ganzen wäre, nach welcher das Wohlbefinden nicht mit dem Wohlverhalten stimmete, und diese Ungereimtheit würde die andere entschuldigen. Ich soll gerecht gegen andere sein; aber wer sichert mir mein Recht?«213
Von besonderer Bedeutung ist für Kant offensichtlich der Gesichtspunkt, dass die im Vernunftglauben enthaltene Hoffnung auf gerechte Belohnung nicht die Reinheit der Tugendgesinnung verdirbt. »Das Ideal des Christen hat dieses Besondere, dass es nicht allein die Idee der sittlichen Reinigkeit zum Principio der Dijudikation macht, sondern auch zur unnachlasslichen Richtschnur der Handlungen und dass er darnach solle gerichtet werden.«214 Der Christ, so Kant, bemüht sich um Moralität nicht des Lohnes wegen, sondern um der Tugend selbst willen und ist sich bewusst, dass er von einem göttlichen Richter eine Belohnung nur zu gewärtigen hat, wenn er genau dieses tut. Ja, der Vernunftglaube ist eine Folge der Tugendliebe und nicht umgekehrt. Der und nur der, welcher Tugend als unbedingtes Gut und Bedingung der Billigung von Natur- und Glücksgaben an freien Wesen ansieht und schätzt, gewinnt den wahren Vernunftglauben.
»Das System des feinsten Eigennutzes ist darin von dem Lehrbegriff der sich selbst genugsamen Tugend unterschieden, dass diese die Tugend an sich selbst liebt und darin nicht umhin kann, einen allsehenden Richter ihrer Reinigkeit und ihre Belohnung zu hoffen. Die Tugendliebe ist der Hoffnung glücklich zu sein, und diese gibt ihr Stärke, dem Unangenehmen, was mit ihr verbunden ist, zu widerstehen. Dagegen im ersteren System ist die Hoffnung der Glückseligkeit womöglich ein Grund der Tugend, eigentlich ein Grund kluger Handlungen, die eben dieselbe Wirkung, aber nicht aus denselben principiis leisten.«215
Kant spricht im Anschluss an Alexander Baumgarten von einem praemium morale, wenn die Belohnung für eine Tat nicht Grund, sondern Folge der freien Handlung ist,216 während das praemium pragmaticum der »Preis ist […], der Bewegungsgrund war«.217 In diesem Sinn spricht er auch von praemia auctorantia, von einem auf etwas ausgesetzten Preis bzw. Lohn, der zum Handeln anregen und bewegen soll, im Unterschied zu praemia remunerantia, Belohnungen, die eine geschehene gute Tat vergelten. Derartige Belohnungen entsprechen guten Handlungen, zu denen man verpflichtet ist bzw. die man über seine Pflicht hinaus vollzieht. Auf sie besteht kein Rechtsanspruch, wohl aber entsprechend der Güte und dem Vermögen des Gebieters oder Adressaten eine plausible bzw. billige Erwartung, insbesondere dann, wenn die Pflichterfüllung bzw. gute Tat mit Mühen und Einbußen auf Seiten des Handelnden verbunden ist.218 In diesem Sinn sind die Reflexionen 7280 und 7281 zu verstehen, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Baumgartens Behandlung der praemia kommentieren.
»Prinzip des Eigennutzes. analogon meriti ist eine pflichtmäßige Handlung unter Hindernissen der entgegenstrebenden Natur. Wie kann die Hoffnung auf göttliche Güte mit der Uneigennützligkeit verbunden werden? Wenn sie nicht als praemium [hier zu verstehen im engen Sinn von Lohn bzw. Preis, M. F.] betrachtet wird, sondern nur als Beifall, der unsere Wahl bestätigt.«219
»Die Erwartung der Belohnungen verhindert nur dann den moralischen Wert, wenn diese den Bewegungsgrund enthalten, nicht aber, wenn sie nur dazu dienen, die Hindernis der Moralität in der Furcht vor dem Verlust aller Glückseligkeit aufzuheben.«220
Kant unterscheidet in dieser Zeit im Blick auf die Motivation sittlich guten Handelns des Menschen zwei Faktoren, den objektiven Bewegungsgrund, meist »motivum« genannt, nämlich die Pflicht bzw. die Tugend selbst,221 der in einer Vernunftaussage und einem dictamen rationis besteht, und die subjektive Triebfeder, meist mit »elater« bezeichnet, die sich aus Gefühlen, Trieben und Neigungen konstituiert. Bei der Triebfeder nun ist zu unterscheiden zwischen dem moralischen Gefühl (der Selbstachtung, des Wohlgefallens, der Selbstbilligung) und naturbasierten Neigungen. Die Hoffnung auf Glück nach Maßgabe der Glückswürdigkeit im Vernunftglauben ist wie das moralische Gefühl eine vernunftgewirkte emotive Einstellung und verstärkt die Kraft des moralischen Gefühls, das unter der bedürfnis- bzw. neigungsbezogenen Furcht des Glücksverlusts in Verbindung mit der Tugend- und Pflichtvorstellung der Vernunft zu schwach wäre, den Menschen zu tugendhaftem Handeln zu bewegen.
»Wie kann Vernunft eine Triebfeder abgeben, da sie sonst jederzeit nur eine Richtschnur ist und die Neigung treibt, der Verstand nur die Mittel vorschreibt? Zusammenstimmung mit sich selbst. Selbstbilligung und Zutrauen.222 Die Triebfeder, die mit der Pflicht verbunden werden kann, aber niemals an deren Stelle gesetzt werden muss, ist Neigung oder Zwang.223 Die erste darum, weil die Neigung (selbst die wohlwollende) durch Pflicht muss regiert werden. Die zweite darum, weil die Zwangsbedürftigkeit an sich selbst schon eine Schwächung der Macht der Pflicht ist.«224
»Die treibende Kraft kommt auf das Gefühl des Wohlgefallens an, sofern es auf sich selbst und die Selbstschätzung angewandt wird, und zwar nach seinem allgemeingültigen Preis, d. i. dem inneren Wert. Erhebung der Menschheit.«225
Die Hoffnung des Tugendhaften auf ein durch Gott gewährtes Glück steht im Rahmen der moralischen Gliederung des Triebfederbereichs zwischen moralischem Gefühl und Neigung und hat die Funktion eines ausgleichenden Gegengewichts zu neigungsbedingten Emotionen, die dem moralischen Gefühl entgegenwirken. Sie ist wie das moralische Gefühl eine auf Gesichtspunkten der Vernunft beruhende Emotion und trägt zugleich dem Anspruch der Neigung bzw. des sinnlichen Bedürfnisses Rechnung.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt, der Kants Plädoyer für das christliche Ideal der Heiligkeit gegenüber den Lehren der Alten leitet, ist die Abwehr der Gefahr sowohl theoretischer Selbstüberschätzung als auch moralischen Eigendünkels oder sittlicher Selbstnachsicht, der nach seiner Meinung durch die Philosophie der vorchristlichen Antike vom summum bonum Vorschub geleistet wird. Während Kant in den 60er Jahren Platons Ideal einer durch theoretische und charakterliche Bildung zu erreichenden Gemeinschaft mit Gott mit den Prädikaten »mystisch«, »enthusiastisch«, gar »fanatisch« belegt und offensichtlich in engen Zusammenhang mit dem Christentum bringt,226 wird dieses Ideal in den 70er Jahren ungleich positiver beurteilt. »Plato: Moral aus der Idee, nicht den Neigungen oder den Erfahrungen gemäß, auch nicht aus Reflexionsbegriffen. Nur er suchte seine Idee in Gott, oder er machte seinen Begriff von Gott aus diesen Ideen.«227 Die bleibende Differenz zu Platon besteht allerdings darin, dass dieser, wie Kant meint, ein Wissen, eine intellektuelle Anschauung behauptet, während er nach dem Vorbild Christi nur von Wohlverhalten sowie von Glauben und Hoffen zu sprechen vermag. »Christus sagt auch, dass in der Gemeinschaft mit Gott das höchste Gut besteht; aber sein Weg ist durch das Wohlverhalten im Glauben, nicht durch Anschauen oder Andächtelei. Er ist hierin von Plato unterschieden.«228
Als Kritik an allen vorchristlichen Ethikentwürfen bleibt der Vorwurf der Selbstüberschätzung, während einzig das Christentum sich in gebotener, dem Menschen gemäßer Bescheidenheit übt. »Das Christentum hat dieses Besondere an sich, dass, da alle andre vorgeben, der Mensch könne aus eignen Kräften dahin gelangen, dasselbe die Schwäche der menschlichen Natur nicht vorschützt, sondern zur Schärfe der Selbstprüfung braucht und von Gott Hilfe.«229
Stoa und Epikureismus, für Kant (ähnlich wie für Cicero) die großen ethischen Antipoden der Antike, die nunmehr in der Aufklärung erneut eine paradigmatische Rolle spielen, hätten einerseits den Menschen dünkelhaft überschätzt (die Stoa), andererseits das moralische Gesetz den empirischen Neigungen angepasst (Epikur). Das Christentum allein verfüge über den korrekten Vernunftbegriff des höchsten Guts des Menschen und trage zugleich dem anthropologischen Sachverhalt Rechnung, dass der Mensch mit seinen natürlichen Kräften bezüglich beider Komponenten des höchsten Guts überfordert sei. Es habe den strengsten Begriff der Würdigkeit und fordere die größte Reinheit des Herzens, stärke aber zugleich das Vertrauen auf einen gerechten und hilfreichen Gott.
»Das summum bonum der philosophischen Sekten konnte nur stattfinden, wenn man annahm, der Mensch könne dem moralischen Gesetz adäquat sein. Zu dem Ende musste man entweder seine Handlungen mit moralischem Eigendünkel vorteilhaft auslegen oder das moralische Gesetz sehr nachsichtlich machen. Der Christ kann die Gebrechlichkeit seines persönlichen Wertes erkennen und doch hoffen, des höchsten Gutes selbst unter Bedingung des heiligsten Gesetzes teilhaftig zu werden.«230
»Wenn die Hoffnung der Glückseligkeit unserer sittlichen Würdigkeit soll gemäß sein, so ist der Weise des Evangelii das wahre sittliche Ideal. Der nämlich die natürliche Tugend und das natürliche Glück nicht für hinreichend hält, sondern beides als ergänzungsbedürftig sowohl zur Würdigkeit als auch den Besitz der Glückseligkeit.«231
»Weil die Alten kein ander Vermögen der Sittlichkeit als das natürliche erkannten, so machten sie das Gesetz nachsichtlich. Dagegen das Evangelium rein. Daher vollkommenere Morallehre. Die Triebfeder in dieser Welt ist auch nicht den Gesinnungen angemessen.«232
»Die christliche Religion sagt: wir können niemals hoffen, durch eigen Verdienst die Würdigkeit zu erlangen. Sie fordert die größte Reinigkeit des Herzens.«233
Die Einsicht in die Schwäche menschenmöglicher Tugend führe im Rahmen des christlichen Ideals nicht zur Verminderung des moralischen Anspruchs, sondern zur Hoffnung auf göttlichen Beistand, sie führe nicht zu quietistischer »Bangigkeit«, sondern zum Einsatz der vorhandenen Kräfte, sie führe nicht zu Versuchen äußerlichen Lohndienstes und sklavischer »Andächtelei« vor Gott, sondern zur Arbeit an der eigenen Sittlichkeit. Wahre Religion habe ihren Ausgangspunkt und Kern im moralischen Gefühl, in der moralischen Gesinnung und in der auf sie sich stützenden Hoffnung; andernfalls ist sie Ausdruck einer unmoralischen knechtischen Einstellung.
»Die Lehre des Evangelii will auch, dass man nicht anders als durch Wohlverhalten und Heiligkeit soll hoffen selig zu werden, dass man aber diese Heiligkeit hoffen soll, sofern man mit allem Ernste sich befleißigt, nach seinen verliehenen Kräften so gut zu sein als man kann.«234
»Es ist nötig, die Sittlichkeit vor der Religion zu schicken, dass wir eine tugendhafte Seele Gott darbringen; wenn die Religion vor den Sitten vorhergeht, so ist die Religion ohne Sentiment eine kalte Einschmeichelei und die Sitten eine Observanz aus Not ohne Gesinnung.«235
»Es ist unverschämt, um Glück oder nur um Straflosigkeit zu bitten, wenn man nicht ein besserer Mensch ist. Der göttliche Wille wird alsdenn nicht als ein heiliger, sondern eigenliebiger und despotischer Wille betrachtet, der keine Gesetze der innern Anständigkeit achtet und bloß den Einschmeichelungen Gehör gibt.«236