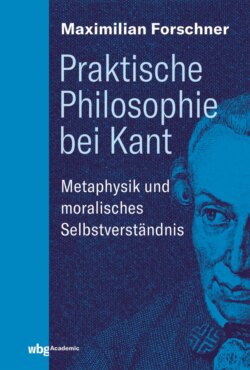Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
Оглавление»Ich kann also Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des notwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn ich nicht der spekulativen Vernunft zugleich ihre Anmaßung überschwänglicher Einsichten benehme, weil sie sich, um zu diesen zu gelangen, solcher Grundsätze bedienen muss, die, indem sie in der Tat bloß auf Gegenstände möglicher Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln, und so alle praktische Erweiterung der reinen Vernunft für unmöglich erklären. Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatismus der Metaphysik, d. i. das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist.«
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede, B XXX.
(1) Kant ist ein Kritiker der ihm überkommenen (rationalistischen) Metaphysik; doch sein philosophisches Werk lässt sich keineswegs als Beginn eines »nachmetaphysischen« Denkens verstehen. Kants Philosophie bietet eine Grundlegung der Metaphysik; seine normative Philosophie menschlicher Praxis ist metaphysisch begründet. Kant war, wie er selbst von sich bekennt, »in die Metaphysik verliebt«, erfreute sich anfangs nicht immer ihrer Gunst (vgl. AA II, 367 f.) und suchte nach einer gesicherten Beziehung zu ihr. Er war überzeugt, den nicht bezweifelbaren Ansatz und die solide Basis für eine konstante (und für uns alle offene und erfüllte) Liebe zu ihr schließlich im moralischpraktischen Selbstverständnis gefunden zu haben. Was er in der Vorrede zur zweiten Auflage der KrV als Aufgabe und Ziel seines philosophischen Unternehmens erklärt, scheint denn auch klar und eindeutig zu sein: Er möchte die Erkenntnisansprüche der theoretischen Vernunft, erhoben in der traditionellen »rationalistischen« Metaphysik, als Anmaßung dartun und den legitimen Gebrauch der Grundsätze unseres Verstandes auf die Erkenntnis möglicher Gegenstände unserer Erfahrung begrenzt wissen. Was in der Geschichte der Kantinterpretation manchen nicht so klar erschien, ist dies, dass er in eins damit auch die »überschwänglichen« Erkenntnisansprüche eines verabsolutierten szientistischen Empirismus oder »dogmatischen« Naturalismus zurückweisen möchte. Auch sie betreiben schlechte Metaphysik. Auch sie erheben ja (wenn auch negative) Erkenntnisansprüche über Dinge bzw. Sachverhalte, die »nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein [können]«. Sie erklären schließlich »alle praktische Erweiterung der reinen Vernunft für unmöglich«. Kant möchte mit seiner Kritik der reinen Vernunft sowohl die theoretisch-spekulativen als auch gängige oder drohende verabsolutierte theoretisch-empirische Erkenntnisansprüche aufheben, »um zum Glauben Platz zu bekommen«. Dabei soll erst im letzten Teil der KrV, der transzendentalen Methodenlehre, klarwerden, was da mit »Glauben« genauer gemeint ist.
Kants Philosophie ist antinaturalistisch. Worauf sich sein Interesse zentriert, ist allem voran »die praktische Erweiterung der reinen Vernunft« und der »notwendige praktische Gebrauch der Vernunft« sowie, was das Glauben betrifft, zunächst die (theoretische) Sicherung wenigstens der Möglichkeit der Annahme von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Es geht ihm dabei allem anderen voran um die Moralität des Menschen. Fälschlich verabsolutierte Erkenntnisansprüche führten zu unlösbar scheinenden metaphysischen Kontroversen und zum Unglauben; der Unglaube widerstreite der Moralität; er sei jederzeit dogmatisch. In kritischer philosophischer Prüfung seine trüben unkritischen Quellen offenzulegen, diene der Klärung und Sicherung der Moralität des Menschen.
(2) Nun haben, was »die praktische Erweiterung der reinen Vernunft« und den »notwendigen praktischen Gebrauch der Vernunft« betrifft, in seinem zeitlichen Entdeckungs- und sachlichen Begründungsgang für Kant nicht alle der drei genannten Annahmen den gleichen Stellenwert. In einem Brief an Christian Garve vom 21. September 1798 sieht Kant sich veranlasst, falschen Darstellungen seines philosophischen Weges entgegenzutreten:
»Nicht die Untersuchung vom Dasein Gottes, die Unsterblichkeit etc. ist der Punkt gewesen, von dem ich ausgegangen bin, sondern die Antinomie der r.V.: ›Die Welt hat einen Anfang –: sie hat keinen Anfang etc. bis zur vierten: Es ist Freiheit im Menschen, – gegen den: es ist keine Freiheit, sondern alles ist in ihm Naturnotwendigkeit‹; diese war es, welche mich aus dem dogmatischen Schlummer zuerst aufweckte und zur Kritik der Vernunft selbst hintrieb, um das Skandal des scheinbaren Widerspruchs der Vernunft mit ihr selbst zu heben« (AA XII, 257).
Freiheit ist für die Moralität des Menschen schlechthin konstitutiv. Der »Skandal des scheinbaren Widerspruchs der Vernunft mit ihr selbst« besteht hier darin, dass es vernünftig erscheint, den Menschen in seinem Verhalten einerseits (wie alle Naturwesen) als prädeterminiert, andererseits (wie alle Vernunftwesen) als verantwortlich und frei zu betrachten. Die Auflösung des dritten Widerstreits der Antinomie ist demnach von eminenter anthropologischer und ethischer Tragweite. Sie ist es, die Kant »zur Entwicklung einer vernunftkritisch abgesicherten Metaphysik [nötigte]« (Falkenburg, Brigitte 2000, 261). Dies ist der Grund, warum Kants Bestimmung menschlicher Freiheit im Folgenden (Kap. V und VI des Buches) ein relativ breiter Raum gewährt wird. Seine Diskussion des vermeintlich strikt erfahrungswissenschaftlich (oder auch pantheistisch bzw. allmachtstheologisch) ausgelösten Determinismusproblems und die diesbezügliche Auflösung des scheinbaren Widerspruchs der Vernunft mit ihr selbst scheinen mir nach wie vor beispielhaft zu sein. Kant entwickelt einen starken meta-physischen Freiheitsbegriff im Sinne der Fähigkeit des Menschen, sein Verhalten unabhängig von allen Determinanten seiner vorgegebenen sinnengebundenen Natur und Lebenswelt nach Gesichtspunkten der Vernunft selbst zu bestimmen. In diesem Rahmen steht dann auch seine umstrittene, vielfach als inkonsistent oder abwegig beurteilte Theorie des radikal Bösen im Menschen. Seine Theorie, so meine These in Kap. IX des Buches, übersetzt die christliche Lehre von der Erbsünde in eine völlig säkulare Ethik und Anthropologie. Und sie erweist sich als in sich völlig konsistent, wenn man die verschiedenen Perspektiven (der verstandesgemäßen Erklärung und der vernunftgemäßen Beurteilung) beachtet, unter denen Kant vom menschlichen »Hang zum Bösen« spricht.
(3) Es gibt in der Kantforschung eingefahrene Interpretationsdogmen, die häufig wiederholt und selten in Frage gestellt werden. Ein erstes betrifft die Frage, inwiefern der Unglaube an Gott und Unsterblichkeit der »Moralität widerstreiten« soll. Sie scheint an die zentrale kantische Idee der Autonomie zu rühren: Die unbedingte Geltung des Sittengesetzes verdanke sich der Selbstgesetzgebung menschlicher Vernunft; der objektive Sinn des kategorischen Imperativs für den Menschen sei demnach ganz unabhängig vom reinen Vernunftglauben (und könne diesen sehr wohl entbehren). So eine verbreitete Interpretationsmeinung, der allerdings Kants ausdrückliche Aussagen zu widersprechen scheinen, Moralität führe unausbleiblich zur Religion (Rel. AA VI, 8 Anm.), ja, das moralische Gesetz wäre »an sich falsch«, wenn das höchste Gut unmöglich wäre (KpV AA V, 114). Ein praktisches Gesetz ist bekanntermaßen »an sich falsch«, wenn es jemandem etwas zu befolgen und durch seine Befolgung zu bewirken gebietet, was an sich unmöglich ist. Nun gebietet das moralische Gesetz dem Menschen (als sinnlich-vernünftigem Weltwesen), dass »jedermann sich das höchste in der Welt mögliche Gut zum Endzwecke machen solle« (Rel. AA VI, 8 Anm.). Zugleich weiß der Mensch (als Einzelner und im Kollektiv), dass er auf die Verwirklichung des Endzwecks zwar hinarbeiten und zu ihr beisteuern kann, dass aber »das Menschenvermögen dazu nicht hinreicht« (Rel. AA VI, 8 Anm.). Das höchste Gut, das heißt der von der Vernunft in ihrem Verlangen nach vollendeter Gerechtigkeit geforderte notwendige Zusammenhang von Glückswürdigkeit und Glück des Menschen, bleibt in seiner Lebens- und Erfahrungswelt zweifelsfrei kontingent. Vernunft muss deshalb die Garantie seiner endgültigen Verwirklichung in ein »allvermögendes moralisches Wesen als Weltherrscher« (ebd.) setzen (vgl. dazu auch Dörflinger, Bernd 2004).
Kant hat, dies sollen die Kapitel II, III und IV des Buches eingehend belegen, vom Beginn seiner Überlegungen zur praktischen Philosophie um die richtige Bestimmung des Verhältnisses von Tugend bzw. Moralität und Glückseligkeit des Menschen gerungen. Er schließt da, wie vor allem der handschriftliche Nachlass (und der Beginn der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) zeigt, bewusst an die Ethik der Griechen mit ihrer Theorie vom höchsten Gut an. Für eine gewisse Zeit seiner sogenannten vorkritischen Phase scheint er auch die Antwort im Sinne der akademisch-peripatetischen Theorie (wohl unter dem Einfluss seiner Cicero-Lektüre) favorisiert zu haben, bis er schließlich den Gedanken des selbstbewirkten Tugendglücks verwirft und (wohl unter dem Einfluss christlicher Anthropologie und des zeitgenössischen Empirismus und Sensualismus) der Lehre der zentralen Figur des alttestamentlichen Buches Hiob und (vor allem) der Lehre Jesu, des »Weisen des Evangeliums«, beipflichtet.
Ein zweites, mit dem erstgenannten zusammenhängendes Interpretationsdogma besagt, dass Kants (kritische) Ethik ausschließlich die Achtung vor dem Gesetz als authentisches Motiv moralisch guten Handelns kennt. Ich möchte dieser Meinung mit der These widersprechen, dass Kants (kritische) Ethik von ihrer frühen Konzeption bis zuletzt eine zwiefältige Triebfeder moralischen Handelns in Ansatz bringt. Im Kapitel VIII wird eingehend dafür argumentiert, dass nicht nur das Gefühl der Achtung vor dem (kategorisch gebietenden) moralischen Gesetz, sondern auch die im reinen Vernunftglauben gegebene zuversichtliche Hoffnung auf das höchste Gut nach Kant notwendiges (und beides im Verein notwendiges und zureichendes) Motiv vernünftigen menschlichen Handelns ist.
(4) Theologie und Religion begründen nicht Moralität. Doch Moralität führt nach Kant aufgrund eines unabweisbaren »Bedürfnisses« praktischer Vernunft »unausbleiblich« zur Religion und, philosophisch gesehen, zur Theologie. Die Kapitel X, XI und XII sind im Detail Kants Begriff des Glaubens, seinem Gottesbild und seiner Auffassung von Kirche als einer Tugendgemeinschaft gewidmet. Wenn Kant erklärt, dass (vernünftiges) Glauben »dem Grade nach keinem Wissen nachsteht, ob es gleich der Art nach davon völlig verschieden ist« (Was heißt: Sich im Denken orientieren?, AA VIII, 141), dann folgt er hier einer schulphilosophischen Tradition, die bis ins hohe Mittelalter zurückreicht. Allerdings bezieht sich seine Aussage nicht auf einen historisch begründeten Offenbarungsglauben, sondern einzig auf einen »moralischen« Glauben. Die Gewissheit dieses Glaubens ist durch keine externe Autorität vermittelt, sondern stützt sich allein auf die existentiell überragende, sich selbst genügende Evidenz des je eigenen (und als allgemein unterstellten) moralischen Bewusstseins. Die Normen dieses Bewusstseins bieten denn auch den Maßstab der Konstruktion der Gottesidee. Als Vorlage dieser Idee dienen Kant die zentralen Dogmen der christlichen Religion. Auf klassisch allegorische Weise interpretiert er sie auf einen strikt monotheistischen Gottesbegriff hin, der als personifiziertes Ideal die Prädikate der Allmacht, der Allwissenheit und Allgüte bzw. Allgerechtigkeit in sich vereint und die Gewähr vollkommener Verwirklichung des höchsten Guts »in einer anderen Welt« bietet. Die historische Person Jesu wird zum Ideal moralischer Vollkommenheit des Menschen stilisiert. Die Kirche als Tugendgemeinschaft, die den einzelnen Staat als Rechtsgemeinschaft stützt und im Blick auf die ihr allein zustehende gemeinschaftliche Pflege innerer Freiheit »ergänzt«, hat durch ihre aufgeklärten Lehrer und Vorsteher die (absolute) Bindung der Gläubigen an historische Dogmen und statutarische Observanzen zu lockern und zu lösen und auf das Ziel einer universalen moralischen Gemeinschaft der Menschen hinzuwirken.
(5) » [E]ine Metaphysik der Sitten kann nicht auf Anthropologie gegründet, aber doch auf sie angewandt werden« (MdS AA VI, 217). Die explizite und ausführliche Anwendung reiner, für alle vernünftigen Wesen kraft ihrer autonomen Vernunft gültigen Gesetze auf den Menschen (als sinnlich-vernünftiges Weltwesen) nimmt Kant in der Rechts- und Tugendlehre (für die Bereiche seiner äußeren und inneren Freiheitsgestaltung) vor. Der Darstellung, Analyse und Kritik des kantischen Anwendungsverfahrens und seiner Probleme (bis »hinab« zu konkreten Gebots- und Verbotsnormen und noch zum Teil durchaus traditionell teleologisch bestimmten rechtlichen und moralischen Festlegungen) sind die Kapitel VII, XIII und XIV, in gewisser Weise auch das Kapitel XII gewidmet. Dabei zeigt sich, dass Kants »intelligible« moralische Weltordnung das Element des sittlich Tragischen und damit auch die objektive Möglichkeit veritabler moralischer Konfliktsituationen ausschließt. Sie dürfte denn auch für seinen Rigorismus bezüglich bestimmter strikter Verbote (des Suizids, der Lüge etc.) verantwortlich zeichnen. Ja, selbst seine entschiedene Vergeltungstheorie der Strafe ist, wie ich in Kap. XIV (entgegen einer neuerlich vertretenen prominenten nicht-vergeltungstheoretischen Interpretation seiner Straftheorie) nachzuweisen versuche, ohne seine Theorie des höchsten Guts nicht zureichend zu verstehen.
(6) Das Ziel sämtlicher Studien des Buches ist es, unsere Sicht auf das metaphysische Profil der Philosophie Immanuel Kants aus zum Teil ungewohnter Perspektive und Zugangsweise zu schärfen. Dabei liegt ihr Schwerpunkt auf dem richtigen Verständnis seiner Verhältnisbestimmung von Moralität, Recht und Vernunftglaube bzw. Religion. Kant war, wie er selbst einmal bekennt (Träume eines Geistersehers, AA II, 367 f.) und durch all seine Schriften eindringlich bekundet, zeit seines Lebens, wenn auch in einer kurzen skeptischen Phase nicht so ganz glücklich, »in die Metaphysik verliebt«. Sein gesamtes kritisches Unternehmen gilt der Grundlegung und Entfaltung einer sicheren und überzeugenden Metaphysik des menschlichen Erkennens, Urteilens und Handelns. Das erste Kapitel des Buches soll dies, als Einleitung zum dann Folgenden, illustrieren. Das Grundanliegen kantischen Philosophierens scheint mir zu verfehlen, wer ihn, in traditionalistischer metaphysischer Einstellung, zum »Zertrümmerer der Metaphysik«, aber auch, wer ihn, auf »moderne«, zeitdiagnostische Weise, zu einem Pionier »nachmetaphysischen« Denkens machen möchte. Man muss Kants philosophisches Anliegen nicht teilen und seine Durchführung nicht (in allem) gutheißen. Es gibt sehr wohl plausible, stärker der Phänomenologie der (zwischen-)menschlichen Erfahrung und dem modernen Naturverständnis verbundene philosophische Alternativen zu seinem auf das Nichtempirische im Empirischen, auf eine abstrakt-apriorische Vernunft-Basis von Moralität und auf ein noch frühmodernes Weltbild zentrierten Selbst- und Weltverständnis. Doch die Aufgabe und der Versuch der Interpretation eines Klassikers der Philosophiegeschichte scheinen mir nicht überholt zu sein: ihn in seinem großartigen, in vielem Maßstäbe setzenden und wegweisenden Werk möglichst so zu verstehen, wie er sich selbst verstanden und geäußert hat. Einer kritischen Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas’ jüngster Kantinterpretation ist deshalb das Schlusswort des Buches gewidmet.
Sämtliche Kapitel des Buches sind so geschrieben, dass sie auch (dem Lesen und Studium dienlich) separat gelesen und verstanden werden können. Als Preis dafür habe ich gelegentliche Wiederholungen (insbesondere von wichtigen Kant-Zitaten) in Kauf genommen.
Der Kollegin Gisela Schlüter (Erlangen) und den Kollegen Rudolf Langthaler (Wien) und Wolfgang Ertl (Tokio) danke ich für wertvolle Hinweise, Einwände und Gesichtspunkte. Ohne den Austausch mit ihnen hätte das Buch nicht die Form, die es jetzt gefunden hat. Für die zweifellos verbliebenen Mängel bin ich natürlich selbst verantwortlich.
Gewidmet ist das Buch meiner Familie.
Erlangen, im November 2020