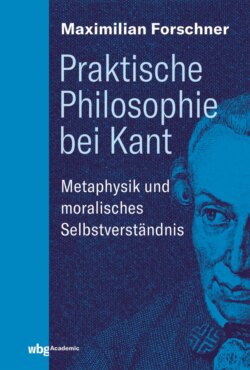Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Die Metaphysik der »Schule« und die Metaphysik des »einfachen Menschen«
ОглавлениеReine Mathematik und reine Naturwissenschaft erfüllen für Kant eine Brückenfunktion zum Verständnis und zur Beantwortung der Frage, wie Metaphysik als Wissenschaft möglich ist. Die Ausgangssituation für die Beantwortung der Frage, wie Metaphysik möglich sei, sieht grundsätzlich anders aus als jene für reine Mathematik und reine Naturwissenschaft. Sind diese anerkannte wissenschaftliche Disziplinen, so gibt jene durch ihren bisherigen schlechten Fortgang allen Anlass, »einen jeden mit Grund an ihrer Möglichkeit zweifeln zu lassen«56. Die Metaphysiker der philosophischen Schulen liegen miteinander in beständigem Streit, der sich allem Anschein nach nicht mit zwingenden Vernunftargumenten beilegen lässt. Andererseits, so Kant, ist Metaphysik zwar nicht als wissenschaftliche Disziplin, wohl aber als »Naturanlage« wirklich und in der Aktualisierung dieser Naturanlage wohl auch nicht aus der Welt zu schaffen.
»Denn die menschliche Vernunft geht unaufhaltsam, ohne dass bloße Eitelkeit des Vielwissens sie dazu bewegt, durch eigenes Bedürfnis getrieben bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können, und so ist wirklich in allen Menschen, sobald Vernunft sich in ihnen zur Spekulation erweitert, irgendeine Metaphysik zu aller Zeit gewesen, und wird auch immer darin bleiben.«57
Ein der Vernunft eigenes Bedürfnis macht Metaphysik als Naturanlage möglich und zu aller Zeit, wenn Menschen einmal ihre Vernunft kultiviert und theoretisch zu denken begonnen haben, wirklich. Kant weiß sich mit diesen Gedanken in einer langen Tradition philosophischer Interpretation des menschlichen Selbstverständnisses: Vernunft greift aus nach dem Unbedingten. Sie sucht den Abschluss, die Totalität der Bedingungen in der Erklärung der Phänomene der äußeren und inneren Welt, und sie sucht die Totalität der Bedingungen eines sinnvollen Selbstverständnisses im Verlangen nach persönlichem Glück und nach Gerechtigkeit in der Welt. Solches Ausgreifen der Vernunft übersteigt den Rahmen möglicher Erfahrung, der uns Menschen schon durch die Struktur von Raum und Zeit als formalem Bedingungsgefüge möglicher materialer Erfahrung und durch die begrenzte zeitliche Dauer unseres Daseins gezogen ist.
Kant zentriert dieses Ausgreifen der Vernunft auf das Unbedingte thematisch in der Vorrede B in der dreigliedrigen Formel »Gott, Freiheit und Unsterblichkeit«.58 Um diese Themen bemüht sich der gemeine Menschenverstand, um sie bemühen sich die Philosophen. Viele der Letzteren versuchen Gott, Freiheit und Unsterblichkeit mit subtilen theoretischen Argumenten zu beweisen, die Unsterblichkeit etwa über den Gedanken der Einfachheit der Seelensubstanz oder das Dasein Gottes über den Begriff eines allerrealsten bzw. eines vollkommenen Wesens.59
Diese Beweise erleiden ein zweifaches Schicksal: Sie übersteigen in ihrer spekulativen Subtilität die Fassungskraft des breiten Publikums, und sie rufen stets ähnlich starke und subtile theoretische Argumente der professionellen Gegner auf den Plan. Dieses Schauspiel der Philosophen besitzt, da die Themen das menschliche Selbstverständnis in seinem Kern berühren, für das breite, inzwischen (d. h. zu Kants Zeit) ja schon weitgehend zum Lesen befähigte Publikum alle Züge eines Skandals. Um »dem Skandal vorzubeugen, das über kurz oder lang selbst dem Volke aus den Streitigkeiten aufstoßen muss, in welche sich Metaphysiker […] verwickeln«,60 sieht Kant eine zweifache Strategie geboten: einmal eine »professionelle«, das heißt philosophisch durchdringende Prüfung, eine Kritik der Möglichkeiten und Grenzen theoretischer Vernunftleistungen, die, wie er sagt, die elitäre Anmaßung und »den lächerlichen Despotismus der Schulen«61 auf ihrem eigenen wissenschaftlichen Niveau ein für allemal bricht, und zum anderen eine Kultur der »allgemein fasslichen und in moralischer Hinsicht hinreichenden Beweisgründe«,62 die der »jedem Menschen bemerkliche[n] Anlage seiner Natur«63 zu metaphysischen Fragen entsprechen.
Kant deutet in der Vorrede B in kurzen, prägnanten Worten diese Anlage und die »in moralischer Hinsicht hinreichenden Beweisgründe« nur an, die dann in der Kritik der praktischen Vernunft, der Kritik der Urteilskraft und der Religionsschrift ihre argumentative Ausgestaltung (und »schulgerechte« Vertiefung) erfahren.
So führt einmal die Anlage unserer Natur, »durch das Zeitliche (als zu den Anlagen seiner ganzen Bestimmung unzulänglich) nie zufriedengestellt werden zu können« zur »Hoffnung eines künftigen Lebens«. So führt zweitens unsere »Anlage zur Persönlichkeit«64 über »die bloße klare Darstellung der Pflichten im Gegensatze aller Ansprüche der Neigungen« zum »Bewusstsein der Freiheit«. So führt schließlich unser Sinn für Ordnung, Schönheit und Zweckmäßigkeit im Blick auf »die herrliche Ordnung, Schönheit und Fürsorge, die allerwärts in der Natur hervorblickt«, zum »Glauben an einen weisen und großen Welturheber«.65
Und Kant deutet in ebenso kurzen, prägnanten Worten die Legitimationsquelle an, durch die der menschlichen Vernunft – obgleich ihr die theoretische Erkenntnis von Totalität und Unbedingtem in der Erfahrungswirklichkeit verwehrt ist, gleichwohl auf der Basis praktischer Erkenntnis und Bejahung von Unbedingtem – eine theoretische Bestimmung von Übersinnlichem im Sinne eines reinen Vernunftglaubens bezüglich Gott, Freiheit, Weltganzem, Substantialität und Unsterblichkeit der Seele möglich ist. »Nun bleibt uns immer noch übrig, nachdem der spekulativen Vernunft alles Fortkommen in diesem Felde des Übersinnlichen abgesprochen worden, zu versuchen, ob sich nicht in ihrer praktischen Erkenntnis Data finden, jenen transzendenten Vernunftbegriff des Unbedingten zu bestimmen, und auf solche Weise, dem Wunsche der Metaphysik gemäß, über die Grenze aller möglichen Erfahrung hinaus mit unserem, aber nur in praktischer Absicht möglichen Erkenntnisse a priori zu gelangen.«66
Diese »in praktischer Absicht«, das heißt auf der Basis und im Sinne eines moralischen Selbstverständnisses, möglichen Erkenntnisse a priori bilden für sich betrachtet eine schlichte, allen normalsinnigen Menschen fassliche Metaphysik. Der Besitz der sie definierenden Überzeugungen im Sinne kanonischer Dogmen eines reinen Vernunftglaubens bleibt durch das subtile philosophische Geschäft einer durchdringenden Kritik nicht nur »ungestört, sondern er gewinnt vielmehr dadurch noch an Ansehen, dass die Schulen nunmehr belehrt werden, sich keine höhere und ausgebreitetere Einsicht in einem Punkte anzumaßen, der die allgemeine menschliche Angelegenheit betrifft, als diejenige ist, zu der die große (für uns achtungswürdigste Menge) auch eben so leicht gelangen kann«.67 Die genannten metaphysischen Überzeugungen des »einfachen Menschen« – Jean-Jacques Rousseau hat dies Kant in den 60er Jahren beigebracht – sind von subtiler philosophischer Spekulation unabhängig und müssen gegen diese durch strenge wissenschaftliche Kritik und durch eine Kultur der allgemeinen Menschenvernunft geschützt werden.
Strenge wissenschaftliche Kritik bzw. kritische Metaphysik ist allerdings dringend erforderlich, um der Verführung »einfacher« Menschen vorzubeugen und der Aufklärung irregeführter Menschen dienlich zu sein. »Es ist eine herrliche Sache um die Unschuld, nur es ist auch wiederum sehr schlimm, dass sie sich nicht wohl bewahren lässt und leicht verführt wird. Deswegen bedarf selbst die Weisheit – die sonst wohl mehr im Tun und Lassen, als im Wissen besteht – doch auch der Wissenschaft, nicht um von ihr zu lernen, sondern ihrer Vorschrift Eingang und Dauerhaftigkeit zu verschaffen.«68
Fassen wir zusammen: Die Frage »Wie ist Metaphysik als Naturanlage möglich?« ist zu beantworten über eine Erklärung, wie metaphysische Fragen ganz unausweichlich »aus der Natur der allgemeinen Menschenvernunft« entspringen.69 Sie entspringen, so die hier nur plakativ zu gebende Antwort, aus dem (legitimen, ja durch sie selbst bedingten) Totalitätsverlangen der Vernunft, alles zu erkennen, immer zu sein und mit dem Leben und der Welt im Ganzen einverstanden zu sein. Vielleicht hat Thomas von Aquin in seiner Summa contra Gentiles diesem Totalitätsverlangen menschlicher Vernunft und seiner notwendigen Enttäuschung im zeitlichen Dasein den philosophisch überzeugendsten Ausdruck verliehen.70
Vernunft verwickelt sich – so Kants durch die religiösen und philosophischen Weltanschauungskämpfe der frühen Neuzeit und der Aufklärung, durch den philosophischen Rationalismus, den Empirismus und die philosophische Skepsis gleichermaßen geschulte und belehrte Einsicht –, als rein theoretische Vernunft im Überstieg über den Bereich möglicher menschlicher Erfahrung, sei es im Rahmen des Alltagsverstandes, sei es im Rahmen schulmäßiger Philosophie, bei der Beantwortung metaphysischer Fragen in unvermeidliche und unauflösliche Widersprüche. Das Bedürfnis einer überzeugenden Auflösung dieser Widersprüche führt zur Frage, wie Metaphysik als Wissenschaft möglich ist.
Die Antwort lautet: Sie ist zum einen möglich auf dem Weg der Kritik der Leistungsfähigkeit des gesamten menschlichen Erkenntnisvermögens mit dem Ergebnis einer transzendentalphilosophisch geläuterten und vermittelten Metaphysik der Erfahrungserkenntnis und der Natur, die zugleich eine Lehre von den »bestimmten und sicheren Schranken« rein spekulativer Vernunfttätigkeit darstellt. Metaphysik als Wissenschaft ist zum anderen möglich als Prinzipienforschung und Prinzipienwissenschaft auf der Basis und im Ausgang vom moralischen Bewusstsein des »einfachen Menschen« bzw. des allgemeinen sittlichen Bewusstseins. Das heißt, sie ist möglich im Sinne der dialektischen Erhebung und genauen Analyse der Grundbegriffe und Grundsätze dieses Bewusstseins einerseits und der präzisen und schlüssigen Argumentation für einen Kanon positiver Überzeugungen eines reinen Vernunftglaubens bezüglich erfahrungstranszendenter Sachverhalte andererseits, für einen Kanon von unverzichtbaren theoretischen Annahmen, die die Vernunft unseres moralischen Selbstverständnisses in praktischer Absicht als gegeben und erfüllt postuliert, die sich »auf allgemein fassliche und in moralischer Hinsicht hinreichende Beweisgründe« stützen und die den Anlagen und dem Interesse unserer Natur als eines vernünftigen moralitätsfähigen und glücksbedürftigen Sinnenwesens entsprechen.
Es wirkt immer noch nach, dass Vertreter des Neukantianismus Kants positive Metaphysik der gemeinen Menschenvernunft, die er in Form von theoretischen Postulaten des praktisch-moralischen Selbstverständnisses, als unverzichtbare Überzeugungen eines reinen Vernunftglaubens formuliert, schlicht ignorierten und Kants Kritik der reinen Vernunft auf eine Prinzipientheorie der Mathematik und exakten Naturwissenschaft reduzierten. Ein kleines, aber doch sprechendes Zeichen des (vielleicht gar unbewussten) Nachwirkens dieser Tradition mag sein, dass ein gewichtiger Textkommentar zur Einleitung in die KrV mit Scharfsinn und penibler Genauigkeit auf das Verständnis von Kants Formel »Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?« eingeht, doch dann Kants Bemerkungen über Metaphysik als Naturanlage schlicht übergeht und den Passus der Einleitung ab B 21 ganz einfach unkommentiert lässt.71
1 Vgl. dazu Beiser, Frederick C. 1992.
2 Träume eines Geistersehers, AA II, 367 f.
3 AA X, 56.
4 KrV B 27.
5 Vgl. KrV B XXXVII.
6 Zitiert nach Vorländer, Karl 1963, XIV.
7 KrV B XLIV.
8 KrV B XXXVIII f. Kant spricht, was die Unterschiede bezüglich der ersten und der zweiten Auflage der KrV betrifft, lediglich von »Abänderungen der Darstellungsart«. Ich halte mich im Folgenden im Wesentlichen an diese Selbstauskunft und sehe jedenfalls dort als Interpret keine nennenswerte systematische Positionsänderung, wo Kant den Text der ersten Auflage in der zweiten Auflage unverändert wieder abdrucken ließ. Kant in dieser Frage eine bewusste Täuschung seiner Leser zu unterstellen, verbietet sich mir von selbst. Andernfalls müsste ich Kant unterstellen, er habe wichtige Änderungen seiner Position selbst nicht wahrgenommen, und der etwas problematischen hermeneutischen Maxime folgen, ihn entschieden besser zu verstehen als er sich selbst verstanden hat. Dies betrifft für den Kontext meiner Studie vor allem die Skizze der praktischen Philosophie in der transzendentalen Methodenlehre. Dies besagt freilich nicht, dass er während der langen kritischen Phase seines Philosophierens nicht erhebliche Ausdifferenzierungen und Ergänzungen seiner Gedanken und Verbesserungen der Argumente vorgenommen hat.
9 Zitiert nach Vorländer, Karl 1963, XV.
10 Vgl. dazu detaillierter Ina Goy, Stichwort: Kritik der praktischen Vernunft, in: Willaschek, Marcus u. a. (Hgg.) 2015, Kant-Lexikon Bd. 2, 1316.
11 Vgl. Kants Brief an Bering vom 7. April 1786, Vorländer, Karl 1963, XIII.
12 KrV A XXI.
13 Ansätze und Fragmente dazu bietet das Opus postumum.
14 Patzig, Günther 1976, 13.
15 KrV B 3.
16 Vgl. dazu v. a. Cramer, Konrad 1985.
17 KrV A 14/B 28.
18 KrV A 10/B 24.
19 KrV A 11/B 25.
20 KrV A 11/B 24.
21 KrV B 2.
22 KrV B 1 f.
23 Vgl. dazu Prauss, Gerold 31993.
24 KrV A 10 f./B 24.
25 KrV A 11/B 25.
26 KrV A 10/B 24 f.
27 KrV A 10/B 25.
28 KrV B 25.
29 KrV A 11 f.
30 KrV B 25.
31 KrV A 12/B 25 f.
32 Zum Begriff der Synthesis bei Kant (im Vergleich zu Aristoteles) vgl. ausführlich Forschner, Maximilian 1986.
33 KrV B XXII f.
34 KrV B 28 f.; vgl. A 14 f.
35 KrV B 22.
36 Prolegomena, AA IV, 263; 274 f.; vgl. KrV A 10/B 18.
37 Vgl. KrV B 18.
38 Vgl. dazu jetzt Newen, Albert/Horvath, Joachim (Hgg.) 2007.
39 KrV A 5 f./B 9.
40 KrV A 6/B 10.
41 Ebd.
42 KrV B 11.
43 Vgl. dazu Haag, Johannes 2007.
44 KrVA 9/B 13.
45 KrV B 5.
46 Ebd.
47 KrV A 9 f./B 13.
48 KrV B 14.
49 Ebd.
50 KrV B 16.
51 KrV B 21 Anm.
52 KrV B 17; 21 Anm.
53 Ebd.
54 Vgl. Quine, Willard Van Orman 1951; Nimtz, Christian 2004; Müller, Olaf 1998.
55 Vgl. Patzig, Günther 1976, 27.
56 KrV B 21.
57 Ebd.. Wer, wie etwa Jürgen Habermas, gegenwärtiges (und künftiges) Philosophieren geschichtsdiagnostisch als »nachmetaphysisches Denken« charakterisiert, könnte damit im Sinne der Behauptung (miss)verstanden werden, dass gegenwärtiges (und künftiges) Philosophieren sich nicht mehr mit »radikalen« Prinzipienfragen sowie Unbedingtheits- und Totalitätsbehauptungen beschäftigt. Ihm wäre dann wohl am besten mit Kant zu antworten: »Dass der Geist des Menschen metaphysische Untersuchungen einmal gänzlich aufgeben werde, ist ebensowenig zu erwarten, als dass wir, um nicht immer unreine Luft zu schöpfen, das Atemholen einmal lieber ganz und gar einstellen würden« (Prolegomena, AA IV, 367).
58 KrV B XXX.
59 Vgl. KrV B XXXII.
60 KrV B XXXIV.
61 KrV B XXXV.
62 KrV B XXXIII.
63 KrV B XXXII.
64 Vgl. Rel. VI, 26 ff.
65 Vgl. KrV B XXXIII.
66 KrV B XXI.
67 KrV B XXXIII.
68 GMS IV, 404 f.
69 KrV B 21.
70 Vgl. dazu Forschner, Maximilian 2006, 185–207.
71 Cramer, Konrad 1998.