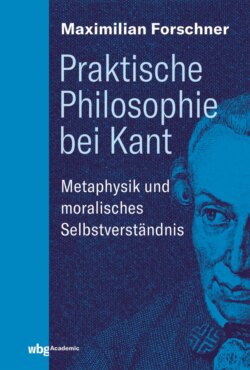Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Das Grundproblem: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?
ОглавлениеDie leitende Aufgabe, die Kant sich mit seiner Kritik stellt, ist die Beantwortung der Frage: »Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich?«35 Und er formuliert auf philosophisch-kunstsprachliche Weise das dabei zu lösende Grundproblem mit der Frage: »Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?«36 Diese Frage zielt nicht auf eine Erklärung, wie wir Menschen dazu kommen, synthetischapriorische Urteile zu fällen. Sie zielt auf die epistemische Berechtigung solcher Urteile. Kant sieht in der Frage der epistemischen Legitimität dieser Urteilsart das zentrale Problem, weil er sieht, dass in der Metaphysik, sei es als bloß versuchter, sei es als wirklicher Wissenschaft, diese Urteilsart notwendigerweise eine, ja die tragende Rolle spielt.37 Und weil er sieht, dass die Transformation überkommener Metaphysik in eine solche mit begründetem Wissensanspruch nur möglich ist, wenn die Legitimitätsfrage bezüglich synthetischer Urteile a priori positiv und im »Wie« überzeugend beantwortbar ist.
Was ist mit der technischen Formel »Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?« näherhin gemeint? Kant unterscheidet analytische von synthetischen Urteilen. Analytische Urteile, so Kant, sind das Ergebnis von
»Zergliederungen der Begriffe, die wir schon haben.38 Dieses liefert uns eine Menge von Erkenntnissen, die, ob sie gleich nichts weiter als Aufklärungen oder Erläuterungen desjenigen sind, was in unsern Begriffen (wiewohl noch auf verworrene Art) schon gedacht worden, doch wenigstens der Form nach neuen Einsichten gleich geschätzt werden, wiewohl sie der Materie oder dem Inhalte nach die Begriffe, die wir haben, nicht erweitern, sondern nur auseinandersetzen.«39
Über die Wahrheit analytischer Urteile kann man durch bloßes Nachdenken entscheiden; die Entscheidung bedarf nicht der Berufung auf Erfahrung.
Kant geht, wie vor ihm schon Platon und Aristoteles, von der logisch-grammatischen Subjekt-Prädikat-Struktur des Satzes als der Fundamentalstruktur eines Aussagesatzes aus: Etwas wird von etwas ausgesagt. In einem solchen Satz wird der Prädikatbegriff zum Subjektbegriff in ein bestimmtes Verhältnis gesetzt bzw. als in einem bestimmten Verhältnis stehend behauptet. Und dieses Verhältnis, so Kant, ist auf zweierlei Art möglich: »Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in diesem Begriff A (versteckterweise) enthalten ist«40 – man könnte auch »technisch« sagen: was Bestandteil des Definiens der Definition von A ist –, »oder B liegt ganz außer dem Begriff von A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem andern synthetisch.«41 Analytisch wäre demnach der Satz »Ein Junggeselle ist unverheiratet«; synthetisch wäre der Satz »Sokrates sitzt«. Das Prädikat des ersten Satzes ist Bestandteil der Definition des Subjektbegriffs. Das Prädikat des zweiten Satzes steht zwar, wie Kant metaphorisch sagt, mit seinem Subjektbegriff »in Verknüpfung«; der Satz behauptet ja, dass dem Sokrates (zum Zeitpunkt tx) das Sitzen zukommt. Aber dies, dass Sokrates (gerade) sitzt, kann nicht durch eine Analyse des Subjektbegriffs erfasst werden. Der Ausdruck »Sokrates« bezeichnet einen bestimmten Menschen. Im Begriff eines Menschen sind zwar die Möglichkeiten des Sitzens, Stehens, Liegens oder Lehnens dieser Art von Körpern enthalten, und diese Möglichkeiten ließen sich in Form analytischer Sätze a priori behaupten. Aber nicht dies ist im Begriff eines Menschen, oder im Begriff eines bestimmten Menschen enthalten, dass er gerade sitzt. Um den Satz »Sokrates sitzt« wahrheitsgemäß behaupten zu können, bedarf es nicht nur der Beherrschung der deutschen Sprache und des Verstehens des Begriffs des Menschen und des Eigennamens »Sokrates«, sondern der Legitimation durch anderes, in unserem Fall letztlich durch sinnliche Erfahrung, die wir und jedermann sonst, bezogen auf den Menschen Sokrates, zum Zeitpunkt tx machen können.
Löst man Kants Erläuterung des Begriffs analytischer Urteile vom Paradigma eines Satzes mit Subjekt-Prädikat-Struktur, so kann man sagen, dass analytisch all jene Sätze sind, über deren Wahrheit allein im Rekurs auf die Regeln der Logik und Semantik einer Sprache entschieden werden kann. Und als synthetisch wären all jene Sätze zu bezeichnen, bei denen dies nicht möglich ist.
Analytische Urteile sind erläuternd, synthetische Urteile sind erweiternd. Zu den synthetischen Urteilen gehören alle sogenannten Erfahrungsurteile.42 In einem Erfahrungsurteil gehen wir über den Begriff, den wir von einem Gegenstand haben, hinaus und erweitern unser Urteil über ihn durch Bestimmungen, von denen wir durch Beobachtung und sinnliche Wahrnehmung des über den vorgängigen Begriff identifizierbaren Gegenstandes Kenntnis erhalten. Erfahrungsurteile sind synthetische Urteile a posteriori. Wie aber, so lautet für Kant die alles entscheidende Frage, sollen synthetische Urteile a priori möglich sein?
Kennzeichen analytischer Urteile ist ihre allgemeine und notwendige Geltung. Kennzeichen synthetischer Urteile a posteriori ist ihre bloß faktische, ihre »zufällige«, ihre kontingente Geltung. Sinnliche Wahrnehmung als Wahrnehmung von Einzelnem, auch wiederholte sinnliche Wahrnehmung als Wahrnehmung von gleichem und ähnlichem Einzelnem legitimiert uns nur, zu sagen, dass etwas einmalig oder regelmäßig so oder so ähnlich der Fall ist, aber niemals, dass es jetzt so oder stets so der Fall sein muss, wie es ist.
Synthetische Urteile a priori sollen nun mit den analytischen den legitimen Anspruch allgemeiner und notwendiger Geltung teilen. Dieser Anspruch kommt ihnen aufgrund ihrer Apriorität zu. Aber gleichwohl sollen sie erweiternd, nicht bloß erläuternd, nicht bloß aus rein logisch-semantischen Gründen wahr sein; sie sollen uns etwas über die (Struktur der) Welt sagen.43
Kants Beispiel eines synthetischen Urteils a priori (es handelt sich übrigens um ein nichtreines synthetisches Urteil a priori) in der Einleitung ist: »Alles, was geschieht, hat seine Ursache.«44 Kants Argument, dass es sich hier um ein synthetisches Urteil a priori handeln muss, ist einmal das Merkmal seines notwendigen und universellen Geltungsanspruchs, mit dem es etwa die Physiker, aber auch der Alltagsverstand gebrauchen, und zum anderen der Gedanke, dass der Begriff der Ursache bzw. des Verursachtseins, genauer, des notwendigen Verursachtseins nicht einer Analyse des Begriffs des Geschehens zu entnehmen ist. Der Begriff des Geschehens impliziert die Zeitvorstellung und die Vorstellung der Veränderung, das heißt die Vorstellung, dass einige Attribute, die einem Gegenstand zum Zeitpunkt t1 zukommen, diesem Gegenstand zum Zeitpunkt t2 nicht mehr zukommen etc. Er impliziert nicht den Gedanken, dass diese Veränderung des Gegenstandes in t2 sich aus dem Zustand des Gegenstandes in t1 und den Randbedingungen, denen er in t1 ausgesetzt ist, nach (sc. empirisch zu eruierenden und validierenden) Verlaufsgesetzen (»notwendig«) ergibt. Dies ist eine Vorstellung, die den Begriff des Geschehens erweitert.
Nun mag dies ja durchaus bei diesem Beispiel zutreffen. Und bis hierher hätte auch ein David Hume der kantischen Interpretation wohl zugestimmt. Die entscheidende Frage ist: Was gibt dem apodiktischen Geltungsanspruch dieses Beispielsatzes seine Berechtigung? Nun, Hume würde sagen, wir werden zu solchem Geltungsanspruch über psychische Assoziationsmechanismen der Erfahrung von Regularitäten verführt. Kants Antwort auf diese Frage ist dagegen die eines Wesenstheoretikers. Sie wird in dem Nachweis bestehen, dass dieser Satz, zusammen mit anderen derartigen Sätzen, das vorgängige Bedingungsgefüge ausmacht, das gelten muss, wenn so etwas wie Erfahrungserkenntnis (etwa im Sinne der Newton’schen Physik, oder auch im Sinne unseres Alltagsverständnisses) überhaupt möglich sein soll. Dieser Satz, so Kant, stellt ein konstitutives Element des wesenhaften und normativen Rahmens aller Erfahrungserkenntnis dar. Das heißt, ich meine mit Erfahrungserkenntnis und kann nur dann veritable Erkenntnis bezüglich eines Gegenstandes der Erfahrung beanspruchen, wenn ich sein Dasein und Sosein nach Kausalgesetzen erklären kann. Dass solche Erklärungen im Alltag meist sehr elliptisch ausfallen, versteht sich von selbst, nimmt aber dem Anspruch nichts von seiner prinzipiellen Valenz. Ereignisse in Raum und Zeit, so Kant, sind nur unter der Bedingung Gegenstand einer theoretischen Erkenntnis und Erkenntnisbemühung, dass sie in einen kausal bestimmten Ereigniszusammenhang eingeordnet werden können.
Kant hat eine Vorstellung vom Wesen der Erfahrungserkenntnis und eine Vorstellung von notwendigen Elementen dieses Wesens. Das Merkmal, dass ein Grundsatz ein Element dieses Wesens ausmacht, ist dies, dass der Satz mit dem Anspruch auf notwendige und ausnahmslose Geltung auftritt und Gewissheit beansprucht wie etwa, schon im Alltagsverstand, das Kausalprinzip (nämlich, dass alles, was geschieht, seine Ursache hat). Gerechtfertigt wird der Grundsatz dann durch den Nachweis seiner »Unentbehrlichkeit zur Möglichkeit der Erfahrung selbst«,45 das heißt durch den Nachweis, dass der Begriff der Erfahrungserkenntnis ohne diesen Grundsatz nicht konsistent und sinnvoll zu denken ist. Solche Rechtfertigung ist nicht auf empirischem Wege möglich. »Denn wo wollte selbst Erfahrung ihre Gewissheit hernehmen, wenn alle Regeln, nach denen sie fortgeht, immer wieder empirisch, mithin zufällig wären; daher man diese schwerlich für erste Grundsätze gelten lassen kann.«46
Kant zieht nun ein Resümee dieser Unterscheidungen und formuliert eine markante These. Das Ziel, das gesamte Ziel unserer spekulativen, das heißt theoretischen Vernunfterkenntnis a priori besteht in der Erkenntnis solcher synthetischen Urteile a priori;47 denn, so die Überschrift eines aus den Prolegomena (§ 2c) in die Einleitung B neu übernommenen Kapitels (V): »In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische Urteile a priori als Prinzipien enthalten.«48
Kant belegt diesen Gedanken durch drei Paradedisziplinen spekulativer Vernunfterkenntnis: die Mathematik, die Physik und die Metaphysik. Urteile der reinen Mathematik, gemeint sind die Sätze der euklidischen Geometrie, der Arithmetik und der Algebra, so Kant, »sind insgesamt synthetisch«.49 Als Beispielsatz für die Arithmetik dient ihm der triviale Satz »7 + 5 = 12«; als Beispielsatz für die Geometrie der Satz, »dass die gerade Linie zwischen zwei Punkten die kürzeste sei«50. Kants Argument ist jeweils, dass die Wahrheit dieser Sätze nicht über eine Zergliederung der in ihnen enthaltenen Begriffe, sondern nur über ein Zusammenspiel von Begriff und (reiner) Anschauung einleuchtet. Ja, mathematische Begriffe enthalten Konstruktionsanweisungen bzw. sind nichts anderes als Regeln der Konstruktion eines Begriffs in der (reinen) Anschauung.
Die Frage also, worauf die legitime Beanspruchung objektiver, ja notwendiger Gültigkeit mathematischer Sätze als synthetischer Urteile a priori beruht, lässt sich so beantworten, dass die hier behaupteten Sachverhalte als (notwendig) bestehende Begriffsverhältnisse anhand einer (jederzeit wiederholbaren) Konstruktion der entsprechenden Begriffe in der Anschauung demonstrierbar sind und sein müssen.
Als Beispiele für synthetische Sätze a priori einer reinen Naturwissenschaft nennt Kant das Trägheitsgesetz51 sowie den Satz, »dass in allen Veränderungen der körperlichen Welt die Quantität der Materie unverändert bleibt«,52 und schließlich den Satz, »dass in aller Mitteilung der Bewegung Wirkung und Gegenwirkung jederzeit einander gleich sein müssen«.53 Es sind dies Sätze, die in der Physik Newtons, in dessen Philosophiae naturalis principia mathematica von 1687, als gültig vorausgesetzt werden, und die, wenn ich recht sehe, zum Teil auch heute noch, etwa in Form des Energieerhaltungssatzes, ihre Gültigkeit beanspruchen. Kant sah es als Tatsache, ja als beweisbare Tatsache an, dass Mathematik und Naturwissenschaft synthetische Urteile a priori, Mathematik nur reine synthetische Urteile a priori, reine Naturwissenschaft auch nichtreine synthetische Urteile a priori enthalten, und dass der Wissenschaftscharakter dieser Disziplinen nicht in Frage steht.
Seine Frage ging deshalb nicht dahin, ob es synthetische Urteile a priori mit legitimem Geltungsanspruch gibt. Sie ging vielmehr dahin, worauf es beruht, dass diese Urteile objektiv gültig sind. Der logische Positivismus des vergangenen Jahrhunderts hat als Quelle veritabler Erkenntnis dagegen nur Logik und Erfahrung anerkannt. Die Möglichkeit synthetischer Sätze a priori wurde von ihm strikt geleugnet: Alle wissenschaftlich seriösen Sätze seien entweder analytisch/a priori oder synthetisch/ a posteriori; tertium non datur.
Die Frage nach Existenz und Berechtigung synthetischer Urteile a priori wird in der Wissenschaftstheorie heute nach wie vor kontrovers diskutiert.54 Klar scheint zu sein, dass alle Naturwissenschaften auf ihrer Prinzipienebene mit synthetisch-apriorischen Annahmen operieren, und dass ihre allgemeinen Gesetzesannahmen durch Erfahrungssätze (vorläufig) bestätigt oder (definitiv) widerlegt, nicht aber begründet werden können. Klar scheint auch zu sein, dass die Mathematik ihrerseits von Grundsätzen abhängig ist, die nicht aus der Logik allein zu gewinnen sind.55 Allerdings wird für diese synthetisch-apriorischen Annahmen nicht mehr wie bei Kant Anschauungsevidenz in Anspruch genommen. Ihr Geltungsstatus ist konventionell bzw. rein hypothetisch, nicht apodiktisch und auf Evidenz gegründet.