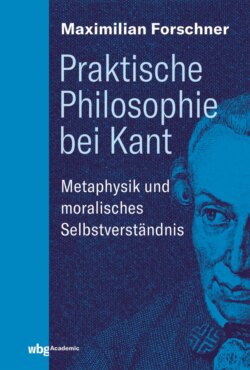Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kants neues Glücksverständnis
Оглавление»Glückseligkeit ist die Befriedigung aller unserer Neigungen, (sowohl extensive, der Mannigfaltigkeit derselben, als intensive, dem Grade und auch protensive, der Dauer nach).«113 Mit diesem inhaltlich ganz und gar empirischen, begriffslogisch als Totalitätsvorstellung überschwänglichen Glücksbegriff der Kritik der reinen Vernunft distanziert sich Kant offensichtlich vom skizzierten Konzept der Reflexionen.114 Wurde dort nach Art hellenistischer, insbesondere stoischer Ethik (moralische) Selbstzufriedenheit zum »Hauptstuhl« der Glückseligkeit erhoben,115 so wird ihre Funktion in der Kritik der praktischen Vernunft zur Andeutung eines bloß »negative[n] Wohlgefallen[s] an seiner Existenz«,116 das heißt der bloßen Existenz als eines moralitätsfähigen Subjekts herabgestuft. Die emotionale Einstellung, die dem moralischen Selbstbewusstsein des Menschen angemessen ist, ist nun die der Achtung vor sich selbst als Person. Diese stellt uns die Erhabenheit unserer Bestimmung vor Augen und schlägt zugleich den Eigendünkel nieder,117 kann deshalb auch nicht als »der mindeste Teil« der Glückseligkeit angesehen werden.118 Das moralische Gefühl pagan-antiken Stolzes ist dem moralischen Gefühl säkularisiert-christlicher Demut gewichen.
Kant zerschneidet also das enge Band, das er im vorgestellten Konzept der Reflexionen zwischen Moralität und Glückseligkeit gezogen hat. Warum er dies tut, lässt sich keiner direkten Argumentation im Nachlass entnehmen. Aber es gibt deutliche Hinweise, welche Einflüsse ihn zu seinem Schritt bewogen haben. Es sind dies, im eigenartigen Zusammenspiel, materialistische Aufklärungsanthropologie (was den irdischen Glücksbegriff betrifft) und christliche Heilslehre (was das Moralitätsverständnis betrifft).119
Aus Reflexionen, die bis in die Anfänge seiner Beschäftigung mit praktischer Philosophie zurückreichen, wird deutlich, dass Kant in seiner Typologie alternativer Lebensideale zunächst dem Ideal griechischer Weltweisheit zugeneigt war.120 Literarische Orientierung bietet ihm da vor allem Ciceros Darstellung der stoischen und altakademisch-peripatetischen Bestimmung des Lebensziels und dessen Gegnerschaft zu Epikur.121 Besonders stark wirkte auf ihn die schulische Seneca-Lektüre, die er auch in späteren Jahren kontinuierlich fortgesetzt hat. Ab Mitte der 70er Jahre mehren sich dann Empfehlungen zur Demut.122 Nun rückt das christliche Ideal der Heiligkeit in den Vordergrund.123 Dem »Lehrer des evangelii« wird mit Nachdruck recht gegeben in der Meinung, dass die zwei Prinzipien des Verhaltens, Tugend und Glückseligkeit,124 verschieden und ursprünglich sind, dass die Verknüpfung von beidem nicht in der Natur dieser Welt liege, dass man sie jedoch für ein anderes Leben getrost glauben dürfe,125 und dass die natürliche Tugend ebenso wie das natürliche Glück stets ergänzungsbedürftig bleiben.126 Die »gravitätische Würde« der Stoa127 wird nun zur paulinischen »Torheit dieser Welt«,128 das heißt zum verblendeten Stolz und Eigendünkel, der »den guten Geist« der reinen Gesinnung und damit den sittlichen Fortschritt verhindert.129 Kants neues Glücksverständnis gibt der Sinnlichkeit des Menschen jetzt ein Gewicht, wie dies zuvor nur die philosophisch verfemte Tradition des Hedonismus tat. Glückseligkeit als die Summe der Befriedigung aller unserer Neigungen verstanden – das ist genau die Eudaimonie-Formel Aristipps, der vom σύστημα ἐκ τῶν μερικῶν ἡδονῶν gesprochen hat.130 Kant findet dieses Konzept bei den Zeitgenossen La Mettrie und Helvétius vertreten.131 Er übernimmt es und versucht zugleich kritisch nachzuweisen, dass es zwar ein unabweisbares Ziel des Menschen beschreibt, aber nicht zur sicheren Richtschnur seines Verhaltens in dieser Welt taugt: Weder lassen sich aus dieser »schwankenden Idee«132 verlässliche Verhaltensregeln ableiten, noch zeigt Erfahrung, dass wir sonderlich erfolgreich sind, wenn unsere Vernunft sich primär »mit der Absicht auf den Genuss des Lebens«133 beschäftigt. Ja, wie Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten argumentieren wird: Theoretisch vertretener und praktisch gelebter Hedonismus führe in den Selbsthass einer Vernunft, die das reflexionslose Glück animalischen Daseins ruiniert.
1 Die Reflexionen haben eindeutig »vorläufigen Charakter«; sie dokumentieren einen Selbstverständigungsprozess; vgl. Bojanowski, Jochen 2006, 19. Zu Editionsgeschichte und Editionsbeurteilung der Briefe und des handschriftlichen Nachlasses (in der Akademie-Ausgabe) siehe Stark, Werner 1993.
2 Inwiefern dieser Satz der Modifikation durch den ergänzenden Verweis auf das Motiv der Hoffnung auf die Verwirklichung des höchsten Guts bedarf, siehe unten Kap. VIII.
3 Im Anschluss etwa an Tugendhat, Ernst 1984 und Patzig, Günther 1971. Diese (im deutschsprachigen Bereich einflussreichen) Autoren stehen mehr in der ethischen Tradition von David Hume und John Stuart Mill als von Kant, versuchen allerdings, kantische Aspekte von Moralität in ihr nicht-metaphysisches Konzept von Ethik zu integrieren. Im Anschluss an Hegel, Marx, die Linkshegelianer und Theoreme moderner Sprachphilosophie versucht auch Habermas, Jürgen 2019, Motive kantischer Ethik in sein »nachmetaphysisches« Konzept kommunikativer Ethik zu transferieren.
4 Im Ganzen ist freilich die Affinität Kants zur hellenistischen Philosophie, zu Stoa, Epikureismus und Skepsis weitaus stärker als zu Platon und Aristoteles. Genauere Textkenntnis besitzt er von Cicero und Seneca; vieles ist ihm aus der Schule sentenzenhaft präsent; vieles schöpft er aus zeitgenössischen Lehrbüchern (Brucker, Gentzken, Büsching, Formey). Für die Ausbildung seiner Ethik, vielleicht auch für sein Konzept der Naturteleologie der KdU war die Stoa (und in so gut wie keiner Weise Aristoteles) von besonderer Bedeutung. Zu den Details bezüglich der drei großen Kritiken vgl. die eingehende Studie von Santozki, Ulrike 2006.
5 Die Vorstellung einer auffallenden Ähnlichkeit bzw. Parallelität zwischen kritischer Transzendentalphilosophie und Moralphilosophie, von der Kant in einer Vorarbeit zu seinen Prolegomena mit gewissem Entdeckerstolz spricht, scheint hier stärker gedacht zu sein, als sie sich dann für ihn in den publizierten moralphilosophischen Schriften realisieren lässt. Vgl. dazu die Ausgabe der Prolegomena, Phil. Bibl. Meiner Bd. 40, 1957, Beilage I, 156–166, 165.
6 Die von mir herangezogenen Reflexionen sind sämtlich dem Band XIX von Kants gesammelten Schriften der Akademie-Ausgabe, Berlin und Leipzig 1934 entnommen. R. bezieht sich auf die Reflexionsnummer, S. auf die Seiten- und Z. auf die Zeilenzahl.
7 R. 7196, S. 270, Z. 7–8.
8 R. 7197, S. 270, Z. 19–20.
9 R. 7199, S. 273, Z. 8–9.
10 R. 7202, S. 276, Z. 30–32.
11 So wie sie in Alexander Gottlieb Baumgartens Initia Philosophiae Practicae, Halae Magdeburgica 1760, Sectio VII-X lehrbuchgerecht dargestellt ist.
12 Etwa R. 7202, S. 281, Z. 11.
13 Vgl. R. 7220, S. 289, Z. 9–10.
14 R. 7178, S. 265, Z. 11–12; vgl. R. 7150, S. 258.
15 R. 6593, S. 99, Z. 1–2.
16 R. 6593, S. 98 f.
17 Vgl. R. 7248, S. 294; R. 7199, S. 272.
18 R. 7199, S. 272, Z. 13–15.
19 R. 7197, S. 271, Z. 24–25.
20 Zu den Quellen von Kants anthropologischen Überlegungen siehe Brandt, Reinhard 1999.
21 R. 7199, S. 272, Z. 31.
22 R. 7200, S. 274, Z. 12–13.
23 R. 7202, S. 276, Z. 25.
24 R. 7245, S. 293, Z. 26–29.
25 R. 7248, S. 294, Z. 8: »Die Freiheit hat Würde wegen ihrer Unabhängigkeit.«
26 Der Mensch hat sich selbst »als ein frei handelndes Wesen und zwar dieser Independenz und Selbstherrschaft nach zum vornehmsten Gegenstand« (R. 7199, S. 272, Z. 21–23).
27 R. 6618, S. 112, Z. 18–19.
28 R. 7216, S. 288, Z. 2.
29 »Die Würde der Menschheit in seiner eigenen Person ist die Persönlichkeit selbst, d. i. Freiheit; denn er ist nur Zweck an sich selbst, sofern er ein Wesen ist, das sich selbst Zwecke setzen kann. Die Vernunftlosen, die das nicht können, haben nur den Wert der Mittel« (R. 7305, S. 307, Z. 20–23).
30 R. 6908, S. 203, Z. 6–12. Kant steht, was den Primat des Willens über den Verstand, der Praxis über die Theoria betrifft, zweifellos unter dem unmittelbaren Einfluss von Christian August Crusius, Anweisung vernünftig zu leben, Leipzig 1744 (Nachdruck Hildesheim 1969), §§ 233–234; 284–288.
31 R 6598, S. 103, Z. 9–10, 16–18.
32 Ebd,, Z. 16.
33 R. 7260, S. 296, Z. 28–30.
34 R. 6605, S. 106, Z. 6–7.
35 R. 6615, S. 111, Z. 11.
36 R. 6915, S. 205, Z. 30–31.
37 R. 7197, S. 270, Z. 19–20.
38 R. 7202, S. 276, Z. 26.
39 R. 7202, S. 282, Z. 12–13.
40 R. 7210, S. 286, Z. 8.
41 R. 7202, S. 277, Z. 5–6.
42 R. 7197, S. 270, Z. 21–22.
43 Auch hier dürfte Christian A. Crusius Kant beeinflusst haben; vgl. Anweisung vernünftig zu leben § 235 f.
44 R. 7202, S. 280, Z. 21–23. Vgl. bis in die Formulierung hinein Crusius, a. a. O., § 235.
45 »Nun muss mir diejenige Ungebundenheit, durch die ich wollen kann, was meinem Willen selbst zuwider ist, und ich keinen sicheren Grund habe, auf mich selbst zu rechnen, im höchsten Grade missfällig sein« (R. 7202, S. 281, Z. 14–16).
46 Vgl. Ebd,, Z. 14.
47 R 7217, S. 288, Z. 24–25.
48 Ebd., Z. 23.
49 Vgl. R. 7202, S. 279, Z. 12–14.; R. 6598.
50 R. 7217, S. 288, Z. 9–10.
51 R. 7199, S. 273, Z. 8–9.
52 KpV V, 111.
53 KpV V, 112.
54 Wenn Kant die »Sekten« bzw. »Schulen der Alten« bemüht und ihre Thesen referiert, so ist zu beachten, dass er dabei kein historisch-philologisches Interesse, sondern stets ein systematisch orientiertes »Vernunftinteresse« verfolgt. Vgl. dazu Santozki, Ulrike 2006, 22–33.
55 Siehe die Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral, AA II, 298.
56 Kant übernimmt diesen Gedanken bis in die Wortwahl hinein von Christian A. Crusius und behält ihn zeitlebens bei. »An sich notwendiger Zweck«, der alle moralische Verbindlichkeit begründet, ist für Kant allerdings nicht wie bei diesem der Wille Gottes, sondern die Vollkommenheit unserer Freiheit. Vgl. dazu Schmucker, Joseph 1961, 59 ff.
57 R. 7202, S. 277, Z. 7.
58 R. 7202, S. 279, Z. 23–25.
59 Vgl. R. 7202, S. 276, Z. 29.
60 Vgl. R. 7202, S. 276, Z. 32; S. 277, Z. 2.
61 R. 7202, S. 276, Z. 18–19.
62 Vgl. dazu die R. 7255, S. 295, Z. 23–26: »Wir haben ein reines und unbedingtes Vergnügen, welches wir von dem allgemeinen ableiten. Denn dies ist notwendig in aller Beziehung gültig; also ist der moralische Sinn eigentlich die allgemein gemachte sinnliche Lust, die von Einschränkung frei wird.«
63 R. 7202, S. 277, Z. 5.
64 R. 7202, S. 279, Z. 3–4.
65 R. 7202, S. 282, Z. 1.
66 R. 7202, S. 276, Z. 30–32.
67 R. 7202, S. 277, Z. 3.
68 R. 7202, S. 276, Z. 32 und S. 277, Z. 1–2.
69 R. 7202, S. 278, Z. 3.
70 R. 7311, S. 309, Z. 6–7.
71 R. 7202, S. 279, Z. 12.
72 Ebd., Z. 23–24.
73 »Das System des feinsten Eigennutzes ist darin vom Lehrbegriff der sich selbst genügsamen Tugend unterschieden, dass diese die Tugend an sich selbst liebt«, während für jenes »die Hoffnung der Glückseligkeit […] ein Grund der Tugend ist« (R. 6606, S. 106, Z. 10–12 und 15–16).
74 In R. 7310, S. 308, Z. 29 heißt es lapidar: »Der Zweck der Menschen ist Glückseligkeit.« An anderer Stelle (R. 6539, S. 60, Z. 3) meint Kant, der Mensch könne jedenfalls nicht »gänzlich unglücklich sein wollen«.
75 R. 6615, S. 111, Z.9–13: »Man muss die moralischen Bewegungsgründe aus dem Gemische der übrigen […] herausziehen; es ist von reinen und himmlischen Ursprüngen; man findet sich dadurch, wenn man es in seinem Verhalten bemerkt, gleich veredelt und sieht alle Glückseligkeit nur als das Gefolge davon an.« Die Erwartung einer Belohnung mindert nicht den moralischen Wert einer Handlung, wenn sie nicht deren Motiv ist (so R. 7281, S. 301). Kant unterscheidet hier einen Lohn, der das Handlungsmotiv ausmacht (praemium, quod motivum actionis in se continet, R. 7111, S. 251, Z. 8), und nennt ihn Preis, R. 7110, S. 250, Z. 25, von einer Belohnung, die nicht Motiv einer Handlung, aber nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten zu erwarten ist (praemium morale, vgl. R. 7110; 7105; 7112; 7102).
76 R. 7202, S. 277, Z. 29–30.
77 R. 7202, S. 276, Z. 29.
78 R. 7202, S. 276, Z. 8–9.
79 R. 7202, S. 277, Z. 24.
80 R. 7202, S. 278, Z. 21–22.
81 R. 7202, S. 279, Z. 17.
82 Vgl. etwa De officiis I, 10.
83 Vgl. R. 7202, S. 276, Z. 23.
84 Ebd., Z. 5–7.
85 Sie finden sich, auf das Wesentliche reduziert, in der Reflexion 7212, S. 287, Z. 6–9.
86 R. 7202, S. 277, Z. 17–23: »Für die Sinne kann keine Befriedigung ausgefunden werden, nicht einmal lässt sich mit Gewissheit und allgemein bestimmen, was den Bedürfnissen derselben gemäß sei; sie steigen immer in der Forderung und sind unzufrieden, ohne sagen zu können, was ihnen denn genug tue. Noch weniger ist der Besitz dieser Vergnügen wegen der Veränderlichkeit des Glücks und der Zufälligkeit günstiger Umstande und der Kürze des Lebens gesichert.«
87 R. 7202, S. 277, Z. 12–14.
88 Vgl. R. 7202, S. 276, Z. 10–14. Dieses Gefühl, der positive Aspekt des moralischen Gefühls, drückt ein allgemein gültiges Verhältnis aus zwischen Freiheit und Lust des Subjekts. Es gründet darin, dass wir unsere Freiheit des Beliebens nach Gesetzen der Vernunft ordnen, ist also nicht Ursprung, sondern Begleit- bzw. Folgephänomen unserer Selbstmoralisierung. Die »Moralisten der sittlichen Empfindung« (R. 6624, S. 116, Z. 9–10) – gemeint ist vor allem der Schotte Francis Hutcheson, aber auch er selbst in der Vergangenheit (vgl. etwa R. 6581; 6577; 6560) – haben also unrecht mit ihrer Deutung, wenn sie einen moralischen Sinn und ein moralisches Gefühl in strenger Analogie zur Sinneswahrnehmung und -empfindung als ursprüngliche, unmittelbare Unterscheidungs- und Antriebsinstanz für moralisch Gutes ansetzen. Die erste Reflexion, die die diesbezügliche Positionsklärung zum Ausdruck bringt, datiert die Akademie-Ausgabe an das Ende der 60er Jahre: »Das moralische Gefühl ist kein ursprüngliches Gefühl. Es beruhet auf einem notwendigen inneren Gesetze, sich selber aus einem äußerlichen Standpunkt zu betrachten und zu empfinden. Gleichsam in der Persönlichkeit der Vernunft: da man sich im Allgemeinen fühlt und sein Individuum als ein zufällig Subjekt wie ein Accidens des Allgemeinen ansieht« (R. 6598, S. 103, Z. 19–24). Dass allerdings das gedanklich-objektive, »mit der Moralität wesentlich verbundene motivum, nämlich die Würdigkeit glücklich zu sein« (R. 6628, S. 117, Z. 28–29), auch der Beihilfe einer subjektiv-instinktartigen Empfindungskraft (= »das Herz«) bedarf, um effiziente Triebfeder zur Moralität (principium executionis) zu werden, hat Kant offensichtlich noch längere Zeit angenommen (vgl. dazu R. 6610; 6619; 6906; 7029; 7170; 7175; 7181; 7185; 7202, S. 279, Z. 16–20; 7236; anders dann R. 7204, S. 283, Z. 25–27.; R. 7213, S. 287, Z. 15–17.; R. 7262). Tatsächlich legt der Gedanke einer engen Verbindung von Moralität und Glück des Menschen den Gedanken einer natürlichen Ausrichtung des Menschen auf Moralität nahe. Solange Kant der stoischen und altakademisch-peripatetischen Tradition stärker verpflichtet war, hielt er an ihm fest. Dieses im Kern naturteleologische Theoriestück vom moralischen Sinn verliert dann in dem Maß an Funktion, in dem Moralität und Glückseligkeit des (irdischen) Menschen durch verstärkt säkularisiert-christlichen und empirisch-sensualistischen Einfluss bei ihm auseinandertreten.
89 R. 7202, S. 278, Z. 25.
90 R. 6892, S. 169, Z. 10.
91 Kant muss deshalb den Begriff der Selbstliebe differenzieren. Er ordnet das moralische Wohlgefallen an sich selbst dem Prinzip einer »rationellen«, d. h. vernunftzentrierten Selbstliebe zu, im Unterschied zur »empirischen«, auf das endliche Individuum zentrierten Selbstliebe: »Es ist also nicht die empirische Selbstliebe, welche der Bewegungsgrund eines vernünftigen Wesens sein soll, denn diese geht von Einzelnen zu allen, sondern die rationelle, welche vom Allgemeinen und durch dasselbe die Regel vor [= für] das Einzelne hernimmt« (R. 7199, S. 272, Z. 30; S. 273, Z. 1).
92 Vgl. R. 7202, S. 276, Z. 10–14.
93 R. 7202, S. 278, Z. 16; S. 281, Z. 32–33.
94 Vgl. R. 6892, S. 196, Z. 6 ff.
95 Explizit in R. 6611, S. 109, Z. 22–23.
96 R. 6892, S. 196, Z. 10–11.
97 R. 7202, S. 278, Z. 29–30.
98 Vgl. R. 7204, S. 284, Z. 4–7.
99 Vgl. R. 7204, S. 283, Z. 33; S. 284, Z. 7.
100 R. 7204, S. 284, Z. 7.
101 R. 7202, S. 278, Z.4–5.
102 Vgl. R. 7202, S. 280, Z. 19–20; S. 281, Z. 29–33.
103 Vgl. R. 7202, S. 279, Z. 16–18; S. 278, Z. 21–23.
104 R. 7205, S. 278, Z. 29–30.
105 Der Gedanke, dass »unser Vergnügen schmackhafter [wird, M. F.], wenn wir es unter edleren Absichten verdecken«, findet sich explizit relativ früh (R. 6620, S. 114, Z. 4–5), wenngleich unter deutlich epikureischen Prämissen (vgl. R. 6621).
106 R. 7202, S. 277, Z. 29–31.
107 Vgl. R. 7199, S. 273, Z. 23–25.
108 Vgl. R. 7204, S. 283, Z. 14–17.
109 Siehe dazu unten Kap. XII.
110 Vgl. R. 7204, S. 283, Z. 22–23
111 Vgl. R. 7198; R. 7202, S. 278, Z. 5–7.; S. 277, Z. 8–11; R. 7311, S. 309.
112 R. 7202, S. 276, Z.31–32
113 KrV B 834; vgl. A 806.
114 Dieses Konzept der Reflexionen reiht sich ganz offensichtlich in eine ethische Tradition ein, wie sie Cicero in De finibus bonorum et malorum als akademisch-peripatetische Position expliziert und im Wesentlichen auf den stoisierenden Akademiker Antiochos von Askalon zurückgehen dürfte. Zur Antike-Rezeption Kants vgl. die bereits erwähnte eingehende Studie von Santozki, Ulrike 2006.
115 R. 7202, S. 278, Z. 1–5.
116 KpV V, 117, Z. 30–31.
117 Vgl. KpV V, 87, Z. 31–33.
118 KpV V, 88, Z. 9–10.
119 Dies wird jedenfalls bezüglich des Materialismus und Atheismus (etwa eines La Mettrie oder Helvétius) deutlich in der späten Reflexion 7314: »Einwurf: Der Mensch kann nicht glücklich sein, ohne wenn er sich selbst wegen seines Charakters Beifall geben kann. Er kann dieses aber nur alsdann nicht, wenn er in der Moralität einen absoluten Wert sieht. Wenn er hierauf nicht Rücksicht nimmt, wenn ihm das Wohlbefinden aus physischer Empfindung genug ist, so kann er glücklich sein, ohne sich im mindesten um die Übereinstimmung seines Verhaltens mit der Moral zu bekümmern, davon er nur den äußeren Schein […] als eine von den Regeln der Klugheit, benutzt.« Kant setzt sich mit dem Glücksbegriff der atheistischen Hedonisten auseinander, übernimmt aber auch wesentliche Aspekte ihres Begriffs.
120 Vgl. R. 6611; 6616; 6892; 6893; 7237; 7311.
121 Insbesondere in der Schrift De officiis, die zu seiner Zeit zum verpflichtenden Bildungsgut in Preußen gehörte. Die Schrift De finibus bonorum et malorum mit ihrer präzisen Unterscheidung der hellenistischen Schulen scheint er allerdings nicht (genauer) gekannt zu haben, da er Cicero in seiner Ethik wohl für einen Stoiker hielt (vgl. AA IX, 31; Santozki, Ulrike 2006, 156), Es könnte aber auch sein, dass er, wie Ciceros Lehrer Antiochos von Askalon, die Differenz von stoischer und altakademisch-peripatetischer Ethik systematisch (zunächst?) für vernachlässigbar hielt.
122 Vgl. R. 7166; 7159; 7093; 7060.
123 Vgl. R. 6878; 6882; 6894.
124 Wobei die Idee der Tugend als principium diiudicationis und die der Glückseligkeit als principium executionis der Moral fungiert.
125 Vgl. R. 7060, S. 238.
126 So R. 6882, S. 191, Z. 12–14.
127 Vgl. ebd.
128 Vgl. v. a. Paulus, 1 Kor 1, 17; 2, 16.
129 Vgl. R. 7312, S. 309, Z. 26–29.
130 Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen (= DL), II, 87.
131 Vgl. R. 6611; 6631; 6637; 6881 sowie AA XXVII, 253, Z. 13–15; vgl. XXVII, 276 (Moralphilosophie Collins) und XXVII, 100 (Moralphilosophie Powalski).
132 GMS IV, 399.
133 GMS IV, 395.