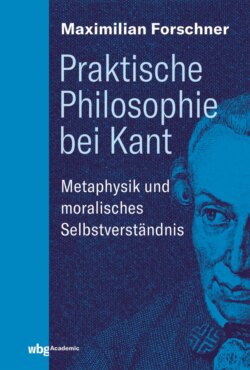Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Vernunftglaube und moralische Gesinnung
ОглавлениеWir Menschen wollen glücklich sein. Aber wir wollen vernünftigerweise auch, dass der und nur der glücklich ist, der es nach moralischen Gesichtspunkten zu sein verdient. Eine solche Verbindung von Moralität und Glück, das höchste Gut, scheint freilich nicht der conditio humana in dieser Welt zu entsprechen. Es ist gedachtes Objekt einer jetzt nicht sichtbaren, aber erhofften Welt. Das Glück des Menschen wird für den »kritischen« Kant zum Gegenstand eines der moralischen Gesinnung und Einstellung entspringenden vernünftigen Glaubens.
Im Folgenden wird der gedankliche Weg nachgezeichnet, auf dem Kant zu seiner in der transzendentalen Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft skizzierten, nunmehr religionsphilosophischen Position bezüglich des »ganzen Zwecks« des Menschen gelangt ist. Es scheint dies, obwohl es in der Kantforschung immer wieder behauptet wird, für ihn keine abschließende Position zu sein. Die Kritik der praktischen Vernunft trennt Triebfeder und Gegenstand bzw. Bestimmungsgrund und Objekt eines durch reine Vernunft bestimmten menschlichen Wollens voneinander ab. Das (objektive) Bewusstsein des moralischen Gesetzes wird zum Bestimmungsgrund und das (subjektive) Gefühl der Achtung vor diesem Gesetz zur notwendigen und hinreichenden Triebfeder eines endlichen, moralisch guten Willens erklärt.134 Der Vorstellung eines in Aussicht stehenden, durch Gott vermittelten höchsten Guts, dessen Besitz für den Tugendhaften auch sein vollkommenes Glück bedeuten würde, dieser Vorstellung eine unverzichtbare Rolle im Bestimmungsgrund und eine positive Motivationsrolle in Vorsatz und Ausübung sittlicher Handlungen zuzuschreiben, scheint danach gleichbedeutend mit dem Ansatz einer unreinen moralischen Gesinnung zu sein. »[D]as moralische Gesetz muss allein als der Grund angesehen werden, jenes [sc. das höchste Gut, M. F.], und dessen Bewirkung oder Beförderung, sich zum Objekt zu machen.«135 Andererseits soll das höchste Gut im Sinn einer Verbindung von Tugend und Glück eben die Rolle des praktischen Objekts eines moralischen Willens spielen, eines Objekts, dessen Verwirklichung bzw. Beförderung kategorisch gebotenes Handlungsziel endlicher Vernunftwesen ist. Erwiese sich dieses Ziel als unrealisierbar bzw. unerreichbar, würde das den Sinn und die Geltung des moralischen Gesetzes für den Menschen untergraben, wenn nicht zerstören. »Ist also das höchste Gut nach praktischen Regeln unmöglich, so muss auch das moralische Gesetz, welches gebietet, dasselbe zu befördern, phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt, mithin an sich falsch sein.«136 Kant gibt hier, wie ich meine, eindeutig zu verstehen, dass sein Verständnis des moralischen Gesetzes, dass sein Begriff von Moralität mit ihrem Charakter uneingeschränkten Gutseins und absoluter Verbindlichkeit nur zusammen mit der Perspektive der Realisierbarkeit des höchsten Guts in sich konsistent und theoretisch wie praktisch tragfähig ist. Es wäre ohne diese Perspektive »phantastisch« und »an sich falsch«.137 Es verlöre damit evidentermaßen seinen Charakter objektiver Verbindlichkeit. Und ein derart phantastisches Gesetz büßte natürlich auf Seiten des Adressaten auch an Achtung ein und verlöre damit auch seine Motivationskraft für den Menschen. Es bliebe für ihn allenfalls ein Gegenstand fruchtloser, praktisch bedeutungsloser ›ästhetischer‹ Bewunderung, ein Gesetz, das vielleicht für andere Wesen als den Menschen Geltung hätte. So gesehen ist und bleibt nicht nur die subjektive Triebfeder, sondern auch der objektive Bestimmungsgrund eines moralisch bestimmten Wollens im Konzept der Kritik der praktischen Vernunft und der nachfolgenden moralphilosophischen bzw. moralphilosophisch relevanten Schriften mit dem Gedanken der Möglichkeit des höchsten Guts untrennbar verbunden. Kant hat denn auch in der KpV keine Bedenken, das recht verstandene höchste Gut sowohl Objekt als auch Bestimmungsgrund des reinen Willens zu nennen:
»Es versteht sich aber von selbst, dass, wenn im Begriffe des höchsten Guts das moralische Gesetz, als oberste Bedingung, schon mit eingeschlossen ist, alsdann das höchste Gut nicht bloß Objekt, sondern auch sein Begriff und die Vorstellung der durch unsere praktische Vernunft möglichen Existenz desselben zugleich der Bestimmungsgrund des reinen Willens sei.«138
Mit vergleichbarer Eindeutigkeit ist in der Religionsschrift von einer negativen Motivationsrolle der Idee des höchsten Guts die Rede, insofern sie ein unabweisbares theoretisches Bedürfnis befriedigt und damit ein »Hindernis der moralischen Entschließung« beseitigt.139 Darauf gilt es später genauer einzugehen.140 Wenn Kant zu Beginn der Religionsschrift mit Nachdruck betont, die Moral des Menschen bedürfe »weder der Idee eines anderen Wesens über ihm, um seine Pflicht zu erkennen, noch einer anderen Triebfeder als des Gesetzes selbst, um sie zu beobachten«,141 so enthält dieser Satz für ihn nur die halbe Wahrheit; jedenfalls ist er ergänzungs- und interpretationsbedürftig. Er ist ergänzungs- und interpretationsbedürftig hinsichtlich seiner Funktion: Kant erklärt zum »Beschluss« der Metaphysik der Sitten, alle Pflichten »als (instar) Gebote Gottes« und »in Ansehung Gottes« zu denken sei eine »Pflicht des Menschen gegen sich selbst, d. i. nicht objektive, die Verbindlichkeit zur Leistung gewisser Dienste an einen anderen, sondern subjektive zur Stärkung der moralischen Triebfeder in unserer eigenen gesetzgebenden Vernunft«.142
Unklar scheint zunächst, in welcher Hinsicht »die moralische Entschließung« der Anerkennung der Kerngedanken des Vernunftglaubens bedarf und in welcher nicht. Eine überzeugende Antwort ist wohl in der Richtung zu suchen, dass die Erkenntnis des moralischen Gesetzes, das sich dem Bewusstsein in »aufdringender« Evidenz präsentiert, und die Einnahme der Position der Moralität, wie Kant sie versteht, keinerlei theoretisch-metaphysische Prämissen voraussetzt, dass aber auf dem Boden und in der Perspektivik dieser Position ein objektiv vernünftiges und sich subjektiv als praktisch wirksam erweisendes Selbst- und Weltverständnis den reinen Vernunftglauben notwendig einschließt. So lässt sich ein auf dieses Problem bezogener Kernpassus der Kritik der praktischen Vernunft wohl einigermaßen konsistent interpretieren:
»Diese Pflicht [sc. sich das höchste Gut zum Objekt des Wollens zu machen, M. F.] gründet sich auf einem, freilich von diesen letzteren Voraussetzungen [sc. den Postulaten von Gott und Unsterblichkeit etc., M. F.] ganz unabhängigen, für sich selbst apodiktisch gewissen, nämlich dem moralischen Gesetze und ist sofern keiner anderweitigen Unterstützung durch theoretische Meinung von der innern Beschaffenheit der Dinge, der geheimen Abzweckung der Weltordnung, oder eines ihr vorstehenden Regierers bedürftig, um uns auf das Vollkommenste zu unbedingt gesetzmäßigen Handlungen zu verbinden. Aber der subjektive Effekt dieses Gesetzes, nämlich die ihm angemessene und durch dasselbe notwendige Gesinnung, das praktisch mögliche höchste Gut zu befördern, setzt doch wenigstens voraus, dass das Letztere möglich sei, widrigenfalls es praktisch unmöglich wäre, dem Objekte eines Begriffs nachzustreben, welcher im Grunde leer und ohne Objekt wäre.«143
Eine (vernünftige) moralische Gesinnung kann uns nicht ins ersichtlich Unmögliche und Phantastische hinein ausrichten.
Diese wenigen, noch recht vorläufigen Hinweise mögen Zweifel bestärken, ob sich die Stellung der Religion bzw. des reinen Vernunftglaubens im Rahmen der Theorie menschlicher Moralität und menschlichen Glücks, wie sie die Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft skizziert, von jener wesentlich unterscheidet, die die späteren moral- und religionsphilosophischen Texte Kants fortschreiben. Um diese Frage angemessen zu diskutieren und zu beantworten, ist es zumindest dienlich, den gedanklichen Motiven, den Problemstellungen und Lösungsversuchen nachzugehen, die Kant vor der Veröffentlichung der Kritik der reinen Vernunft mit der Religionsthematik verbunden hat. Für die Beantwortung dieser Vorfrage bieten die publizierten Schriften wenig, der handschriftliche Nachlass reichlich Material. Die zentrale Interpretationsaufgabe besteht hier in einer Strukturierung der recht rhapsodischen, fragmentarischen, skizzen- und formelhaften Notizen, derart, dass eine einigermaßen klare Ordnung und plausible Entwicklung der Gedanken sichtbar werden.
Die Beschäftigung mit Kants Reflexionen vermittelt hier für das Gebiet der praktischen Philosophie den Eindruck, dass seine Bindung an Problemstellungen der Tradition weit enger ist, als die innovative Sprache der publizierten »kritischen« Schriften dies unmittelbar glauben macht. Für die Religionsthematik kann man feststellen, dass sie vom Anfang bis zum Ende ihren systematischen Ort in der Moralphilosophie, näherhin im Zusammenhang der Diskussion des höchsten Guts bzw. des Endziels menschlichen Strebens und Handelns einnimmt. An Entwicklung lässt sich ausmachen, dass das »christliche« Ideal eines moralischen Vernunftglaubens ab Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre schrittweise gegenüber kynischen, stoischen, epikureischen und platonischen Verhältnisbestimmungen von Tugend und Glück an Kontur und Gewicht gewinnt und schließlich definitiv vertreten wird. Die zentrale Problemstellung, die den Verlauf der Entwicklung begleitet, ist von der Frage bestimmt, wie ein Verständnis von Moralität allein in Begriffen der Vernunft sich mit dem Ideal von Gott als Prinzip des höchsten Guts verbinden lässt. Kant scheint den moralischen Glauben neben dem moralischen Gefühl gegen Ende der »vorkritischen« Phase sowohl im Gerechtigkeitsverlangen der Vernunft als auch in der Triebfeder moralischer Motivation des Menschen zu verorten. Ob und inwieweit diese Lösung des Glaubens- und des Motivationsproblems mit jener der später publizierten »kritischen« Schriften, insbesondere mit der der Religionsschrift in Einklang zu bringen ist, wird sich zeigen.