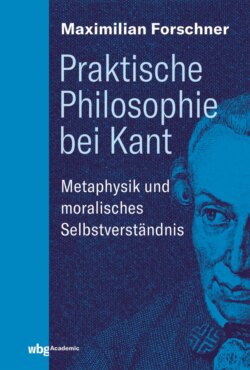Читать книгу Praktische Philosophie bei Kant - Maximilian Forschner - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Der Fehler der philosophischen »Sekten«
ОглавлениеAus der Zeit von 1764 bis 1766 stammt eine Notiz Kants, deren Inhalt als eines der Leitmotive sein gesamtes Denken über Religion bestimmen wird. »Wenn man Gott vor der Moralität erkennen will, so legt man ihm nicht moralische Vollkommenheiten bei. Daher kann Religion böse Sitten hervorbringen […]. Eine Frömmigkeit, die vor der Sittlichkeit anfängt, ist ihr oft entgegen.«144 Der Begriff der Moralität und der Tugend sei von dem der Religion unabhängig.145
Kant folgt hier wie in vielem anderen in seinem aufgeklärten Moralverständnis Alexander Baumgarten, dessen Initia Philosophiae practicae primae146 im § 71 kategorisch feststellen: »ius naturae late dictum s. philosophia practica esset […], etiam si non daretur deus, […] prorsus est independens a deo, […] ex voluntate dei nulla ratione omnino derivari potest, […] aeque bene cognosci potest ab atheo […].« Das Naturrecht im weiten Sinn bzw. die praktische Philosophie gäbe es, auch wenn es keinen Gott gäbe; es könne nicht aus dem Willen Gottes abgeleitet werden; es könne genauso gut von einem Atheisten erkannt werden. Religion kommt für Kant ins Spiel der Moral »in Ansehung der Unzulänglichkeit, ohne Einstimmung des Schicksals glücklich zu werden«147 und ohne göttliche Beihilfe tugendhaft zu sein.148 Die zunehmend sich klärende und verfestigende Einsicht in die Unzulänglichkeit und Schwäche der menschlichen Natur im Blick auf die Realisierung von Tugend und Glück und die Einsicht in die starke, ja unaufhebbare Kontingenz des Zusammenhangs von Tugend und Glück in diesem Leben sind es, die Kant schrittweise von einer eher paganen, nichtchristlichen Bestimmung des höchsten Guts Abstand nehmen lassen. Der Prozess der Auseinandersetzung mit dem »summum bonum der philosophischen Sekten«149 wird um die Zeit von 1776 bis 1778 mit der definitiven Diagnose abgeschlossen:
»Der Fehler der philosophischen Sekten war der, dass sie die Moral von der Religion unabhängig machen wollten (dass sie die Glückseligkeit in Verbindung mit der Moral von der Natur erwarteten […]); die Natur der Dinge aber enthält keine notwendige Verbindung zwischen Wohlverhalten und Wohlbefinden, und also ist das höchste Gut ein bloßes Gedankenwesen.«150
Wie Kant, prima facie paradoxerweise, den Begriff der Moralität von Religion unabhängig und zugleich die Moral von der Religion abhängig erklären kann, gilt es verständlich zu machen. Und ebenso bedarf es der Klärung, wie sich sein höchstes Gut als »bloßes Gedankenwesen«, als ens rationis, von den »Chimären der Alten« unterscheiden soll.
Kants Diskussion des höchsten Guts arbeitet wohl von Beginn seiner Überlegungen zur praktischen Philosophie an mit dem Gedanken, dass Glückseligkeit und Sittlichkeit, Wohlbefinden und Wohlverhalten, moralisches Gefühl und Neigungen der Selbstliebe im Menschen und seiner Lebenswelt heterogene Sachverhalte sind, die es im Begriff des Endziels menschlichen Strebens und Handelns zu verbinden gilt. Dies zeigt sich sowohl an seinen Notizen zu Baumgartens Initia als auch an seinen allgemeinen Reflexionen über die »Systemata der Alten«. In frühen Kommentaren zu Baumgartens Bestimmung der infirmitas humana und der fragilitas naturae humanae151 findet sich bereits die Antithetik von moralischem Gefühl und Neigung, der Begriff reiner Moralität und die Rede von einem allgemeinen menschlichen Hang zum Bösen, der mit einer Dominanz der Neigungen gegenüber dem moralischen Gefühl zu tun hat. »Die Schwäche der menschlichen Natur besteht in der Schwäche des moralischen Gefühls verhältnisweise gegen andere Neigungen […]. Wenn diese die Bewegungsgründe zum Teil sind, so ist die Moralität nicht rein.«152 »Die allgemeine Gebrechlichkeit besteht nicht in bösen Neigungen, sondern in der großen Möglichkeit derselben, böse zu werden. Das ist der Hang der Neigungen zu Bösem, ehe die Neigungen böse sind.«153
Bereits aus der Zeit zwischen 1764 und 1768 besitzen wir eine Einteilung und Beurteilung der »Ideale der Alten de summo bono«, die Kant bis in seine »kritischen« moralphilosophischen Schriften mit leichten Variationen wiederholen und beibehalten wird. Unterschieden wird zwischen einem natürlichen und einem mystischen Ideal, wobei Kant das kynische, epikureische und stoische dem natürlichen, das platonische dem mystischen zuordnet und das kynische als System der Einfalt und Genügsamkeit charakterisiert, das epikureische als Ideal der Klugheit und Wollust, das stoische als Ideal der Tugend und Weisheit, und das platonische durch den Gedanken der (durch »intellektuelle Anschauung« ermöglichten) Gemeinschaft mit Gott.154
Von bleibendem, durch zeitgenössische Autoren erhöhtem Gewicht ist für Kant das epikureische Ideal. Nach diesem besteht das Wohlverhalten »bloß in der Abzweckung der Handlungen zu Wohlbefinden«,155 ist »die Tugend eine notwendige Form der Mittel der Glückseligkeit«.156 Es ist »den Neigungen der Menschen vollkommen angemessen«157 und bezieht seine bestechende Überzeugungskraft aus einem weltimmanenten Daseinsverständnis.
»Wenn der Lauf der Welt alle Folgen der guten und bösen Handlungen bestimmt, so ist Weltklugheit das Wohlverhalten, was zum höchsten Gut führt. Hierzu aber wird erfordert, dass man Moralität als die Regel ansieht mit Vorbehalt aller Ausnahmen, welche die Umstände zu unserem Vorteil ratsam machen.«158
Als ungeklärter »Rest« bleibt für Kant hier allerdings jene Seite unseres Selbstverständnisses, die zwischen Tugend und Vergnügen genau unterscheidet und der Moralität des Verhaltens den höchsten, einen absoluten Wert im Leben zuerkennt. Dieser Seite zollt die Stoa mit ihrem Ideal der Weisheit Respekt. Kant lässt von Anfang an keinen Zweifel, dass der Stoa darin recht zu geben ist. Ihr Ideal der Tugend sei richtig;159 ihre »Lehre ist die wahrhafteste der reinen Moral«.160 Doch darin, dass sie »Glückseligkeit in der größten Tugend ohne physische Vergnügen« setzt, die Glückseligkeit als eine »notwendige Folge der Tugend« behauptet,161 mache sie ihren Weisen zur Chimäre, wird ihr Ideal »als eine wirkliche Vorschrift des menschlichen Verhaltens töricht«162 und »am wenigsten der Natur des Menschen angemessen«.163
Gegen Ende der 60er Jahre scheint Kant die vermittelnde, leicht skeptisch präsentierte Position eines theoretischen Stoikers und praktischen Epikureers zu beziehen:
»[D]as stoische Ideal ist das richtigste reine Ideal der Sitten, aber in concreto auf die menschliche Natur unrichtig; es ist richtig, dass man so verfahren soll, aber falsch, dass man jemals so verfahren wird. Das Ideal des Epikurs ist nach der reinen Regel der Sitten und also in der Theorie des sittlichen principii falsch, obzwar in den sittlichen Lehren wahr; allein es stimmt am meisten mit dem menschlichen Willen.«164
Das gravierende Problem der Vermittlung dieser so antithetischen Positionen soll die Unterscheidung zwischen den subjektiven Gründen der Exekution und den objektiven Gründen der Dijudikation sowie die Unterscheidung zwischen Form und Materie lösen.
Das »reine Bild der Tugend an sich selbst« sei eine Vernunftvorstellung. Es beinhalte die »Vollkommenheit eines Subjekts«, die nicht darauf beruhe, »dass es glücklich sei, sondern dass sein Zustand der Freiheit subordiniert sei«;165 und es finde den Grund seiner »Approbation im intellektualen Begriff«.166 Das moralische Gefühl sei als emotionaler menschlicher Gemütsreflex der »Vorstellung der reinen Tugend« zu verstehen, einer Vorstellung, die unserer Vernunft entspringt:
»Das moralische Gefühl ist kein ursprünglich Gefühl. Es beruht auf einem notwendigen inneren Gesetz, sich selber aus einem äußerlichen Standpunkt zu betrachten und zu empfinden. Gleichsam in der Persönlichkeit der Vernunft; da man sich im Allgemeinen fühlt und sein Individuum als ein zufällig Subjekt wie ein Accidens des Allgemeinen ansieht.«167
Objektive Vernunftvorstellung und subjektives moralisches Gefühl reichen indessen nicht aus, »die Menschen zum moralisch Guten anzutreiben«, »ihre elateres [liegen] im Sinnlichen«,168 da »uns die Natur wegen aller unsrer Handlungen den sinnlichen Bedürfnissen zuletzt unterworfen zu haben« scheint.169 Auf der Ebene der Ausführung bedarf der Mensch also der Beihilfe natürlicher Neigungen, von »motiva auxiliaria« wie »Mitleid«, »Ehre«, »Liebe« etc., ohne welche die Moral chimärisch wäre,170 einer Beihilfe freilich, die nicht den Anschein erwecken darf, es ginge uns letztlich nur um uns selbst und die Erhaltung und Steigerung unseres eigenen empirischen Daseins. Ja, ein gewisses Maß der Selbstillusionierung muss diese hilfreichen Neigungen begleiten, da das Selbstverständnis des Menschen sich am Bewusstsein moralischer Motivation seines Handelns am stärksten erhebt und in Richtung tugendgemäßer Handlungen praktisch auswirkt.
»Es ist besonders, dass der vorgestellte Nutzen und [die] Ehre nicht die so starke Entschließung, der Tugend nachzuahmen, hervorbringen können, als das reine Bild der Tugend an sich selbst; und selbst, wenn man im Geheim durch Aussicht auf Ehre getrieben wird, tut man es doch nicht um dieser Ehre willen allein, sondern nur, soferne wir uns durch eine geheime Überredung einbilden können, die Grundsätze der Tugend hätten es hervorgebracht. Wir müssen uns vor unsern eignen Augen die Mechanik unserer eigennützigen Antriebe verbergen.«171
Kant versucht gegen Ende der 60er Jahre (unter dem Einfluss von so heterogenen Autoren wie Baumgarten, Crusius, Hutcheson und Rousseau) Stoa und Epikureismus, den »Lehrbegriff der sich selbst genugsamen Tugend« und »das System des feinsten Eigennutzes«, »die eben dieselbe Wirkung, aber nicht aus denselben principiis leisten«,172 miteinander zu verbinden, ohne auf ein Erfordernis von Religion Bezug zu nehmen. Für die Praxis sei wichtig, dass bezüglich des Verfolgens unserer Neigungen das einschränkende moralische Gesetz der »Regeln des allgemeinen Beifalls« »doch immer die beste allgemeine Regel der Klugheit ist«.173 Die Stoa soll die Form, Epikur den Inhalt liefern, und die Synthese sei beiden bekömmlich, denn »wir machen unser Vergnügen schmackhafter, wenn wir es unter edleren Absichten verdecken«.174 Damit
»unsere blinden Triebe uns nicht auf bloßes Glück bald hie, bald dahin trieben […], war ein Urteil nötig, welches in Ansehung ihrer aller unparteiisch und also abgesondert von aller Neigung bloß durch den reinen Willen die Regel entwarf, die vor [= für] alle Handlungen und vor [= für] alle Menschen gültig, die größeste Harmonie eines Menschen mit sich selbst und mit andern hervorbrächten. Man musste in diese Regeln die wesentlichen Bedingungen setzen, unter welchen man seinen Trieben Gehör geben konnte, und als wenn die Beobachtung derselben an sich selbst ein Gegenstand unseres Willens sein könnte, welchen wir selbst mit Aufopferung unsrer Gückseligkeit verfolgen mussten, ob sie zwar nur die beständige und zuverlässige Form war.«175
Diese ›aufgeklärte‹ Synthese von Stoa und Epikureismus konnte Kant auf Dauer nicht befriedigen. Denn sie versagt für ihn gerade dort, wo Moralität eine definitive »Aufopferung unsrer Glückseligkeit« verlangt, in Situationen moralisch geforderten Einsatzes des eigenen Lebens bzw. in Umständen, in denen ein Gerechter kein Glück in diesem Leben mehr zu erwarten hat. Nicht ohne Grund hatte Rousseau gerade im Blick auf derartige Umstände seine Konzepte einer politischen und privaten Versöhnung von Gerechtigkeit und Nutzen in dieser Welt durch die Perspektive der Dogmen einer religion civile im Contrat Social und des Glaubens des savoyardischen Vikars im Émile ergänzt.176 Kant verfolgt denn auch seinen Gedanken – Moralität als Form irdischer Glückseligkeit – zunächst wie Rousseau in einer stark kynisch-stoisch gefärbten Richtung weiter: Tugend, um ihrer selbst willen und als unbedingte Bedingung aller anderen Ziele erstrebt, führe Selbstzufriedenheit bei sich. Diese, »gleichsam apperceptio iucunda primitiva«,177 sei sowohl Bedingung der Möglichkeit aller empirischen Gückseligkeit als auch, im Fall ihres Fehlens, deren weitgehender Ersatz. »In dem Bewusstsein hat der Mensch Ursach, mit sich selbst zufrieden zu sein. Er hat die Empfänglichkeit aller Glückseligkeit, das Vermögen, auch ohne Lebensannehmlichkeiten zufrieden zu sein und glücklich zu machen. Dieses ist das Intellektuelle der Glückseligkeit.«178
»Die Funktion der Einheit a priori aller Elemente der Glückseligkeit […] ist die Freiheit unter allgemeinen Gesetzen der Willkür, die Moralität. Das macht die Glückseligkeit als solche möglich und hängt nicht von ihr als dem Zwecke ab und ist selbst die ursprüngliche Form der Glückseligkeit, bei welcher man die Annehmlichkeiten gar wohl entbehren und dagegen viel Übel des Lebens ohne Verminderung der Zufriedenheit, ja selbst zur Erhebung derselben, übernehmen kann.«179
Doch bei aller Betonung der selbstgewirkten Form von Glückseligkeit wahrt Kant noch die Distanz zur Stoa, identifiziert er die moralische Selbstzufriedenheit des guten Menschen nicht völlig mit seinem Glück. »Gleichwohl vergnügt sie darum doch nicht, weil sie das Empirische der Glückseligkeit nicht verspricht; sie enthält also an sich keine Triebfedern; dazu werden immer empirische Bedingungen, nämlich Befriedigung der Bedürfnisse, erfordert.«180
Zwar ist richtig, dass Tugend, allgemein realisiert, »aus dem, was Natur darbietet, die größte (Glückseligkeit) Wohlfahrt zuwege bringen würde«.181 Aber dies tut sie sicherlich nicht, wenn man sich inmitten einer depravierten Gesellschaft allein oder mit wenigen um sie bemüht. »Es ist unstrittig, dass die Tugend glücklich mache, wenn sie jedermann ausübt; aber Epikur behauptete: auch dann, wenn man sie allein ausübt.«182 Das Materiale menschlichen Glücks entstamme der Sphäre der Sinnlichkeit und der Bedürfnisse, deren Aktualisierung und Befriedigung nicht bzw. nicht uneingeschränkt in unserer Hand sind. Angesichts »der Unzulänglichkeit, ohne Einstimmung des Schicksals glücklich zu sein«,183 bieten ihm weder Stoa noch Epikur noch eine Synthese von beiden eine zureichende Antwort. »Das principium der Moral ist Autokratie der Freiheit« und als solches »das principium der Epigenesis der Glückseligkeit.« So gesehen ist »die Glückseligkeit das Selbstgeschöpf der guten […] Willkür«, »besitzt der Tugendhafte in sich selbst die Glückseligkeit (in receptivitate), so schlimm auch die Umstände sein mögen«;184 aber eben nur in receptivitate, das heißt als Fähigkeit und Disposition, deren Aktualisierung auf den Empfang geeigneter (sc. sinnlicher) ›Materialien‹ angewiesen ist. Das Prinzip der Moral und das der Glückseligkeit, »sofern sie Natur = Glücks Gabe ist«, sind verschieden. Ihre Entsprechung setzt eine vernünftige Weltordnung und gerechte Weltverwaltung voraus.
»Hierbei muss vorausgesetzt werden, dass ursprünglich ein freier Wille, der allgemeingültig ist, die Ursache der Ordnung der Natur und aller Schicksale sei. Alsdenn ist die Anordnung der Handlungen nach allgemeinen Gesetzen der Einstimmung der Freiheit zugleich ein principium der Form aller Glückseligkeit.«185
Hier ist theoretisch bereits der Punkt erreicht, an dem Kant sich über den »Fehler der philosophischen Sekten« definitiv im Klaren ist und einer bestimmten Abhängigkeit der Moral von der Religion das Wort redet. Denn einerseits ist das Bestehen einer gerechten Weltordnung und Weltverwaltung nichts, was theoretisch beweisbar oder empirisch belegbar wäre. Andererseits ist der Gedanke einer Welt, »wo die Glückseligkeit genau mit der Sittlichkeit zusammenstimmt«, »ein notwendig moralisches Ideal«186 und als Sinnhorizont vernünftigen Strebens und Handelns mit unserem sittlichen Selbstverständnis untrennbar verbunden. Und zur Realisierung des höchsten durch Freiheit möglichen Guts, der Verbindung und Entsprechung von Moralität und Glück in unserer Lebenswelt, reichen die Kräfte des Menschen bei weitem nicht aus. Kant will das sittliche Selbstverständnis mit seinem unbedingten Primat der moralisch verstandenen Tugend retten, aber ebenso den Anspruch des bedürftigen Menschen auf sein Glück, wenn er sich denn des Glückes würdig erweist. Er bezieht in der Frage des höchsten Guts schließlich weder die stoische noch die epikureische Position noch eine Synthese von beiden. Er tendiert vielmehr in die Richtung einer Position, wie sie die (stoisch gefärbte) altakademischperipatetische, ihm von Cicero her vertraute Philosophie vertreten hat. Dabei gewinnt allerdings, ganz gegen diese Tradition, wohl aber im Einklang mit biblischen Texten, das provozierende Skandalon des Unglücks des Tugendhaften und des Glücks des Lasterhaften in dieser Welt und die Frage nach einer gerechten Weltordnung ein immer stärkeres Gewicht. »Wenn der rechtschaffene Mann unglücklich ist und der lasterhafte glücklich ist, so ist der Mensch nicht unvollkommen, sondern die Ordnung der Natur.«187 »Und eine Regierung der Welt würde böse sein, darin nicht alles nach dieser Würdigkeit angeordnet wäre.«188 Das höchste Gut enthält für Kant nun fraglos »ein pathologisches und ein praktisches Gut. Wohlverhalten und Wohlbefinden«. Der gute Wille, sich aller Natur- und Glücksgaben wohl zu bedienen, »macht, dass wir derselben insgesamt würdig sind«; »die Würdigkeit ist zwar ein wahres und das oberste Gut, aber nicht das vollständige«.189 Und unterhalb der Vollständigkeit kann Vernunft sich nicht zufriedengeben. Sie hat die Glücksbedürftigkeit des Menschen, und in dieser seine Naturabhängigkeit, seine Sinnlichkeit und Endlichkeit ernst zu nehmen.