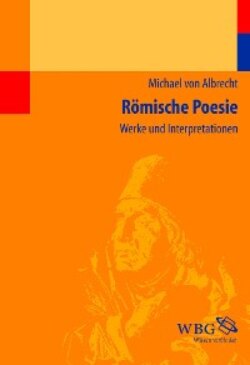Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 14
Rationalisierung
ОглавлениеEnnius ist ein reflektierender Dichter, nennt sich dicti studiosus (φιλόλογος), kennt die hellenistische Homerkritik und berücksichtigt sie in seiner Praxis.
1. Parallele Struktur. Das Gleichnis gliedert sich in zwei gleichartige Hälften: Der erste Satz ist klar und logisch aufgebaut: A1: allseitiger Geschosshagel – B: drei eingeschobene Kola zur Erläuterung – A2: Gegensatz zu A1: keiner kann den Tribun verwunden. Dabei weist undique in V. 4 zurück auf dasselbe Wort des ersten Satzes.
Es ergibt sich somit:
401: allgemeiner Satz: Geschosshagel
402: Spezifizierung: dreifache Steigerung (bis 403 a)
403 b bis 404: allgemeiner Satz: Der Held bleibt unverletzt.
Analog sind die folgenden Verse gegliedert:
405: Widerstand
406: Spezifizierung: dreifache Steigerung (bis 407a)
407b bis 408: Zusammenfassung: dauernder Geschosshagel.
Ennius gliedert rationaler als Homer: zweimal vier Verse mit durchgehender paralleler Phrasierung, statt sieben plus drei Zeilen! Die erste Hälfte schildert den Vorgang mehr aus der Sicht der Feinde, die zweite aus der des Tribunen. Anfangs wirkt alles wie ein Naturereignis; dann ist vom Widerstand und der Mühe des Helden die Rede. Auch im Kleinen ist die Struktur bis ins Letzte durchleuchtet: Die homerische Häufung gleicher Verben ist nicht übernommen. Die übersichtliche Gliederung bedingt eine andere Verteilung des Stoffes als bei Homer: Der Schild ist früher erwähnt und dem Helm gegenübergestellt; den Namen der Feinde nennt Ennius später (408); auf den Willen des Zeus geht er im Fragment nicht ein, doch könnte ein solcher den Helden entlastender Hinweis vor dem Gleichnis gestanden haben (vgl. Vergil. Aen. 9, 803ff.). Im Ganzen ergeben harmonische Proportionen ein formschönes, etwas abstraktes Bild.
2. Verzicht auf Wiederholungen. Zur Rationalisierung gehört der Verzicht auf Wiederholungen (oder was der Dichter dafür hält): Ennius unterscheidet nicht mehr zwischen der Atemnot und der Unmöglichkeit, eine Atempause einzulegen; Vergil wird den ursprünglichen Gedanken verstehen und wiederherstellen.
3. Verzicht auf „Überschüssiges“. Visuelle Elemente gehören für Ennius vielfach zu den „überschießenden“ Zügen: Während Homer Helm und Schild durch Epitheta auszeichnet, die den Glanz hervorheben, spricht Ennius hier weniger das Auge an als das Ohr und den Bewegungssinn: Nicht der Glanz ist metallisch, sondern der Klang. Ähnliches gilt vom Verzicht auf homerische Beiwörter, die Qualität und Gediegenheit hervorheben: Die Feinde sind nicht mehr „erlaucht“, der Helmreif nicht mehr „gut gemacht“: übrigens der erste Schritt zu der zunehmenden Herabsetzung des Erhaltungszustandes der Waffen bei den späteren Epikern; in der Tat ist die Gediegenheit der Rüstung alles andere als eine Entschuldigung für einen Rückzug. Schon Ennius versucht also, Widersprüche zwischen dem überzeitlichen Epitheton und der momentanen Situation zu vermeiden (Homer nennt dagegen Helden auch dann „untadelig“, wenn sie gerade einen Mord begangen haben; Odyss. 1, 29). Ennius vermeidet Beiwörter, die im Augenblick nicht aktuell sind; Attribute setzt er überhaupt sparsamer; vielfach sind sie verstärkender Natur (totum) oder sie kennzeichnen die Bewegungsart (so die schöne Kenning praepete ferro; vgl. auch: obundantes) bzw. die Klangfarbe (aerato sonitu). Die auffallend wenigen Adjektive (zwei statt acht) dienen somit der besonderen Charakterisierung und den Gestaltungstendenzen des Ennius.
4. Abstraktion. Homer spricht von „Gliedern“, Ennius weniger konkret von corpus.14 Ein Abstraktum, das er einführt, ist copia (›Möglichkeit‹); Homer bevorzugt hier verbalen Ausdruck. Substantive sind zahlreicher als bei Homer: ein zukunftsträchtiger Zug. Akzessorisches tritt zurück: Der Schweiß strömt nicht, er „hat“ den Körper. Die Bedrängnis ist nicht mehr anschaulich geschildert. Statt „Er wurde an der linken Schulter müde“, heißt es: multumque laborat. Die zur krampfhaften Gebärde erstarrte Haltung des Aias entfällt ebenso wie der „wohlgearbeitete“ Helmreif: Plastisches reizt einen musikalischen Dichter wie Ennius weniger.
5. Schlussbild. In einem Fall ersetzt Ennius allerdings einen Satz Homers, der ihm wohl zu allgemein scheint, durch das Bild eines Kampfes; er versteht vielleicht die Dämonie nicht mehr, die in den Worten liegt: πάντη δὲ ϰαϰόν ϰαϰᾧ ἐστήριϰτο. Auch Vergil wird vor diesem Satz die Waffen strecken, sei es, dass er ihn für unnachahmlich hält, oder vielmehr, weil er am Ende nach Anschaulichkeit strebt.15 In anderer Weise erreicht Ennius Endlastigkeit: durch das lange Wort sollicitabant. Im ganzen Abschnitt herrscht historisches Präsens, das Imperfekt kennzeichnet am Ende die Bewegung und bereitet die Rückkehr zur eigentlichen Erzählung vor.