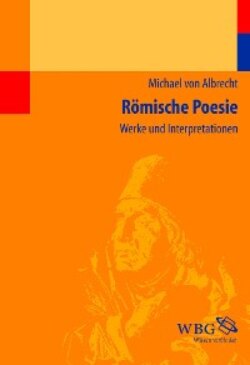Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 23
5. Rückblick und Ausblick Metrisches
Оглавление1. Daktylen und Spondeen. Hinsichtlich der Häufigkeit der Daktylen folgt Vergil Homer in geringem Abstand (Homer 36:10 = 3,6; Vergil 28:9 = 3,11), Lucan dagegen (23:9 = 2,55) steht Ennius (20:8 = 2,5) überraschend nahe. In der Vielfalt der Anordnung von Daktylen und Spondeen stehen ebenfalls Vergil und Homer an der Spitze: Homer (10 Verse, 8 Arten), Vergil (9 Verse, 8 Arten), Ennius (8 Verse, 6 Arten), Lucan (9 Verse, 6 Arten). Die Abfolge von Daktylen und Spondeen ist bei allen betrachteten Dichtern außer bei Lucan recht frei. In dem untersuchten Abschnitt besitzen bei Homer, Ennius und Vergil nur je zwei Verse symmetrische Struktur, bei Lucan dagegen sechs! Dieser Dichter hat also am meisten für Glätte gesorgt.25
2. Wortgrenzen. Was die Wortgrenzen (Zäsuren) betrifft, kennt Ennius einen Typus mehr als die anderen Römer, da er fünfsilbige Wörter am Versende nicht vermeidet. Ennius und Vergil verwenden hier bis zu dreimal hintereinander denselben Typus, Lucan viermal. Bei Ennius herrscht die Tendenz, im ersten Fuß des Hexameters Wortakzent und Longum zusammenfallen zu lassen; Vergil und Lucan streben hier nach größerer Abwechslung. Es ist sicherlich auch mehr als ein Zufall, dass bei Lucan die Gruppierung im Ganzen am geordnetsten und übersichtlichsten erscheint.
3. Satz und Vers. Die Homerstelle gliedert sich in sieben plus drei Verse; sonst finden sich fast durchgehend Enjambements, die trotz der relativen Kürze der einzelnen Kola einen natürlichen rhythmischen Fluss herstellen. Bei Ennius, dessen Gleichnis aus zweimal vier Versen besteht, herrscht strengste Symmetrie: Beide Teile sind analog aufgebaut, nur jeweils der Schlusssatz greift über die Versgrenze hinaus.
Vergil überwindet den Schematismus des Ennius und gestaltet eine einheitliche Gesamtstruktur mit Einleitung, zwei Anläufen und einem Höhepunkt. Von Homer übernimmt er die strömende Wirkung des Enjambements; doch fügt er im letzten Hauptteil eine spannungsreiche Parenthese ein. Vergils Satzbau verbindet also homerischen Fluss mit ennianisch-hellenistischer Rationalität. Bei Lucan stimmen Satz und Vers weitgehend überein. Enjambement tritt an Stellen auf, an denen das Versende eine rhetorisch effektvolle Kunstpause entstehen lässt, z.B. bellum /– atque virum oder: nec quicquam … obstat /– iam praeter … hastas.