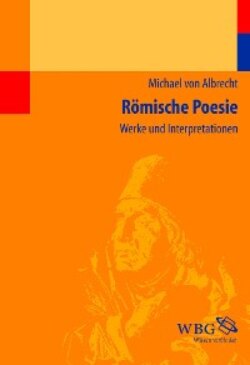Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 38
Zum Gehalt
Оглавление1. Die Naturgesetze und die Musen. Gegen Ende des zweiten Georgica-Buches, das von der Baumpflege handelt, vor allem von der Kultur der Weinrebe, kommt der Dichter im Zusammenhang mit dem Lob des Landlebens auf sich selbst zu sprechen. Sein „erster“ Wunsch (nicht sein letzter und eigentlicher!) wäre es, die Musen, denen er das Epitheton dulces (475) gibt, mögen ihn die Naturgesetze durchschauen lassen. Vergleichbar ist die Anrede des Aratos (Phainomena 17): μειλίχιαι. Das griechische Adjektiv meint die sanfte Kraft des Überredens, das lateinische hat eine gemüthafte Nuance; Vergil bezieht es mit Vorliebe auf die Heimat und die allernächsten Angehörigen. Er steht den Musen innerlich nahe, ist von übermächtiger Liebe ergriffen (ingenti percussus amore 476), dem Lukrez ähnlich, doch ohne wie dieser als Motiv laudis spes zu nennen (1,923ff.). Als Träger der Heiligtümer der Musen denkt er zunächst an die Ehre dieser Gottheiten, möchte nicht Ruhm ernten, sondern von den Musen „akzeptiert“ werden. Eine solche Haltung kann nur als religiös bezeichnet werden; die Anklänge an Lukrez unterstreichen den inneren Gegensatz.
Vergil wünscht von den Musen Aufschluss über die Naturgesetze; schon Homer ruft sie, wenn er übermenschliches Wissen benötigt;6 Vergil tut es am Anfang der Aeneis, um seinem Gedächtnis welthistorische Tiefe zu verleihen und nach den in grauer Vorzeit liegenden Ursachen von Junos Zorn zu forschen; hier in den Georgica will er dem Bewusstsein nicht im Zeitlichen, sondern im Räumlichen kosmische Weite geben; das umfassende Thema kann nur in einer Reihe von Fragen angedeutet werden: Lauf der Gestirne, Finsternisse, Erdbeben, Flut und Ebbe7 und die unterschiedliche Länge des Tages im Sommer und im Winter. Es sind dies traditionelle Probleme der Naturphilosophie seit den Vorsokratikern; die Erwähnung der Sterne ist wohl eine Huldigung an Arat, das Folgende an Lukrez (was wörtliche Anklänge bestätigen).8 Sollte aber solches Vergil verwehrt sein – wie er scherzhaft andeutet, mangels geistiger Beweglichkeit9 –, dann möge ihm das Land mit seinen Tälern, Strömen und Wäldern Glücks genug sein. Das Verb amare (486) beschwört eine Gemütsbindung; das stolz bescheidene inglorius („ruhmlos“) ist die Antwort auf Lukrezens spes laudis und spielt geistreich gegen den epikureischen Didaktiker das epikureische „Lebe im Verborgenen!“ (λάε βιώσας) aus. Wie Lukrez dem Empedokles, so folgt Vergil Lukrez nach, ohne die Anschauungen des Vorgängers zu übernehmen.
Der an Katastrophen reichen Welt des Naturphilosophen stellt Vergil das Beheimatetsein in einer Kulturlandschaft gegenüber, die sich unter Einwirkung griechischer Assoziationen bald in eine dionysische Dichterlandschaft verwandelt: Bei dem Spercheios denkt man noch an die herdenreichen Weiden, die ihn – nach Aischylos10 – umgeben, aber der Taygetos wird als Schauplatz dionysischer Mysterien genannt (487f.). Der Haemus mag als Berg des nördlichen Thrakien die Heimat des Orpheus11 beschwören. Das Streben nach Geborgenheit verdichtet sich zur Anschauung: „Und er beschirme mich mit dem riesigen Schatten seiner Äste“ et ingenti ramorum protegat umbra (489) – ein Bild, das für den Römer epikureische Assoziationen weckt.12 Die folgenden drei Verse preisen den epikureischen Philosophen glücklich; offensichtlich ist auf Lukrez angespielt.13 Der Ausdruck rerum causae kommt freilich bei diesem nicht vor; Vergil ist in seinem Sprachgebrauch konsistent, wenn er hier wie auch später in der Aeneis (1,8) die causae für etwas hält, das nur den Musen oder von ihnen Begnadeten zugänglich ist (vgl. oben 475ff., bes. unde … qua vi 479).
2. Felix – fortunatus. Neben den lukrezischen Geisteshelden stellt Vergil denjenigen, der die Götter des Landlebens kennt. Von den im ersten Prooemium angerufenen Gottheiten nennt er hier Pan, Silvan und die Nymphen. Der abstrakten philosophischen Erkenntnis (cognoscere 490) tritt der vertraute Umgang mit den göttlichen Naturmächten gegenüber, wie er dem auf dem Lande Lebenden gegeben ist. Die sakrale Note ist auch hier unüberhörbar; man erinnert sich daran, dass die Welt der Eklogen von göttlichen und menschlichen Wesen gemeinsam bevölkert ist. Der Philosoph lukrezischer Prägung erhält das Attribut felix (490), der vergilische Freund der ländlichen Götter hingegen fortunatus (493). Synonyme?14 Felix heißt „glücklich“ mit der Nuance des Erfolgreichen, fortunatus „vom Glück begünstigt“ oder „mit Glück gesegnet“, es kann also darin der Gedanke an Begnadung mitschwingen.