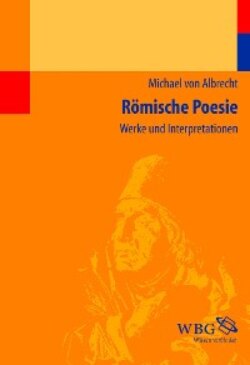Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 39
Metrisches
Оглавление1. Daktylen und Spondeen15. Der vergilische Charakter der Partie ist ohne Weiteres erkennbar, wenn man sie mit der durchschnittlichen Häufigkeitsskala der Hexameterformen bei Vergil vergleicht. Innerhalb der ersten neun Formen ist die Frequenz relativ hoch; nur der Typus Nr. 7 fällt aus; dafür sind Nr. 8 und 9 je zweimal vertreten. Die selteneren Formen Nr. 10 bis 16 kommen, wie zu erwarten, in unserem kurzen Textstück kaum vor (insgesamt zwei Belege). Keine einzige Hexameterform tritt zweimal hintereinander auf: Vergil strebt nach Abwechslung;16 seine Hexameter sind wohlklingend, aber nicht monoton. Zweimal erscheint die Form ssss, und zwar in gliedernder Funktion; in beiden Fällen leitet sie einen neuen Abschnitt ein. Der gleichmäßig ruhige Fluss der Verse scheint einem immanenten Gesetz zu folgen. Doch fehlt es nicht an Expressivität: So drückt die seltenste Form sddd (Nr. 16) durch ihren erst stockenden, dann rasch dahineilenden Gang den Sieg über das Rauschen des Acherons aus: subiecit (nachdrücklicher Spondeus) pedibus strepitumque Acherontis avari (unruhige Daktylen in Verbindung mit Geräuschlauten). Die Trägheit des Winters kommt in Spondeen zum Ausdruck (482): … hiberni, vel quae tardis mora noctibus obstet. Diese von Vergil statistisch erst an viertletzter Stelle (Typus Nr. 13) benützte Form sssd ist hier um ihrer malerischen Wirkung willen gewählt. Das Wort mora, das den vierten Fuß zum reinen Daktylus werden lässt, bildet absichtlich einen kleinen Aufenthalt; die statistisch ungleich häufigere Form ssss hätte glatter gewirkt.
2. Zäsuren und Dihäresen. In Vers 476 überspielen Synaloephen die Penthemimeres, so dass ein Einschnitt erst in der Hephthemimeres eintritt – entsprechend dem Inhalt; es ist vom Übermaß der Liebe die Rede: quarum sacra fero ingenti percussus amore. In Vers 488 ist vor der Trithemimeres das den nächsten Satz einleitende Monosyllabon ‚o‘ durch Synaloephe noch vor die Zäsur gezogen, eine Praxis, die dem Vergil-Leser vertraut ist.17 Gewiss beabsichtigt ist auch die Gegenüberstellung des Philosophen, dessen Charakteristik drei ‚männliche‘ Zäsuren enthält, und des poetischen Landmanns, dessen Auftreten zwei ‚weibliche‘ Zäsuren begleiten (493f.):18 in römischer Dichtung eine Seltenheit. Die Selbstcharakteristik enthält also metrisch das „Sanfte und Geistreiche“ (molle atque facetum), das Vergil auch nach Horazens Urteil eigen war (sat. 1, 10, 44 f). Zweimal wird die bukolische Dihärese durch Synaloephe überspielt, während vom Auf- und Abschwellen des Wassers die Rede ist: … maria alta tumescant/… in se ipsa residant (479f.). Der Vers, der als einzige Zäsur eine Hephthemimeres besitzt (487), handelt von dionysischer Begeisterung; es kommt hinzu, dass er zwei griechische Eigennamen enthält (vgl. auch 494).
3. Satz und Vers. Öfter als bei Lukrez stimmen hier Satz- und Versschluss überein; auch die Grenzen der Nebensätze fallen meist mit dem Ende des Hexameters oder mit der Penthemimeres (479f.) zusammen. Im Übrigen liegen auffällige Sinneseinschnitte zweimal in der Trithemimeres (482 und 488, an der zweiten Stelle allerdings mit Synaloephe), einmal in der bukolischen Dihärese (486), einmal in der Zäsur nach dem dritten Trochäus. Doch können all diese Fugen den ruhigen Fluss des Ganzen nicht stören. Auch Vergil baut große Zusammenhänge auf; so umfasst die erste Periode die Verse 475–482; doch wirkt das Satzgebilde anders als bei Lukrez. In den ersten Hauptsatz (475–478) ist ein Relativsatz eingeschoben, der den ganzen mittleren Vers umfasst; durch diese Einschaltung bilden die drei ersten Verse eine geschlossene Form; es folgt eine ergänzende Reihe von Objekten und Objektsätzen (478–482); in ihnen ist auf verschiedenen Ebenen Variation erstrebt: syntaktisch (Akkusative bzw. abhängige Fragesätze), im Ausdruck (unde; qua vi; quid; vel quae) und im Umfang der Glieder: 478 ein Hexameter; 479 ein halber Hexameter; 479/80 von der Penthemimeres bis zur Penthemimeres des folgenden Verses; 480 von der Penthemimeres bis zum Versschluss; 481 f bis zur Trithemimeres; 482 von der Trithemimeres bis zum Versende. So macht der Dichter aus einer Aufzählung eine rhythmisch abwechslungsreiche Reihe. Von den Feinheiten der Behandlung des Metrums haben wir schon gesprochen; bezeichnend ist auch das Übergreifen des Satzes auf den nächsten Vers, während von der Flut die Rede ist (479f.), und der absichtliche Verstoß gegen das sogenannte Gesetz der wachsenden Glieder (das ja nur ein Stilprinzip ist) in Vers 479f.: Das Anschwellen ist sinnigerweise umfangreicher behandelt als das Abschwellen (ähnlich auch 481f.). Die ersten drei Verse (475ff.) werden somit durch Einschachtelungstechnik zu einer Einheit; die späteren durch Übergreifen und Variation. Die Verse 483–485 bilden ebenfalls ein in sich geschlossenes Satzgefüge, wobei zunächst ein Nebensatz in den anderen eingebettet und dem Hauptsatz vorausgeschickt ist; der Gedanke des Hauptsatzes wird in einem kurzen Satz verschärft wieder aufgenommen: flumina amem silvasque inglorius (486). Der Verzicht auf Ruhm ist metrisch von einem auffallenden Verzicht auf den vollen Versumfang begleitet; nur hier beginnt der folgende Satz in der bukolischen Dihärese. Vergil verwendet also systematisch die (dem Behaghelschen Gesetz zuwiderlaufende) Abfolge: langer Satz – kurzer Satz. Das verfrühte Eintreten des Folgenden wird außerdem durch die affektische Form motiviert (o 486). Das o wird in Vers 488 vor der Trithemimeres wieder aufgenommen. Erst am Ende von 489 ist erneut ein Ruhepunkt erreicht. Die beiden Seligpreisungen bestehen aus drei bzw. zwei19 Versen, wobei in der ersten Gruppe der zweite und dritte Vers syntaktisch eng zusammengehören. Das für Lukrez charakteristische Enjambement ‚Adjektiv – Versfuge – Substantiv‘ ist in unserem Text nicht zu beobachten, einmal jedoch das umgekehrte: 481f. soles /hiberni.
4. Wortstellung. Abbildende Wortstellung finden wir in Vers 484: frigidus obstiterit circum praecordia sanguis. Sperrung von Adjektiv und Substantiv zwischen Penthemimeres und Versschluss liegt in Vers 485 und 489, zwischen Hephthemimeres und Versschluss in Vers 475 vor. Die Verse 487f. sind in verschiedener Weise von griechischen Eigennamen umrahmt; der Wunsch nach Entrückung kommt durch die fremden Klänge zum Ausdruck. Alle beobachteten Einzelheiten drängen sich jedoch nicht in den Vordergrund, sondern fügen sich unauffällig dem Ganzen ein.