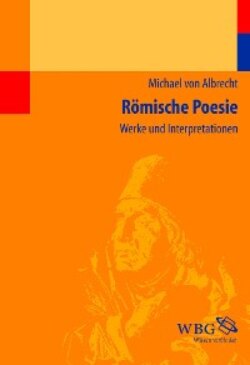Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 21
Die eigentliche Bedrängnis-Szene
Оглавление1. Umgestaltung von Motiven: Steigerung. Die klassische Bedrängnissituation ist so vorbereitet, dass sie als Gipfel und Endpunkt empfunden wird (806ff.): Der Held kann weder mit dem Schild noch mit der Rechten standhalten. Die homerische Vorstellung „er hielt nicht mehr stand“ ist in polarer Ausdrucksweise zerlegt. Zugleich wird der Krieger noch mehr entschuldigt: Der Zusatz „er vermag nicht mehr standzuhalten“ nimmt ihm die Verantwortung vollends ab. Auch Homers Feststellung „er wurde durch die Geschosse bedrängt“ ist (z.T. nach Ennius) gesteigert: „er wird von allen Seiten so sehr mit Geschossen überschüttet“ (807f.). Im Folgenden verschärft Vergil die Notlage des Helden, indem er nicht etwa die Solidität des Helms betont, sondern die Waffen beschädigt werden lässt; so ist Turnus moralisch entlastet. Homer hatte daran anschließend in einem Zwischensatz nochmals hervorgehoben, dass die Feinde, obwohl sie von allen Seiten angriffen, Aias nicht erschüttern konnten (107f.). Vergil intensiviert dafür einseitig die Wucht des feindlichen Angriffs: „mit doppelter Kraft dringen die Troer und Mnestheus, dem Blitze gleich, mit ihren Lanzen an“ (811f.). Turnus – der Leidende und Bedrängte! Eine Steigerung bedeutet der Umfang des letzten Satzes; die Unmöglichkeit einer Atempause ist in Parenthese erwähnt; dadurch erhält der Satz selbst etwas Angespanntes und Keuchendes.
2. Symbolische Bedeutung: Stimmung. Der Schluss lehnt sich an Homer an:19 Schweiß rinnt dem Helden am ganzen Körper herab; Vergil konkretisiert diese Vorstellung in kühner Hyperbel zum Bild eines pechschwarzen Stromes. Die Farbe hat hier wohl symbolische Bedeutung. Die Situation deutet in ihrer Ausweglosigkeit auf das zwölfte Buch voraus; Turnus wird im Zeichen der Todesverfallenheit, von Juno und den eigenen Kräften verlassen, zum leidenden Opfer. Müdigkeit der Glieder, von Homer in der Mitte des Gleichnisses betont, erwähnt Vergil am Anfang und am Ende. Wenige Verse führen das Buch zu Ende: Turnus springt in den Fluss, der das Mordblut von ihm abwäscht,20 und kehrt zu seinen Gefährten zurück. Das düstere Finale klingt zwar deutlich an, aber Turnus ist noch einmal seinem Schicksal entronnen.
3. Unterschiedliche Funktion der Szene bei Vergil und Homer. Vergils Ausgestaltung der defensiven Situation entspricht der abschließenden Funktion der Szene. Bei Homer aber bereitet die Szene den Rückzug des Aias vor; den Endpunkt bildet nicht die Situationsschilderung, sondern ein dramatisch wirkungsvolles Götterzeichen.
4. Perspektive. Vergil zeigt alles aus der Sicht des Helden. Bei Ennius gleicht der Anfang einem Naturereignis (Vergil greift nicht auf die Vorstellung des Regens zurück); das Klingeln beobachtet Ennius impressionistisch von außen. Bei Vergil ist es der Bedrängte, den das Klingeln irritiert. Der Held erlebt den Vorgang im Wesentlichen passiv;21 so spiegelt sich äußere Bewegung in Seelenbewegung. Ennius stellt die im äußeren Geschehen pulsierende Kraft, Vergil die begleitende Empfindung dar.
5. Bewegungscharakter. Bei Vergil herrscht kein Staccato, sondern Legato. Das Geschehen wird von dem Bedrängten in einem durchgehenden Crescendo erlebt. Schon der erste Satz ist aus der Perspektive des Helden gesehen und ohne äußere Dynamik: ergo nec clipeo iuvenis subsistere tantum /nec dextra valet. Auch die einzelnen Etappen sind zu Einheiten zusammengezogen, die über die Versgrenzen hinausgreifend ein ruhiges Fließen erzeugen. Überhaupt ist der Satzbau geraffter; besonders ausdrucksvoll ist die Parenthese nec respirare potestas. Zwar strebt auch Vergil wie Ennius nach rationaler Straffung (davon zeugen Partikeln wie nec … nec, sic … tum), doch ist allzu schematische Symmetrie vermieden und im Ganzen eine Steigerung erzielt: Vergil gestaltet die Szene als Endpunkt eines Buches.
6. Dramatischer Aufbau. Obwohl der Held passiv ist, wird der Vorgang dramatisiert. Anders als bei Ennius zerfällt der Abschnitt nicht in zwei gleiche Teile. Auf zwei einleitende allgemeine Sätze folgt ein erster Anlauf in vier Kola. Dann jedoch setzt eine zweite Welle ein: Der Ansturm verdoppelt sich. Danach bezeichnet ein langer Satz die Folgen der beiden Angriffe für den Helden. Incohativa und andere Verben suggerieren einen Fortschritt und eine Steigerung (ingeminant). In der Häufigkeit der Enjambements berührt sich Vergil mit Homer, doch gruppiert er (wie Ennius) die Motive ‚logischer‘. Am Ende strebt er nach bildhafter Vergegenwärtigung; die Tendenz, die Bewegung trotzdem nicht aufhören zu lassen, führt u.a. zu dem auffallenden „pechschwarzen Strom“22. Bei Ennius war der Wille des Zeus (soweit wir sehen können) weggefallen, bei Vergil ist der numinose Schrecken in gewandelter Form wieder gegenwärtig; die Stimmung der Szene nimmt den Zustand der Lähmung vorweg, den Turnus im letzten Kampf des zwölften Buches erleben wird. Dämonisch die Vielzahl der aktiven Subjekte, die Turnus peinigen: sudor, anhelitus (bei Homer ist dagegen Aias passivisches Subjekt: ἔχετ’ ἄσνματι.); so entsteht auf neuer Stufe ein Äquivalent zu Homers dämonischem Satz ›Übel war an Übel gereiht‹. Syntaktisch ist der Höhepunkt, der in doppeltem Anlauf erreicht wird, durch die erwähnte Parenthese hervorgehoben.23 Inhaltlich gipfelt Vergils Szene in einem auf den Helden bezogenen Bild, während Homer und Ennius den Blick der Umwelt zuwandten. Bei Vergil erscheint das Geschehen als Ganzheit, nachempfunden aus der Seele des Helden, bei Ennius als Summe einzelner Bewegungen, die sich mit pulsierender Kraft vollziehen. Ennius achtet mehr auf vibrierende Dynamik, Vergil auf dramatisches Nacheinander.