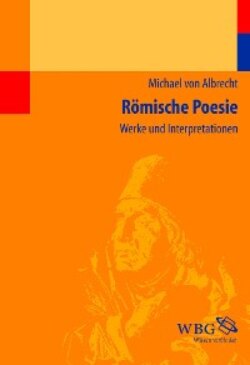Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 6
Einführung1
ОглавлениеZunächst verachtet und von Kriegsgefangenen, Sklaven, Klienten getragen, musste sich die römische Poesie im eigenen Hause ihr Heimatrecht erkämpfen. Liegt vielleicht gerade in der Schwierigkeit der Produktionsbedingungen ein Schlüssel zu ihrer weitreichenden Wirkung? Unsere Literaturgattungen tragen Namen, die sie in Rom hatten. Die Zeit liegt nicht sehr weit zurück, als man in Europa Vergil für den größten aller Dichter hielt, und so manche Nationalliteratur rechnet immer noch Vergil, Ovid, Juvenal, Statius, Martial voller Stolz zu den Ihren. Heute, wo die Daseinsberechtigung der Dichtung vielfach in Frage gestellt wird, mag der Blick auf eine Poesie lehrreich sein, die in ihrer Gesellschaft zunächst ein Fremdkörper zu sein schien und sich dennoch zu weltweiter Geltung entwickelte: ein Fall gelungener Selbstbestimmung.
Weit ist die Streuung der Gattungen, vieles von griechischem Zuschnitt, anderes –Satire, Epistel, wohl auch die Liebeselegie – von starker Eigenprägung. Fremdes wird anverwandelt, dem gesellschaftlichen, persönlichen und literarischen Selbstverständnis dienstbar gemacht. Ja, oft scheint gerade die strengste Schule einen Dichter am sichersten zu sich selbst zu führen. Vergil und Theokrit, Vergil und Homer: Wo endet in diesem ‚Ringen mit dem Engel‘ die Unterordnung, wo beginnt das Gipfelgespräch? Vielleicht konnte nur, wer in solchem Maße Schüler war, Meister werden. Die Literatur des frühen und klassischen Griechentums, sowie die unbarmherzige Strenge hellenistischer Kunstübung und poetisch-philologischer Reflexion waren für die römische Poesie wohl die härtesten und fruchtbarsten Herausforderungen.
Gibt es heute fast kein nationales Problem, das keinen internationalen Aspekt hätte, so mag eine Nationalliteratur Beachtung heischen, die seit ihren Anfängen kaum ethnische, soziale und geographische Grenzen kennt: Fremde und Abhängige sind ihre Pioniere, Provinzler aus Unteritalien, Umbrien, Gallien, Spanien, Afrika … Das Völkerverbindende ist lateinischer Dichtung auch heute noch eigen.
Doch was trug Rom zur römischen Poesie bei? War es nur Bühne? Schon dies wäre viel; denn Talente sind auf Auftraggeber von Geist und Geschmack angewiesen. War Rom der Brennpunkt, in dem sich die Strahlen der damaligen zivilisierten Welt sammelten und wechselseitig verstärkten? Mehr noch: Es war ein Stern mit eigenem Licht. Weit entfernt, nur physisches Machtzentrum zu sein, war Rom ein geistiger Mittelpunkt. Bei allem Imperialismus, der nicht beschönigt werden darf, bewies es doch auch Aufgeschlossenheit für andere und deren Rechte. Es ist nicht einerlei, ob in einem Weltstaat Kategorien wie fides existieren oder nicht – selbst wenn sie in der Praxis verletzt werden. Unverwechselbar vorgeprägt ist bereits das Instrument, auf dem die Dichter, woher sie auch kommen mögen, spielen: eine Sprache, die stolz und eigenwillig auch dem lateinisch schreibenden Fremden das geistige Gepräge seines Publikums aufzwingt; eine Bauernsprache, dem Spott nicht abhold, zu epigrammatischer Zuspitzung fähig, knapp das Wesentliche umreißend, aber auch die Sprache einer Republik, geeignet, zwischenmenschliche Beziehungen, Rechtsverhältnisse wie auch unwägbare moralische Bindungen zu benennen sowie in geformter Rede auf Menschen einzuwirken. Dem ersten Aufkommen der Kunstpoesie geht die Entwicklung mündlicher politischer Redepraxis voraus, eine Abfolge, die sich in der klassischen Zeit wiederholt: Die Hochblüte der Rede – Cicero – liegt eine Generation vor derjenigen der augusteischen Dichtung. „Rhetorik“ ist in Rom kein Schimpfwort. Liegt doch darin ein Element sprachlicher Bewusstheit, ein „instrumentales“ Verhältnis zum Wort. Wie der römische Architekt die Fassade auf den Betrachter hin gestaltet, so bezieht der römische Autor seine Sprachkunst auf den Leser, besser gesagt, den Hörer.
Lateinische Verse sind fürs Ohr bestimmt, nicht allein fürs Auge. Stilles Lesen ist kaum bekannt; das Verhalten des Aufnehmenden ähnelt also dem des heutigen Konzertbesuchers. Was wäre Musik ohne Aufführung? So lebt Dichtung im Vorgetragenwerden, bleibt ungeachtet ihres hochstilisierten Kunstcharakters kommunikativ, an den Vollzug gebunden. Ihre Laute, ihre Rhythmen schwingen von Mensch zu Mensch, ›fliegen (nach einem Wort des Ennius) lebendig von Mund zu Mund‹.
Bei aller Bezogenheit auf das Publikum verliert die Poesie nicht ihre Eigengesetzlichkeit. Formsinn und Organisationstalent, verfeinert durch hellenistischen Kunstverstand, bringen das Architektonisch-Musikalische so klar ans Licht, dass Parallelen zur französischen poésie absolue gezogen werden konnten. So treten zwei Aspekte, die heute wiederum die poetologische Diskussion bestimmen, an der römischen Dichtung hervor: der gesellschaftliche Bezug und die Artifizialität.
Ferner rechnet poetisches Sprechen in Rom mit nüchternen Lesern, die mitten im Leben stehen. Glaubt doch die römische Philosophie an den Vorrang der Erfahrung vor der Theorie (für Cicero besteht Tugend nur in ihrer praktischen Verwirklichung: virtus in usu sui tota posita est). Gilt so nicht auch für die Poesie die Voraussetzung, das Wort habe die Funktion, eine Sache verständlich zu machen?
Im Folgenden sollen Texte und Interpretationen vorgelegt werden, keine Literaturgeschichte und auch keine geschlossene Literaturtheorie – bestenfalls Bausteine dazu. Die Gliederung nach Gattungen erlaubt, formal oder inhaltlich Verwandtes zusammenzustellen. Obwohl ich nicht an die Existenz metaphysischer Wesenheiten namens „Elegie“ usw. zu glauben vermag, trifft doch zu, dass nicht Vorbilder allein, sondern auch aus ihnen abstrahierte Theorien das poetische Schaffen beeinflussen können, also berücksichtigt sein wollen. Ausgangspunkt ist jedoch der konkrete Text. Da die Autarkie der Genera nur eine relative ist, bestehen Überschneidungen: etwa zwischen didaktischer Poesie, Satire und Fabel; Elegie, Lyrik und Epigramm: Vieles, was wir heute „Lyrik“ nennen, rechnet die Antike dem Epigramm zu; ja, oft bereichern Dichter ein Genos durch Züge des anderen oder schaffen gar „neue“ Gattungen.
Die Auswahl ist durch äußere und innere Kriterien bestimmt. Gebiete, die sich für eine interpretierende Darstellung nicht ohne Weiteres eignen, bleiben beiseite. So erfordern die fragmentarisch erhaltenen altlateinischen Dichtertexte andere Formen der Darlegung, die sich bald mehr der textkritisch-philologischen Untersuchung, bald der literarhistorischen Synthese nähern. Aus einem anderen Grund fehlt die dramatische Kunst: Ihre Gesetzmäßigkeiten sind von solcher Eigenart und die Probleme der Gesamtstruktur darin so vorherrschend, dass eine Besprechung im Stil der hier vereinigten Einzelinterpretationen nicht möglich scheint. Auf Panegyricus und Invektive ist verzichtet, da eine Behandlung nur im Zusammenhang mit entsprechender Prosa fruchtbar wäre. Die Notwendigkeit, das Buch nicht über Gebühr anschwellen zu lassen, zwingt zur Beschränkung. Weitere Interpretationen zu Epikern und Elegikern erscheinen an anderer Stelle (Große römische Autoren II und III, Heidelberg 2013). Ovids Metamorphosen soll ein eigener Band gewidmet werden. Zum Fortwirken römischer Dichter finden sich Beiträge in meinen Büchern Rom: Spiegel Europas (Tübingen 21995) und Literatur als Brücke (Hildesheim 2003).
Zu den inneren Kriterien der Auswahl gehört das Bestreben, Vielfalt und Einheit der römischen Dichtung sichtbar zu machen. Darum ist die christliche Verskunst nicht ganz mit Stillschweigen übergangen; ist doch ein Grundzug römischer Poesie ihre Renaissancefähigkeit. Umgekehrt musste beim Epos auf Homer zurückgegriffen werden, um die lebendige Kraft dessen, was man Tradition nennt, zu dokumentieren.
Hinzu kommt die Absicht, Dichter über ihr Dichten sprechen zu lassen. Eine Geschichte der antiken Poetik gibt es noch nicht, noch weniger der Poetiken, die im einzelnen Werk theoretisch und praktisch zum Ausdruck kommen. Mögen diese Blätter spürbar machen, dass die Praxis der Poeten oft reicher ist als ihre Theorien. Auch die Geschichte der lateinischen Dichtersprache ist noch ungeschrieben. Bei der ständigen Frage nach Sprache, Stil und Metrum in ihrem Bezug zum Gegenstand und zum Leser kommt dem Interpreten diese Lücke schmerzlich zum Bewusstsein.
Die historische Literaturbetrachtung bleibt der Literaturgeschichte vorbehalten; immerhin mag unsere Textauswahl dazu anregen, Wandlungen des Welt- und Menschenbildes zu beobachten: Schon beim „frühen“ Homer wird aus dem „Helden in Bedrängnis“ der Mensch in Bedrängnis, Vergil stellt dann in homerischen Formen eine wiederum ganz andersartige Sicht des Heldentums dar, Lucan führt den Heros durch Übersteigerung bis an die Schwelle zum Märtyrer. Prudentius gießt seine christliche Auffassung von der Welt und vom Dichter in horazische Kunstgestalt. Wandel herrscht auch in der Erfahrung des Göttlichen – bis hin zur Begegnung Catulls mit der dämonischen Lesbia. Ererbte gesellschaftliche Wertvorstellungen werden umgeprägt: Weit ist der Weg von altrömischer pietas zu der des Erotikers Catull oder der des religionsfeindlichen Lukrez. Immer neu stellt sich die Frage nach dem Sinn des Sagens zwischen Spiel und Wahrheit, zwischen Verbergen und Enthüllen.
Die den Kapiteln beigegebenen thematischen Überschriften können nur als Denkanstöße dienen und keineswegs den Inhalt der Texte erschöpfen. Am allerwenigsten ist der Eindruck beabsichtigt, die ausgewählten Proben vermittelten eine lückenlose Vorstellung von dem jeweiligen Autor; vielmehr erhoffen wir uns eine Hinführung zu der heute so dringend erwünschten Beschäftigung mit Ganzschriften.
Nur mit Behutsamkeit sei von zwei Aspekten gesprochen, ohne die jedes Reden über römische Dichtung ins Bodenlose versinkt: Individualität und Größe. Sonderbar genug: Beides konnte sich in Rom entfalten, obwohl die äußeren Bedingungen für das Schaffen der Dichter nicht immer die besten waren. Ehe man über das angeblich so ungeistige Römerreich den Stab bricht, mag man sich fragen, ob Dichtung heute mehr Lebensraum besitzt. Die Tatsache, dass Roms Poesie das Imperium überlebt hat, zeigt, dass äußerlich Machtloses sich oft als das Stärkere erweisen kann.
Im Methodischen ist Vielseitigkeit erstrebt. Die fortlaufende Interpretation ist Grundlage des Verstehens, da der Hörer den Text im zeitlichen Verlauf aufnimmt. Ergänzend kommen ‚Längsschnitte‘ hinzu sowie Analysen des Metrums, die den Stellenwert des Einzelnen im Kontext berücksichtigen. Beim Vorgehen nach ‚Querschnitten‘ kann etwa der Wortschatz den Ausgangspunkt bilden. Weiter bietet sich – gerade bei traditionsbewusster Literatur – der differenzierende Vergleich an.
Möge die absichtliche Vielfalt der Interpretationswege als Anregung für Lehrende und Lernende verstanden werden, Freude an lateinischer Poesie wecken und das Bewusstsein von ihrer Lebenskraft wach halten. Wird in dem vorliegenden Buch gute Literatur weniger gelobt als dargestellt, so im Vertrauen auf die Entdeckerfreude des Lesers. Werden gängige Klischees in Zweifel gezogen, so nicht um fertige Meinungen durch andere zu ersetzen, sondern um von dem Umgang mit den Texten Rechenschaft abzulegen und den Leser anzuregen, mit ihnen ein Stück Weges weiter zu gehen. In Frage gestellt sei besonders der Vulgärbegriff der „toten Sprache“. Welche Sprache verdient lebendig genannt zu werden, wenn nicht die Dichtersprache?