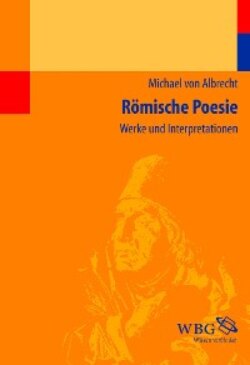Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 19
Die Gestaltung der Gleichnisse
Оглавление1. Würde. Bei Homer ist das würdevolle Löwengleichnis von zwei anderen umgeben. Das erste vom fliehenden Wild ist wenig ehrenvoll und passt schlecht zu dem allmählichen Rückzug, der einem großen Helden ansteht. Das hat Vergil empfunden und das erste Gleichnis weggelassen. Der Situation angemessen ist dagegen das dritte (556f.); langsames Zurückweichen kann kaum besser charakterisiert werden als durch das Bild des störrischen Esels. Für Vergils Kunstwollen ist es charakteristisch, dass er auch dieses drastische Gleichnis aufgibt. Es scheint ihm mit dem Rang eines epischen Helden unvereinbar. Für den römischen Dichter tritt hier die Lebenswahrheit hinter der Würde zurück, was schon M. Hieronymus Vida in seiner Poetik hervorgehoben hat.18
2. Pittoreske Einzelheiten. So bleibt dem Römer nur das Löwengleichnis. Er reduziert es jedoch auf die bedeutsamen Elemente; die meisten pittoresken Einzelheiten entfallen: der Viehhof, das Rinderfett, das Fleisch, nach dem das Raubtier lechzt, die Fackeln, vor denen der Löwe Angst hat. Die Hunde und Landleute (Homer nennt sie in dieser chronologisch richtigen Reihenfolge) werden zu einer abstrakten turba; schließlich verschwinden auch die Hinweise auf die zeitliche Ausdehnung des Vorgangs: Homers Hirten wachen „die ganze Nacht“ (Ilias 11, 551), der Löwe zieht sich erst „gegen Morgen“ (555) zurück; sein Resignieren ist gründlich vorbereitet und durch äußere Umstände motiviert. So erweckt Homer die Vorstellung eines realen Vorgangs in seiner Totalität; Zeitangaben sollen diese Ganzheit fühlbar machen.
3. Affektisches. Vergil hingegen steigert die affektischen Elemente durch Häufung entsprechender Beiwörter und Abstrakta: saevom 792, infensis 793, territus 793, asper, acerba 794, ira 795, virtus 795, exaestuat ira 798. Hier ist alles auf die Wut bezogen, einen Affekt, der zweifellos heldenhafter ist als die Resignation des homerischen Löwen, der im Morgengrauen unverrichteter Dinge abzieht.
4. Konzentration. Homer konfrontiert den Leser nacheinander mit verschiedenen Empfindungen: der hungrigen Gier des Löwen im Widerstreit mit seiner Angst vor Waffen und Feuerbränden, gefolgt von Niedergeschlagenheit beim Hinweggehen. Bei Vergil dagegen steht ein einziger Affekt im Mittelpunkt, ira, und sie ist noch ausdrücklich mit virtus verbunden (795). Von Angst ist bei dem römischen Dichter also keine Rede mehr. Der einheitlichen Zielsetzung entsprechend ist das Gleichnis auch weitgehend seiner zeitlichen Ausdehnung beraubt und zum momentanen Porträt geworden. Dem Dichter liegt mehr am Inneren als an äußerer Ausmalung.