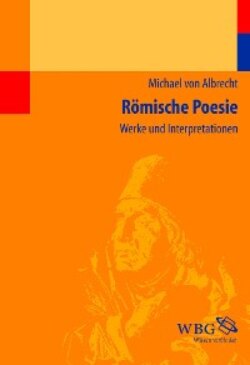Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 35
Das Schöne im Dienste des Nützlichen 25
Оглавление1. Zu dem Gleichnis. In erster Linie möchte der Dichter die Verwendung der poetischen Form vernünftig begründen (935). Es folgt ein Bild, das in verschiedenen Abwandlungen in der Antike auftaucht, wenn es darum geht, das Angenehme in den Dienst des Nützlichen zu stellen. So sprechen die Hesiodscholien in den Prolegomena von der Aufgabe des Metrons: „Das Ziel des Buches ist erzieherisch; das Versmaß aber ist wie ein ἥδυσμα (ein Mittel zur Steigerung des Wohlgeschmacks) über dieses Ziel der Darstellung gebreitet, die Seelen bezaubernd und in einer dem Metron entsprechenden wohlwollenden Stimmung haltend.“26 Platon, wie später Lukrez zugleich Mythenkritiker und Dichter, hat das Bild geprägt: „Damit nun die Seele des Knaben sich nicht angewöhnt, bei Lust und Schmerz in einen Gegensatz zu treten teils mit dem Gesetz selbst, teils mit den Personen, welche von der Richtigkeit des Gesetzes überzeugt sind, – damit sie vielmehr die gleiche Bahn betritt und Freude oder Leid nur über die gleichen Gegenstände empfindet wie der Greis: Deswegen sind die Lieder, wie wir sie nennen, eigentlich in Wahrheit, glaube ich, jetzt zu Zauberliedern geworden; denn ihr ganzes ernstlichstes Bestreben geht auf eine derartige Harmonie, wie wir sie geschildert. Weil aber das Gemüt der Jugend den tieferen Ernst noch nicht ertragen kann, so heißt man’s eben Spiel und Lied und treibt’s auch so. Es ist gerade wie bei Kranken und Patienten: Die zweckmäßige Nahrung probieren ihre Doktoren ihnen in gut schmeckenden Speisen und Getränken beizubringen; dagegen, was schädlich ist, stecken sie in schlecht schmeckende Sachen, damit der Kranke das eine gerne nimmt und das andere, ganz richtigerweise, abscheulich zu finden gewöhnt wird. So macht’s nun ein wackerer Gesetzgeber gerade auch mit den poetischen Talenten.“27 Platon geht es darum, jungen Menschen die Tugend durch die Poesie schmackhaft zu machen; Lukrez strebt nach Erhellung der Physik zum Zwecke der Freude und Seelenruhe. Man hat gemeint, es sei für ihn bezeichnend, dass er das Gleichnis aus dem Leben der Kinder wählt;28 zieht er doch auch sonst Unmündige als Beispiel heran. Hier freilich überwiegt ein nüchternes Moment: die Unerfahrenheit der Kinder, die sich leicht betrügen lässt (939). Da zudem schon Platon auf Jugendliche Bezug nimmt, erlaubt unsere Stelle keine Rückschlüsse auf Lukrezens Kinderliebe. Versteht man Philosophie als Heilung – eine Vorstellung, die Epikur vertraut war,29 – so liegt es nahe, den didaktischen Dichter mit einem Arzt zu vergleichen. Lukrez konnte also mit gutem Gewissen das Bild aus dem Ion aufnehmen. Altlateinisch ist die Stilisierung: Lukrez verbindet hier (wie Ennius) zwei Adjektive (dulci flavoque) mit einem einzigen Substantiv, was die Augusteer meiden. 30 Wesentlich ist der gleichzeitige Appell an zwei Sinne: Geschmack und Gesichtssinn. Das Hysteronproteron entspricht der Phantasie der Kinder: Die Vorstellung „süß“ drängt sich gebieterisch vor.
2. Spiel mit Worten? Ein Wortspiel liegt in deceptaque non capiatur (941) vor. Wie schon die altlateinischen Dichter schreibt Lukrez klang- und sprachbewusst: Er stellt Ennius mit perennis (1,117f.) zusammen, Calliope mit callida (6, 93f.), ignis mit lignum (1, 912 und 914), amor mit umor (4, 1054ff.), officium mit officere (1, 336). Besonders nahe stehen unserer Stelle folgende Wortspiele: effugiumque fugae prolatet copia (1, 983) und lumina luminibus quia nobis praepediuntur (3, 364). Soweit das Spiel einzelne Laute betrifft, ist es von P. Friedländer31 ansprechend als Analogon zur Atomtheorie erklärt worden – Buchstaben und Atome heißen gleichermaßen elementa, und Lukrez selbst vergleicht an vielen Stellen die Gruppierung von Atomen mit der von Lauten32 – so ausdrücklich im Falle von lignum und ignis;33 freilich kann man auch den Einfluss der Rhetorik nicht ausschließen, zumal es sich ja in unserem Falle nicht um Buchstaben und Laute, sondern um Semantisches handelt.34 Übrigens sollte man derartige Wortspiele nicht für etwas spezifisch Epikureisches halten. Jede Plautus- oder Ovidlektüre könnte uns eines Besseren belehren. Das Wortspiel hat hier eine bestimmte Aussagefunktion im Kontext: Den Trug, der in Wahrheit rettend ist, macht der Gleichklang von decipio und capio sinnfällig.35
3. Die Unerfahrenen. Der ‚So-Teil‘ des Gleichnisses offenbart nun das Ziel: Exemplifiziert werden soll das Verhältnis des Didaktikers zum Leser. Lukrez greift noch einmal auf die eingangs angedeuteten Bedenken des Publikums zurück. Dort hatte er die Schwierigkeit des Gegenstandes zugegeben; jetzt geht er auf die Vorurteile ein, mit denen er rechnen muss: quoniam haec ratio plerumque videtur /tristior esse quibus non est tractata (943f.). Nach Schrijvers36 soll das bedeuten: Diese Lehre erscheint denen meist zu trübselig, für die sie nicht behandelt worden ist. Darin scheint mir ein logischer Widerspruch zu liegen. Für wen wird sie denn behandelt? Für wen nicht? Diese Entscheidung wird doch erst von den Betroffenen endgültig gefällt. Zum andern: Schreibt Lukrez für solche, für die seine Lehre nicht behandelt worden ist, also für Ungeeignete? Dann könnte er es auch bleiben lassen. Somit ist quibus als dativus auctoris zu verstehen: Die Lehre scheint denjenigen zu trübsinnig, die mit ihr noch nicht umgegangen sind, nicht den Ungeeigneten, sondern den Unerfahrenen.
4. Vom Vergleich zur Metapher. Die Verse erhalten das Attribut suaviloquenti. So ist die Verbindung mit dem Bild gewahrt – Absicht des „Versüßens“ –; zugleich liegt darin eine Anspielung auf Ennius. Bei ihm sind derartige zusammengesetzte Adjektive zuerst belegt; er ist es auch, der die Beziehung zwischen suavis und suada (suadere „süß machen, mundgerecht machen, raten, empfehlen“) poetisch verwertet hat.37 Die Verbindung Musaeo melle38 ist im Lateinischen kühn, sie wird durch quasi entschuldigt. Im Übrigen ist sie sorgfältig vorbereitet: Lukrez lässt das Gleichnis auf die Metapher zuführen. Er bleibt sich aber ihres imaginären Charakters bewusst: quasi.
5. Gliedernde Rolle der Alliteration. Die poetische Form ist ein Mittel, den Leser so lange zu fesseln, bis er alles durchschaut, den Inhalt erfasst hat: dum perspicis omnem /naturam rerum, qua constet compta figura (949f.). Der Schlussvers ist durch das Kunstmittel der Alliteration ausgezeichnet (constet compta), die bei Lukrez wie bei Plautus, Ennius und lateinischen Tragikern eine große Rolle spielt. Auch im ersten Vers unseres Zwischenprooemiums trat c-Alliteration auf: cognosce et clarius audi.39