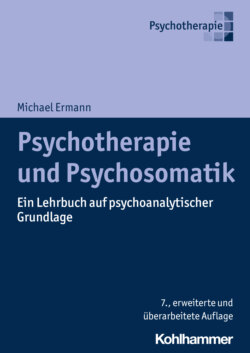Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 137
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.4 Auslösesituation und Krankheitsmanifestation Symptomentstehung bei der Entwicklungspathologie
ОглавлениеIm Zentrum der Auslösesituation steht bei den Symptombildungen auf der Basis der Entwicklungspathologie der Verlust supportiver Beziehungen und Strukturen. Wenn die stützenden Funktionen wegfallen, kann ein Zustand von Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung entstehen. Der Betroffene stürzt ab.
Häufig sind es aber nicht äußere, sondern innere Herausforderungen, welche eine Dekompensation einleiten. So werden strukturelle Defizite offensichtlich, wenn übliche entwicklungsspezifische Schwellensituationen und Entwicklungsaufgaben bewältigt werden müssen, z. B. im Zusammenhang mit Beziehungsaufnahmen, Ausbildung oder Berufswahl. Das erklärt die Häufung von Dekompensationen in der Adoleszenz und im frühen Erwachsenenalter.
Bisweilen kann man aber auch gar keine Auslösesituation ausmachen. Es besteht ein chronisches Missempfinden, eine Fremdheit gegenüber sich selbst, Plan- und Initiativlosigkeit verbunden mit Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen und auszuhalten und mit sich selbst »etwas anzufangen«. Diese Patienten sind aufgrund ihrer Ichschwäche und der unklaren Vorstellungen von sich selbst und anderen dem Leben und den Anforderungen des Alltags wie Prüfungen oder Partnerwahl nicht gewachsen.
In Symptomen wie Kontrollverlust, Depressionen, Panik und Ängsten und in körperlichen Störungen manifestieren sich Ichschwäche und Defizite von Ichfunktionen. Um den Symptomen und der dahinterstehenden Fragmentierungsangst zu begegnen und letztlich nicht den Kontakt zu sich selbst zu verlieren, greifen die Betroffenen auf Hilfsmittel wie Alkohol oder Drogen zurück, mit denen sie sich betäuben, um ihre Verlorenheit nicht zu empfinden. Ebenso können Verhaltensweisen entwickelt werden, mit denen sie versuchen, einem Selbstverlust entgegenzuwirken. Das geschieht z. B. durch selbstverletzendes Verhalten. Der Schmerz verstärkt das Körpergefühl und lässt die Haut als Grenze erleben. Das stärkt die Selbstkohäsion, d. h. das Empfinden von Abgegrenztheit.
Auf diese Weise entstehen komorbide neurotische Störungen ( Kap. 4.2.4 und Kap. 8.1.1), in denen sich Persönlichkeitsstörungen insbesondere mit Verhaltensstörungen verbinden.