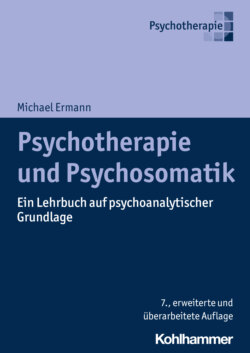Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 131
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Persönlichkeit bei der Traumapathologie
ОглавлениеNach Traumatisierungen ist die Persönlichkeitsentwicklung vor allem darauf ausgerichtet, Erinnerungen an die traumatischen Erfahrungen oder Retraumatisierungen zu vermeiden und damit die Traumaerfahrung unbewusst zu halten. Das Thema der posttraumatischen Persönlichkeit ist daher Vermeidung und Verleugnung. Daraus entstehen Persönlichkeitszüge wie Kontaktscheu, misstrauisches Verhalten, Ängstlichkeit und Irritierbarkeit sowie eine Verdrängung von Binnenwahrnehmungen. Ob es sich dabei um kompensatorische oder defensive Mechanismen handelt, ist oft schwer zu entscheiden, solange man nicht genauer in Erfahrung gebracht hat, ob die Traumaerfahrung als Defekt im Ich oder als verdrängtes, abgekapseltes Introjekt verarbeitet worden ist.
Das Leben mit der Traumaerfahrung verändert jedenfalls die Persönlichkeit und beeinträchtigt die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, die mit der Traumatisierung an sich gar nichts zu tun haben. Je nachdem, wann die posttraumatische Entwicklung einsetzt, verschränkt sie sich mit einer neurotischen Entwicklungs- oder Konfliktpathologie. Besonders bei früher Traumatisierung kann diese die posttraumatische Persönlichkeitsentwicklung auch ganz überdecken und ihr, je nach der vorherrschenden verdeckenden Pathologie, das Gepräge einer typischen Konflikt- oder Entwicklungspathologie geben. Von außen betrachtet handelt es sich dann um eine Persönlichkeitsorganisation, die von einer neurotischen nicht zu unterscheiden ist. Das bedeutet, dass die Spuren einer frühen Traumatisierung unter dem Mantel einer neurotischen Entwicklung verborgen bleiben, bis eine Traumaerinnerung die posttraumatische Störung freilegt. Das geschieht insbesondere bei Retraumatisierungen, in Entwicklungskrisen und im Rahmen regressionsfördernder Behandlungen.