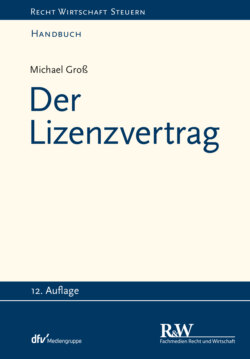Читать книгу Der Lizenzvertrag - Michael Groß - Страница 93
bb) Rechtsprechung
Оглавление309
In seinem Urteil vom 1.3.191149 stellte das Reichsgericht den Grundsatz auf, dass die Lizenzgebühr für die Zeit, in der die zugesagte Benutzung der Erfindung nicht gewährt wird, nicht geschuldet ist. Diese Regel könne aus der Natur des Vertrages entwickelt werden. Die Unterstellung unter eine gewisse Kategorie von Verträgen sei hierzu nicht erforderlich.
In dem Urteil vom 29.4.1931 wurde erwähnt, dass zu prüfen ist, ob der Lizenzgeber für die Brauchbarkeit einzustehen hat und ob ein Rücktritts- oder Leistungsverweigerungsrecht nach Treu und Glauben besteht.50 In der Entscheidung des Reichsgerichts vom 12.4.1913,51 in der es sich um die Überlassung eines Geheimverfahrens handelte, hat das Reichsgericht, nachdem festgestellt wurde, dass die zugesicherten Eigenschaften der Erfindung fehlten, zunächst die Vorschriften über den Rechtskauf herangezogen und ausgeführt, dass hiernach der Lizenzgeber für den Bestand des Rechtes haftet. Es fährt dann fort: „Will man die Analogie des Rechtskaufs nicht anerkennen, so drängt sich ein Vergleich mit den Vorschriften des BGB auf, wonach der Verkäufer einer Sache bis zum vollen Schadensersatz dafür haftet, dass sie die zugesicherten Eigenschaften hat.“52
310
Der Bundesgerichtshof hatte in mehreren Entscheidungen zu dem Umfang der Haftung des Lizenzgebers Stellung genommen und dabei vor allem die Anwendung der Vorschriften über die Mängelhaftung beim Kauf als nicht sachgerecht abgelehnt.53 Er hielt eine sachgerechte Wahrung der Interessen der Vertragspartner nur durch die Anwendung der allgemeinen Vorschriften über gegenseitige Verträge für möglich. Damit war nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu unterscheiden, ob die Störung des Lizenzvertrages aus der Zeit vor oder nach Abschluss des Vertrages stammte.
311
Nach der bereits zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs54 fanden die Regeln über anfängliches Unvermögen Anwendung, wenn die Brauchbarkeit zu dem vertraglich vorgesehenen Zweck von vornherein nicht gegeben und daher die Herbeiführung des vertraglich versprochenen Ergebnisses von Anfang an unmöglich war. Dies hatte zur Konsequenz, dass der Lizenzgeber zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung verpflichtet wurde, soweit sich nicht – so der Bundesgerichtshof etwas sibyllinisch – aus den Umständen des Falles eine andere Risikoverteilung ergab. Dabei ließ er offen, ob dieser Anspruch, wie vielfach vorgeschlagen wurde,55 der Höhe nach auf die Aufwendungen des Lizenznehmers zu begrenzen war.
312
Die Regeln der §§ 325, 326 BGB a.F. kamen nach der genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Tragen, wenn die Durchführung und damit die Erfüllung des Vertrages während seiner Laufzeit gefährdet oder vereitelt wurde. In diesem Fall konnte die betroffene Partei entweder vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wobei im Falle des Rücktritts der Schadensersatz wegen Nichterfüllung nicht mehr hätte gefordert werden können.56 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesgerichtshof die rechtmäßige Erklärung einer Partei, sie werde mit Rücksicht auf die aufgetretenen Störungen die Produktion einstellen, nicht als eine Rücktrittserklärung gewertet hat, die die Geltendmachung des Schadensersatzes hätte ausschließen können.57
313
Zu der Frage der Haftung aus dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung hatte der Bundesgerichtshof Stellung genommen.58 Danach stand aus dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung demjenigen, der einen Lizenzvertrag kündigte, ein Schadensersatzanspruch zu, wenn die Zusammenarbeit durch von einer Partei zu vertretende Umstände unzumutbar wurde und es zu einer gerechtfertigten Beendigungserklärung kam. Der sich hieraus ergebende Schadensersatzanspruch umfasste den durch die Kündigung entstandenen Schaden, schloss aber die Geltendmachung solcher Schäden nicht aus, die vorher aufgrund der die Kündigung veranlassenden schuldhaften Vertragsverletzung entstanden waren.
314
Was die Haftung für zugesicherte Eigenschaften betrifft, hatte der Bundesgerichtshof sowohl in seiner Entscheidung vom 11.6.197059 als auch in seiner Entscheidung vom 28.6.197960 darauf verwiesen, dass der Lizenzgeber in entsprechender Anwendung der §§ 463, 538, 581 BGB a.F. zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung verpflichtet ist, wenn die zugesicherten Eigenschaften fehlten. Dabei verwies er in der Entscheidung vom 11.6.1970 darauf, dass dieser Auffassung nicht entgegenstehe, dass ein solcher Anspruch beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften eines Werkes mit Rücksicht auf die abschließende gesetzliche Regelung der Gewährleistungsansprüche beim Werkvertrag verneint wird.61 Die Auffassung von Rasch,62 der mit Rücksicht auf das der Auswertung von Erfindungen innewohnende Unsicherheitsmoment im Regelfall einen Schadensersatzanspruch verneinte und den Lizenznehmer auf ein Kündigungsrecht verweisen wollte, wurde der Interessenlage nicht gerecht. Der Lizenznehmer musste sich wegen der erwähnten Risiken bei der Auswertung von Erfindungen auf die Zusicherungen des Lizenzgebers hinsichtlich der Eigenschaften der lizenzierten Erfindung verlassen können. Das rechtfertigte einen Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers wegen Nichterfüllung bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Dabei genügte es, wenn der Lizenznehmer seine Forderung mit den gemachten Aufwendungen begründete, wenn festzustellen war, dass er bei Einhaltung der vertraglichen Zusicherung Gewinn in Höhe dieser Aufwendungen erzielt hätte.63