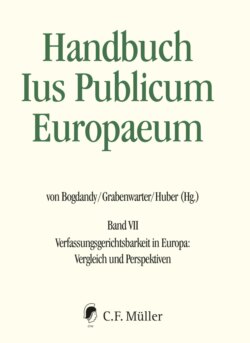Читать книгу Handbuch Ius Publicum Europaeum - Monica Claes - Страница 109
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. Schlussbemerkung
Оглавление135
Es mag paradox anmuten, dass das historische Erbe in den post-jugoslawischen Ländern besonders schwer zu wiegen scheint. Paradox, denn hier war der Sozialismus weniger totalitär als anderswo – oder ist es gerade deswegen schwieriger, die Vergangenheit sowohl zu bewältigen als auch zu überwinden? Die rechtliche Ausgestaltung der Verfassungsgerichtsbarkeit und die Rolle der Verfassungsgerichte zeigen ein gemischtes Bild, in dem der Wille, aus den traditionellen Bahnen auszubrechen, mit dem Anreiz, auf vergangene Schablonen und Rezepte zurückzugreifen, manchmal zusammentrifft und oft kontrastiert.
136
Auf dem Weg zur Annäherung an und der Zugehörigkeit zum europäischen Rechtsraum treffen die post-jugoslawischen Staaten noch immer auf zahlreiche Hindernisse. Zum ersten die inneren Zustände: Korruption der politischen Eliten, Populismus, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Euroskepsis. Kein Wunder, dass die Beitrittskandidatur nicht mehr dieselbe Dynamik wie 2004 entfaltet. Allerdings hatten die früheren Abkommen mit der EU in ihren Europa-Klauseln die Mitgliedschaft versprochen, während die heutigen Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen dies vorsichtig vermeiden. Vorsicht und Skepsis sind also beiderseits gewachsen. Dies gilt selbst für die beiden EU-Mitgliedstaaten Slowenien und Kroatien.
137
Abgesehen von diesem Stimmungswandel, der jedoch nicht zu unterschätzen ist, zeigen sich auch in den post-jugoslawischen Ländern die Nachteile der einheitlichen Methoden und des schnellen Rhythmus des Beitrittsprozesses deutlich. All diese Länder sind mehr oder weniger multiethnisch; die Verfassungen räumen entweder den nationalen Minderheiten besondere Rechte ein oder behandeln sie gar nicht als Minderheiten, sondern als konstitutive Elemente der Staatlichkeit. Der „Nationalstaat“ in ex-Jugoslawien entspricht also demjenigen westlicher Prägung nur sehr bedingt. Das wurde seitens der EU und in der juristischen Dogmatik und Theorie wenig erörtert.[239] Dies ist umso verständlicher als es den größeren post-jugoslawischen Ländern – Serbien, Kroatien und Slowenien – gelungen ist, sich als ethnisch relativ homogen darzustellen, während sich dies offensichtlich in den kleinen Staaten – Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo – als unmöglich erwiesen hat. So verwundert es auch kaum, dass die geplante „Vereinigung der Verfassungsgerichte des Balkans“ Slowenien, Serbien und Kroatien nicht einschließt. Es scheint gleichwohl ebenso offensichtlich, dass die Konsensdemokratie effizientes und demokratisches staatliches Handeln verhindert, sofern sie nicht durch wirksame checks and balances so eingegrenzt oder ausgeglichen wird, dass auch politische Meinungsbildung und individuelle Freiheitsrechte jenseits der ethnischen Zugehörigkeit einen angemessenen Platz finden können. Es bleibt also, ein Modell des zugleich multiethnischen als auch pluralistischen Staats zu entwickeln und sich zu fragen, ob und wie sich dies auf die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit auswirkt. Eine Überlegung dieser Art wäre auch als Bestandteil einer erneuten kritischen Bilanz der Wechselbeziehungen zwischen Verfassungsgerichtsbarkeit und dem EuGH willkommen.[240]
138
Ein drittes Hindernis, vielleicht zum Teil eine Resultante der vorhergehenden, ist der nur langsam fortschreitende Wandel der Rechtskultur. Selbst die Verfassungsgerichte, von denen man sich eine Vorreiterrolle hätte erhoffen können, erliegen teils den Erwartungen der politischen Elite, teils wollen sie ihre Unabhängigkeit durch Indifferenz gegenüber politischen, sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen ihrer Entscheidungen beweisen. Es ist auch wahr, dass es schwer für sie ist, in ihrer Umwelt eine sowohl kluge als auch erfolgreiche Rechtspolitik zu betreiben. Manchmal ist es ihnen dennoch gelungen, wichtige Weichen für die Zukunft der Demokratie und des Rechtsstaats zu stellen und oft war dafür das Ziel der Integration in den europäischen Rechtsraum ausschlaggebend. Die Frage stellt sich dann jedoch, ob es Europa gelingen wird, ein attraktives Ziel zu bleiben.