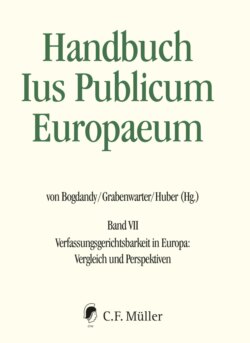Читать книгу Handbuch Ius Publicum Europaeum - Monica Claes - Страница 98
На сайте Литреса книга снята с продажи.
bb) Politisch brisante Fragen
Оглавление96
Zu den politisch brisantesten Fragen zählen die zahlreichen zu staatlichen Symbolen ergangenen Entscheidungen. In den meisten Fällen gründet sich die politische Brisanz auf den Minderheitenschutz, der im Kosovo, in Mazedonien und Bosnien-Herzegowina die größten Schwierigkeiten bereitete.
97
Für den Kosovo ist in dieser Hinsicht die Prizren-Entscheidung[155] besonders wichtig. In diesem Urteil hielt das Verfassungsgericht das Wappen der Stadt Prizren für verfassungswidrig, da es die Minderheiten, die im Kosovo als Gemeinschaften bezeichnet werden, nicht genügend berücksichtige. Während Multiethnizität den verschiedenen Gemeinschaften gegenüber staatliche Neutralität gebiete, seien in diesem Wappen nur albanische Symbole sichtbar. Das Gericht argumentierte sowohl mit den kollektiven Minderheitsrechten als auch mit dem individuellen Bürgerrecht auf Gleichheit. Es versuchte also, ein Gleichgewicht zwischen den ethnischen und den demokratischen Elementen herzustellen oder zu bewahren. Die Rolle als Gründer einer neuen Ordnung im Sinne eines nation building kommt hier zum Ausdruck.
98
Eine solche Rolle ist in Bosnien-Herzegowina weniger evident, obwohl sich das Verfassungsgericht mit ganz ähnlichen Streitigkeiten befassen musste. So wird in der grundlegenden Entscheidung[156] über die kollektive Gleichheit der konstitutiven Völker in beiden territorialen Entitäten, der Föderation von Bosnien-Herzegowina und der RS, der Akzent vor allem auf die kollektiven Rechte gelegt und die individuelle bürgerrechtliche Komponente kaum erwähnt. In diesem Sinne hat das Gericht vor allem darauf geachtet, dass die Regelungen über Städtenamen, Wappen, Hymnen, Symbole oder Feiertage entweder alle Völker berücksichtigen (ethnische Inkorporierung) oder kein Volk erwähnen (ethnische Neutralität).[157] Die grundsätzliche Gleichheit der konstitutiven Völker erweist sich somit zugleich als Gründerakt im Hinblick auf den Schutz von Minderheitsrechten und als Hindernis für einen besseren Schutz individueller und politischer Menschenrechte und damit für eine weitere demokratische Entfaltung. Denn kollektive Gleichheit in Form von ethnischen Quoten opfert individuelle Gleichheit, die allein zur Bildung von politischer Mehrheit führt.
99
In Mazedonien ist in erster Linie die Rechtsprechung zum Flaggengebrauch, insbesondere der türkischen und albanischen Flaggen vor dem Rathausgebäude in Gostivar, bedeutend. 1997 hatte das Verfassungsgericht Gostivars Gemeindesatzung mit dem Hinweis auf die mangelnde Zuständigkeit der Gemeinde, in ihrer Satzung den Flaggengebrauch zu regeln, aufgehoben. Darauf reagierte die albanische Bevölkerung mit starkem Protest und gewaltsamen Demonstrationen, gegen die die Polizei hart vorging.[158] Der dadurch ausgelöste inter-ethnische Konflikt wurde 2001 durch das Ohrid-Abkommen[159] beendet und die Verfassung dementsprechend geändert. 2005 kam ein neues Gesetz über den Flaggengebrauch zustande, welches dem Verfassungsgericht ebenfalls vorgelegt wurde. In seiner Entscheidung von 2007[160] hob es mehrere Bestimmungen auf und zwar sowohl diejenigen, die nach Ansicht des Gerichts die nationale Souveränität betrafen und damit die alleinige Präsenz der nationalen Flagge rechtfertigten, als auch diejenigen, die das Hissen von „Minderheits-Flaggen“ nur zuließen, wenn die betreffende Minderheit eine Mehrheit in der Bevölkerung darstellte. Dieser Spruch löste wiederum heftigen Widerspruch bei der albanischen Bevölkerung aus; auf Aufforderung der albanischen Parteien traten die beiden albanischen Verfassungsrichter von ihrem Amt zurück.[161] Im Schrifttum wird die Meinung vertreten, das Gericht habe in diesem Fall zur Staatsbildung beigetragen, weil seine Entscheidung die Debatte wiederbelebt und zur Verdeutlichung der verschiedenen Erwartungen geführt habe.[162] Dies scheint jedoch umso weniger überzeugend als das Gesetz in seiner Fassung von 2011 von neuem an die Zahl der jeweils ansässigen Minderheitsbevölkerung anknüpft[163] und den Flaggengebrauch für die Minderheiten etwas großzügiger gestaltet als dies in der Entscheidung von 2007 vorgesehen war. Man kann sich also fragen, ob nicht eher die politischen Akteure die Versöhnung eingeleitet haben. Jedenfalls zeigt dieser Fall, wie sensibel die Regelung der Symbole ist und wie behutsam die Verfassungsgerichte damit umgehen müssen, wenn sie nicht als politische Instanz betrachtet werden wollen.
100
Auch in Slowenien haben Symbole eine bedeutende Rolle gespielt. Hier sind es nicht Flaggen, Wappen oder Feiertage, sondern ein Straßenname, und zwar die Tito-Straße, der Probleme aufwarf. Der Stadtrat von Ljubljana hatte sich im Mai 2009 für diesen Namen nur zwei Monate nach der Entdeckung des aus der Nachkriegszeit stammenden Massengrabes von Huda Jama[164] entschieden. Die Familien und Nahestehenden der Opfer der damaligen Verbrechen fühlten sich durch den Beschluss tief in ihrer Würde verletzt, so dass einer von ihnen Beschwerde beim Verfassungsgericht einreichte. Das Gericht hob den Beschluss auf, weil Slowenien eine konstitutionelle, nicht nur eine formelle Demokratie sein solle und weil in einer konstitutionellen Demokratie die Menschenwürde unbedingt beachtet und gewahrt werden müsse.[165] Matej Avbelj[166] merkt dazu an, das Verfassungsgericht sei sich wohl bewusst gewesen, dass diese konstitutionelle Demokratie in Slowenien noch nicht verwirklicht sei, denn sonst hätte der Stadtrat von Ljubljana diesen Beschluss niemals gefasst.
101
Auch andere politisch brisante Themen wurden den Verfassungsgerichten vorgelegt. In den meisten dieser Fälle haben die Verfassungsgerichte eher konformistische oder konventionelle Urteile gefällt, also höchstens die Verfassung gehütet, aber wenig zur Demokratisierung beigetragen.