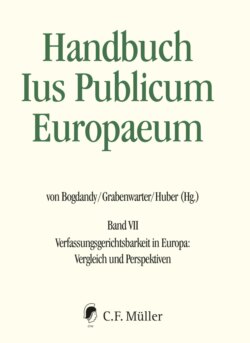Читать книгу Handbuch Ius Publicum Europaeum - Monica Claes - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
aa) „Hauptstadt Wien“: Der Verfassungsgerichtshof (1920–1933)
Оглавление85
Die erste Republik Österreich legt in der Zwischenkriegszeit das Hauptmodell eines europäischen Systems zur Normenkontrolle, wie es soeben dargestellt wurde,[149] vor. Der Verfassungsgerichtshof ist für die Hauptkategorien der Verfassungsgerichtsbarkeit, Normenkontrolle, Verfassungsstreitigkeiten und Schutz der Grundrechte, zuständig. Im Folgenden wird es hier in erster Linie um die Normenkontrolle gehen, ohne jedoch die anderen Kompetenzen des Verfassungsgerichtshofs ganz zu vergessen.[150]
86
Was die Normenkontrolle betrifft, so wird das Modell im Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, im Wesentlichen in seinem Artikel 140, festgelegt, wobei der Weg dorthin lang und komplex ist.[151] Die heutige Republik Österreich, als „Deutsch-Österreich“ (1918–1920) zunächst geboren, unternimmt im Januar 1919 die Schaffung eines „Verfassungsgerichtshofs“, dem ersten überhaupt mit diesem Namen, hauptsächlich mit vom ehemaligen Reichsgericht übernommenen Zuständigkeiten, insbesondere die Individualbeschwerde. Seit März desselben Jahres übt er darüber hinaus eine präventive Kontrolle über die Landesgesetze aus. Die Ausarbeitung des Kernelements des normativen Ensembles der österreichischen Verfassung, das Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, durchläuft einen komplexen Verhandlungsprozess zwischen Bundesregierung und Landesbehörden, bei dem die Frage nach der jeweiligen Stellung der Bundes- und Ländergesetze besondere Bedeutung erlangt. Das Endergebnis ist die Gleichstellung der beiden, was die Normenkontrolle betrifft.
87
In Anbetracht des Vorherigen ist es leicht verständlich, dass das Modell im Wesentlichen im Hinblick auf die Einhaltung der normativen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern konzipiert wurde. Die Grundrechte haben bezüglich der Kontrolle von Gesetzen keine allzu große Rolle gespielt. Nicht von ungefähr hatte man im Bereich der Grundrechte überhaupt nicht innovieren wollen und beschlossen, die im Grundgesetz von 1867 enthaltene Erklärung der Grundrechte als Teil des neuen Verfassungswerks in Kraft zu lassen. Was die Struktur des Verfassungsgerichtshofs anbelangt, so wird er von einem Präsidenten und einem Vizepräsidenten sowie aus 12 Richtern und sechs Stellvertretern zusammengesetzt.[152]
88
Funktionell geschieht die Normenkontrolle immer konzentriert und meistens abstrakt. Der Gerichtshof bezieht dabei auch die Kontrolle aller Gesetze mit ein, die im betroffenen Verfahren als entscheidungsrelevant erscheinen. Das Urteil ist allgemeinverbindlich, aber wieder mit einer gewichtigen Nuance: es wirkt immer pro futuro oder ex nunc. Das heißt, dass eventuelle Erklärungen der Verfassungswidrigkeit die Aufhebung und nicht die Nichtigkeit des Gesetzes mit sich bringen. Somit bleiben die bis zum Zeitpunkt der Entscheidung eingetretenen Wirkungen des verfassungswidrigen Gesetzes erhalten,[153] wobei sogar die Möglichkeit besteht, die Aufhebung des Gesetzes zunächst für sechs Monate und später bis zu zwölf Monate aufzuschieben.[154] Eine österreichische Besonderheit ist die schon beim alten Reichsgericht vorhandene konzentrierte Prüfung der Verordnungen, die letzten Endes so wie die Gesetze dem Verwerfungsmonopol des Verfassungsgerichtshofs unterliegen.[155]
89
Was die Entwicklung des Modells betrifft, so ist auf drei Daten hinzuweisen. 1925 wurde es einer ersten Reform unterzogen, indem deklaratorische Feststellungen seitens des Verfassungsgerichtshofs eingeführt wurden mit der Besonderheit, dass die Entscheidung den formalen Charakter eines Rechtssatzes genießt, so dass sie als authentische Auslegung der betroffenen Verfassungsvorschrift fungiert.[156] Eine zweite Reform im Jahr 1929 brachte einen überwiegend technischen und einen eindeutig politischen Aspekt mit sich. Zum einen wurde eine bescheidene Form der konkreten Normenkontrolle eingeführt, deren Impuls nur dem Obersten Gerichtshof und dem Verwaltungsgerichtshof zustand. Zum anderen wurden Wahlmodus und Status der Gerichtsmitglieder dahin gehend geändert, dass sie nicht mehr auf Lebenszeit ernannt und von der Exekutive bestellt wurden. Aus Protest gegen diese Neuerungen trat Hans Kelsen als Gerichtsmitglied zurück. Schließlich erfolgt 1933 im weitergehenden Kontext des Niedergangs der Demokratie und des Rechtsstaates in Österreich die „Ausschaltung“ des Gerichtshofs durch Einmischung der Exekutive im Wege von Notverordnungen, in deren Folge dem Gerichtshof seine Entscheidungsfähigkeit entzogen wurde.[157]