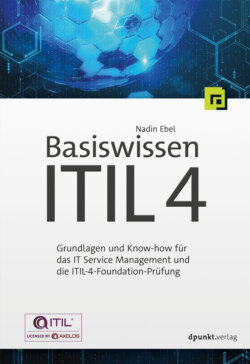Читать книгу Basiswissen ITIL 4 - Nadin Ebel - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Wandel hin zum ITIL-Service-Lebenszyklus
ОглавлениеDas Wesentliche an der damals neuen ITIL-Version war der explizite Wechsel von einer auf einzelne Prozessgruppen ausgerichteten Sichtweise zu einem durchgängigen und vollständigen Service-Lebenszyklus – angefangen von der Strategie über Design, Umsetzung und Betrieb der IT Services bis hin zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dieser Kreislauf wurde entsprechend über die Kernpublikationen abgebildet (siehe Abb. 2–3).
Abb. 2–3 Der ITIL-Service-Lebenszyklus (nach AXELOS-Material (ITIL®), Wiedergabe lizenziert von AXELOS)
Neben dem Service-Gedanken wurden auch inhaltliche Aktualisierungen realisiert. Hinzu kamen sinnvolle Prozessergänzungen wie das Service Portfolio Management oder ein umfassendes Wissensmanagement-System, ohne das ein kontinuierlicher Service-Verbesserungsprozess nicht möglich wäre.
Auch eine Reihe von neuen Funktionen, die man bisher vermisst hat (»Wer führt denn eigentlich das im Release Management beschriebene Rollout durch?«), wurden definiert. ITILV3 prägte also die Informationen zu Rollen und Funktionen weiter aus.
Das ITIL Refresh Project hatte aus der bestehenden Handlungsanleitung, die bereits breite Anerkennung und Etablierung erfahren hat, der aktuellen Weiterentwicklung der IT- und Geschäftswelt Rechnung getragen. Die neue Variante lieferte einen umfassenden Blick auf die Unterstützung der Geschäftsprozesse des Kunden und die Ausrichtung auf den Service-Lebenszyklusansatz. ITIL V3 ermöglichte der Organisation, den mit ITIL V2 eingeschlagenen Weg fortzuführen und das IT Service Management weg von der technischen Sicht weiter in Richtung Service-Orientierung und Mehrwertlieferung für den Kunden zu entwickeln. Dieser Grundgedanke wird in ITIL 4 fortgeführt.
Weitere Neuerungen spiegelten die damalige Entwicklung des ITSM wider:
Ging es in V2 um Wertschöpfung und die Koordination der IT, stellt V3 die Wertschöpfungsintegration und das Wertschöpfungsnetzwerk heraus.
War V2 eine Sammlung integrierter Service-Prozesse, liegt V3 ein ganzheitlich ausgerichteter Service-Lebenszyklus zugrunde.
V3 enthält Richtlinien zur Compliance mit Gesetzen und Regulatorien wie Sarbanes-Oxley (SOX) und Basel II sowie mit Standards wie ISO/IEC 20000, COBIT und Six Sigma.
V3 erörtert neue Themen wie zum Beispiel Service-Management-Strategien für Outsourcing, Co-Sourcing und Shared-Services-Modelle.
In der V3 sind auch Hinweise zu aktuellen technischen Themen zu finden, die Auswirkungen auf die IT-Organisation haben (z.B. Virtualisierung).
Bereits die Prozesse in Version 2 verlangten betriebswirtschaftliches Basiswissen. Vor allem im Bereich des Financial Management tauchten Beschreibungen in Bezug auf Budgetplanung, Kostenrechnung (Kostenstellen, -arten, -träger), Preisgestaltung, Leistungsverrechnung auf Basis der Kostenträger auf. Ansatzweise gehörte auch grundlegendes Controlling-Know-how ohne besonderen Bezug auf IT Service Management dazu.
ITIL V3 ging noch einen Schritt weiter und hat bspw. das Glossar deutlich im Hinblick auf betriebswirtschaftliche Fachausdrücke erweitert. Darüber hinaus beschäftigt sich das Buch »Service Strategy« intensiv mit unternehmensorientierten Fragen sowie Themen der Strategie- und Organisationsentwicklung.
Die ITIL-Bände wurden durch die Überarbeitung »gepimpt«. Es wirkte für einige Teile der Kernpublikationen ein bisschen so, als ob die Autoren in Bezug auf gefragte Themen und Schlagworte das Ohr auf die Schiene gelegt und für jede Interessengruppe ein »Schmankerl« mit dazugepackt hätten. Shared Services, Service Oriented Architecture (SOA), Web Services, Virtualisierung und anderen aktuellen Entwicklungen wurde Rechnung getragen. Auch diese Entwicklung hat sich in ITIL 4 fortgesetzt.