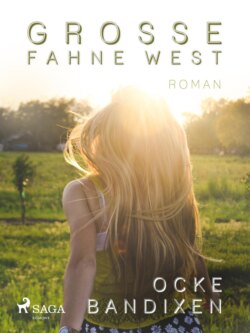Читать книгу Grosse Fahne West - Ocke Bandixen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеAm Rand, man konnte es nicht anders beschreiben: am Rand. Danach kam nichts mehr. Nur noch Felder, Koppeln, irgendwann die Deiche, dann auch noch die Nordsee, das Wasser, wenn es denn da war. Da war unser Haus.
Apfelhaus. Apfelhäuschen nannte die Familie das kleine weiße Haus mit den schwarzen Schindeln. Und das galt, wie immer, was die Familie sagte.
Die Familie: Tat alles, war alles, wusste alles, regelte alles: was man zu denken und zu meinen hatte, zu reden sowieso. Es ließ ein bisschen nach, jetzt, da so viele ein bisschen alt wurden. Das ganze Bevormunden und Hereinreden, fast fehlte es mir.
Für ein Reetdach hatte es nicht gereicht, pflegte Peer Leversen, mein Vater, zu sagen. Er hatte in das Haus eingeheiratet. Hier weht immer noch eine große Fahne West. Das sagte er oft und meinte den Wind wie den Stolz der Familie. Im Garten, der an der zur See gewandten Seite lag, flatterte so lange ich denken konnte und sicher noch länger eine Friesenfahne zwischen den Bäumen, die dem Apfelhäuschen seinen Namen gegeben hatten. Gold oben, dann rot und unten dann ein leuchtendes Mittelblau. Sie wurde über die Jahre kürzer durch den Wind und alle paar Jahre durch eine neue aus dem scheinbar unerschöpflichen Vorrat meiner Großmutter ersetzt.
Zwölf Bäume standen im Garten. Wie die Apostel, donnerte der Schifferpastor bei jedem Geburtstag, auf den er eingeladen war. Er hätte aus unserem Vater gern einen frommen Menschen gemacht. Zumindest einen so fröhlich-frommen wie dessen Frau Ellen, unsere Mutter, es gewesen war, solange sie lebte. Das mit der Kirche bleibt alles an dir hängen, Peter, hatte er nicht nur einmal zu mir gesagt. Und ich hatte mich bemüht.
Auch Frerk, mein älterer Bruder, hatte kein näheres Interesse am Glauben und Kirchenleben der norddeutschen Kleinstadt Feddering gezeigt. Für ihn war Sport das wichtigere Fluidum für sein Leben. Ich, nicht ganz ohne Neid in meinem Spott, hatte gelästert über den sauren Turnschuhduft der Sporthallen, den schwitzigen Muff der Umkleidekabinen, den dunkelgrünen Sumpf der Fußballplätze, in denen sich mein Bruder so oft bewegte.
Ja, ich war anders. Nicht so schlimm, aber spürbar anders. Der zweite Sohn. Der Augapfel meiner Mutter. Nicht offen fröhlich, aber heiter und optimistisch vom Naturell, würde ich sagen.
Mein Vater Peer, der als Tischler in Anstellung arbeitete, gab sich Mühe, mich zu verstehen, mir nahe zu sein, aber es fiel ihm schwer.
Seine Frau war gestorben, schnell und traurig war das gewesen. Sie hatte ihr Leben gelassen. War fort und konnte nie ersetzt werden.
Das Apfelhaus war danach klarer und weißer. Mehr als vorher. Das war, so schien es mir, das, was bleiben würde. Das Leben war ein paar Grad kälter. Sie fehlte mir unsagbar.
Das Haus erzog mich, zog mich auf, lehrte mich, wann es Zeit war im Jahr, das Küchenfenster zu schließen, im Herbst, wenn die Stürme uns und das Haus auf die Probe stellten. Mein Großvater grüßte noch weißbärtig und grimmig ins Gegenlicht blinzelnd von der Wand. Es war manchmal, als sei er noch nicht richtig fort und tot, so oft sprachen seine Töchter, meine Tanten, von ihm, soviel spürten wir, mein Vater, mein Bruder und ich von seiner Aufteilung der Räume, seinem angelegten Garten. Jeder Nagel war von ihm, jedes Werkzeug in dem Blechkoffer, jeder Holzspan dazwischen. Das Haus sagte mir, wann ich die Hecke schneiden musste, um im Frühjahr morgens schon Licht zu empfangen. Es gab mir zu verstehen, wann es Zeit zum Öffnen und Hinaustreten war und wann man besser drinnen war und die dunklen Gerippe der Bäume gegen das Licht bestaunte. Es lehrte mich Ordnung, Maß und Verantwortung. Mein Vater war da, aber das Haus machte mich groß.
Das Apfelhäuschen hatte einen kleinen Hof. Einem weißen Torbogen, der den Durchgang zum Obstgarten markierte, schloss sich dem Wohnhaus gegenüber ein zweites Häuschen an. Die Sommerküche. Ein Arbeitshaus, Werkstatthaus, Gartenmöbel-unterstell-Haus. Nur schlecht beheizbar, hell, verstaubt. Seit meine Mutter tot war noch mehr. Ab und zu fegte unser Vater das Häuschen zwar und wirbelte den Staub in kleinen Schwüngen auf, danach setzte er sich, der Staub, in Tagen und Wochen, in denen die Sommerküche nicht benötigt wurde, wieder wie eine Schutzschicht auf alles, was sich darin befand. Im hinteren Raum war die Abstellkammer, sie hatte einen zweiten Ausgang zum Garten, allerlei Hacken, Kratzer, Harken drängelten sich an der Wand. Eine Schubkarre wartete auf ein neues Rad oder zumindest einen Flicken im Reifen. Der Rasenmäher tropfte.
Im vorderen Raum war eine funktionstüchtige Küche eingerichtet. Marmelade war hier früher eingekocht worden. Mein Großvater hatte hier mit einem im Wasser heißgemachten Messer seine Bienenwaben aufgeschnitten und geschleudert. Die hölzerne Arbeitsfläche war abgeschrubbt und hell geworden. Ich hatte gute und süße und saure Erinnerungen an den Geruch der Sonnabendnachmittage, wenn meine Mutter mit mir die Gläser gefüllt hatte. Glückliche Tage mit dem Geruch halbvergorener Obstschalen. Ein kleiner Tisch und drei ausrangierte Stühle bevölkerten die Küche, einzelne Kinderbilder von Frerk und mir, Männchen und gekritzelte Kreise hingen gerahmt neben einem Poster für eine längst vergangene Kunstausstellung.
Im Keller, zu dem eine Bodenluke und eine Stiege führten, lagerten die Kompottschätze der Familie, die Fruchtsäfte und die Batterien von Marmeladengläsern. Unsere Tanten sorgten stets dafür, dass jeden Sommer welche dazu kamen. Ich rückte die Jahrgänge nach vorne, um die Reihenfolge in Ordnung zu halten. Die Gläser zu leeren, die Vorräte über den Winter zu verbrauchen, das versuchten wir nicht einmal. Um das reine Verzehren schien es auch nicht zu gehen bei den Vorräten. Sie waren wie ein Sparguthaben, eine Rücklage für schlechte oder zumindest schlechtere Zeiten. Und darüber hinaus ein sichtbares Zeichen der Zuwendung unserer Tanten. Liebe im Glas.
Auch ein Obergeschoss hatte die Sommerküche. Das alte Sofa von drüben stand hier und wurde gelegentlich benutzt. Zum einen, darüber sprach niemand, wie überhaupt über solcherlei Dinge wenig gesprochen wurde, schlief hier unser Vater seinen Rausch aus. Das kam ab und zu vor, ich und Frerk ebenso nahmen es wie gelegentliches Regenwetter hin, dass unser Vater trank. Die Sonne folgte ja meist auf den Regen, warum daraus ein Thema machen?
Nun war es so, dass Vater nicht etwa leere Flaschen, schmutzige Gläser oder zerdrückte Dosen dort oben stehen ließ. Er achtete peinlich genau darauf, morgens, wenn er aufwachte, und das war, auch wenn es viel Bier gewesen war, stets früh, das Leergut wegzuräumen.
Mein Bruder hatte eine Coolness, die nichts mit zurückgegelten Haaren und verspiegelten Sonnenbrillen zu tun hatte. Sie war nicht an einen modischen Kniff, etwa einen hochgestellten Kragen oder einen bestimmten Jackenschnitt gebunden. Sie hatte etwas Altmodisches, Ungerührtes. Etwas, das ihn schon immer älter gemacht hatte, zeitloser. Seine äußere Unerschütterlichkeit hatte etwas von Jean Gabin oder Lino Ventura, deren Filme wir zusammen so gern guckten, nachts, wenn unser Vater schon lange schlief. Etwas von Charles Bronson, der müde und angeekelt dem albernen Treiben zusieht und nicht dazugehören möchte. Etwas Wissendes lag in dieser unbeweglichen Miene, als habe er viel erfahren und erlebt, viel Erstaunen schon abgelegt und aufgebraucht in seinem weltbefahrenen Leben.
Er konnte, wenn man an seiner Seite war, dieses Gesicht wie einen Schutzschild aufsetzen gegen jeden Fremden, jede unerfreuliche oder unerwünschte Ansprache. Der Schutz reichte dann über ihn hinaus, oft hatte ich ebenso mein Gesicht zu Stein machen können, als ich seines neben mir sah. Um dann, wenn wir wieder allein waren und die Situation ausgestanden, in ein breites, kräftiges Grinsen und Lachen auszubrechen. Ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind lachend an seiner Hand gerannt war, wir mussten irgendwem schnell entkommen. Ich flog an seiner Hand und lachte wie er. Wir rannten so lange, weit, bis kurz vor unser Haus, bis unser Atem nur noch zum Lachen reichte.
Es ist ablandiger Mond, hatte mein Bienengroßvater gesagt. Oder: es ist auflandiges Licht am Morgen, ablaufender Wind, auflaufender Regen. Frerk und ich übernahmen das und sprachen vom auflaufenden Kaffee, vom ablandigen Brotbestand und so weiter. Mein Vater feixte, wenn er es hörte, manchmal mit uns und hob seinen Becher in Richtung des Bildes, von dem der Bienengroßvater so viele Jahre nach seinem Tod noch über uns und sein Haus wachte. Es war unsere Art, an ihn zu erinnern und uns an ihm abzuarbeiten.
Während ich mich um das Haus und die Küche kümmerte und unser Vater auf seine Art für uns sorgte, war die Unerschütterlichkeit im Blick Frerks Beitrag zu unserer merkwürdigen kleinen Familie.
Seit einiger Zeit war mir aufgefallen, dass auch Frerk so manchen Morgen über den Hof, also von drüben in die Küche kam. Grund dafür war seine erste feste Freundin, die Holly genannt wurde, worüber ich nachdenken musste: War das eine Abkürzung, und wenn ja, wofür?