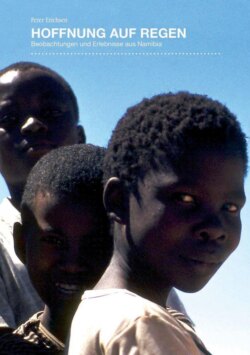Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ALSO AUF NACH KARIBIB!
ОглавлениеEin paarmal fährt einer von uns nach Otjiwarongo. Die breite Sandpad bis zur geteerten Hauptstraße Outjo-Otjiwarongo schneidet mehrere Farmen. Aber statt der Farmtore, die doch sehr aufhalten, führt die Pad über mehrere Rolltore, das sind im Boden liegende Eisenstangen, deren Zwischenräume so groß sind, dass die Rinder keinen Halt auf ihnen finden.
Diese Farmpads, von denen wir im Laufe der Zeit doch sehr viele kennen lernten, werden regelmäßig von einem Padscrapper geglättet und befinden sich deshalb in Namibia in relativ gutem Zustand. Weltenbummlern, denen wir begegneten und die den afrikanischen Kontinent durchfahren hatten, bestätigten das immer wieder.
Otjiwarongo ist wie alle Ortschaften in Namibia eine Insel, die aus dem Busch hervorwächst und wieder in Busch übergeht, eine allmähliche Verdichtung aus Grün und Rot und Weiß ohne feste Grenzen, die besonders in der grautrockenen Winterzeit wie eine Oase wirkt. Die leichtgebauten Häuser haben in der Regel nur ein Erdgeschoß. Als Zentrum des Ortes muss wohl die ein paar hundert Meter lange Geschäftsstraße gelten: Geschäftshäuser mit flachen Dächern und Scheingiebeln, überdachten Bürgersteigen und Cola-Reklame. Sie erinnert an Ortschaften, die irgendwo an den Highways des endlosen amerikanischen Mittelwestens liegen.
Hier besorgen wir uns die notwendigen Südwester Schlapphüte. Ich sitze mit meinem fünfjährigen Sohn Finn an der Hauswand von Kaufhaus Brumme – wir trinken einen Milchmix und beobachten das Treiben auf der Straße. Oder wir kehren in einer Seitenstraße ein beim Bäcker Otto Carstensen aus Husum, der seit 1955 hier lebt. Oder wir genießen einen „Cool-drink“ auf der Terrasse vom Hamburger Hof. „Otjinassis“ ist auch da, ein weißer Diamantenschieber. Seit die großen Minengesellschaften den Diamantenhandel kontrollieren, ist es eine gefährliche Sache, Rohdiamanten bei sich zu tragen. Aber es lockt wohl gerade deshalb auch immer wieder Abenteurer an.
Eines Tages sind wir zum Telefonieren hier, denn wir müssen uns nun allmählich um unser Gepäck kümmern, und der Fernsprecher auf der Farm ist uns nicht ganz geheuer. Er ist nämlich einer Farmlinie angeschlossen, d. h. mehrere Nachbarn haben die gleiche Nummer. An dem Klingelzeichen erkennen sie, wem ein Anruf gilt, und wenn der Teilnehmer nicht gleich den Hörer abnimmt, dann klingelt es eben auch bei den anderen so lange, bis die Zentrale ein Einsehen hat ... Das Holztelefon an der Wand hat eine Kurbel, die wir etwa 10 mal drehen müssen. Erst dann wird der Hörer abgehoben und der Vermittlung die gewünschte Nummer durchgegeben. Wenn man Glück hat, kommt man durch, sagt uns Ulla, die Farmersfrau. Und: „Montags wollen alle telefonieren!“
Also benutzen wir erstmalig einen öffentlichen Fernsprecher in Otjiwarongo. Aber auch hier ist manches anders: Erst wenn sich der Angerufene meldet, dürfen die Cent-Stücke durchfallen. Das aber können wir den fremdsprachigen Aufschriften nicht sofort entnehmen. Das Ganze ist für uns sehr mühsam, und mit der Verbindung klappt es nicht. Wir beschließen, direkt bei Kühne & Nagel in Windhoek vorbeizufahren, um die Koffer des unbegleiteten Fluggepäcks zu holen und die Ankunft des Containers zu regeln, der unser Umzugsgut enthält. Dazu muss ich zunächst nach Karibib, meinem künftigen Dienst- und Wohnort, denn dort steht ein Landrover für uns bereit, den ich von meinem Vorgänger an der Privatschule Karibib für DM 7200,- gekauft habe.
Karibib! Dieser Name, der uns seit einem halben Jahr bewegt! Der aber, wie uns erst nach und nach bewusst wurde, leider nicht auf der zweiten Silbe betont wird und auch nicht mit „k“ endet! Dass auch andere bei diesem Namen falsch schalten, bewies uns gelegentlich die Post, wenn sie uns trotz fehlerhafter Anschrift erreichte, zum Beispiel: Imme und Peter Erichsen, Etoscha-Pfanne südl. Karibik, Namibia.
Aber diese kleine Gefühlsverwirrung haben wir längst verwunden. Für mich ist der Auslandsschuldienst eine Chance, den Horizont zu erweitern – beruflich, aber auch im allgemeinbildenden Sinne und vor allem menschlich. Es ist eine Bewährung, die zur Selbstfindung beiträgt und uns zeigt, wie wir mit andersartigen Belastungen fertig werden. Und wahrscheinlich hat das alles Rückwirkungen. Was taten die Handwerksburschen anderes, wenn sie auf Wanderschaft gingen? Die Erkenntnis hat zwei Wurzeln: die Begegnung und der Abstand. Mein bisheriger Abstand kann mir bei der Begegnung mit Namibia helfen. Und wenn ich heimkehre, habe ich vielleicht einen Abstand zur Bundesrepublik Deutschland gewonnen, der mein Denken verändert...
Mein offizieller Auftrag, dem deutschsprachigen Bevölkerungsteil bei der Bewahrung deutscher Sprache und deutscher Kultur zu helfen und ihr ein realistisches Bild der heutigen Bundesrepublik Deutschland zu vermitteln, bleibt davon unberührt, steht aber, wie ich bekennen muss, nicht im Vordergrund meiner Motive, Hoffnungen, Gefühle. Meiner Frau geht es ähnlich.
Überhaupt ist Südwestafrika/Namibia ein Zufallsprodukt meiner Bewerbung. Für Bombay, Hermansburg (Südafrika) und São Paulo stand ich ebenfalls in engerer Wahl.
Ausgerechnet Namibia! Nicht wenige unserer Freunde und Bekannten denken da sehr kritisch. Sie haben uns gefragt, wie wir es vor unserem Gewissen verantworten könnten, Menschen zu unterstützen, die ihrerseits das menschenverachtende Apartheidssystem tragen. Was sollten wir antworten! Wir sind voreingenommen, denn wir wollen raus. Und wir hoffen, dass wir uns nicht völlig verleugnen müssen, dass wir doch etwas bewirken können, dass die Begegnung mit dem fremden Land Einsichten bringt, die beiden Seiten helfen. Vielleicht sind wir ein kleines Steinchen in dem Mosaik der Politik, die Probleme nicht nur durch Abstand, sondern auch durch Begegnung lösen will.
Also auf nach Karibib!
Mit Ulla und Jan im Mercedes. Jan muss ohnehin nach dem 2000 Kilometer entfernten Kapstadt, um dort so eine Art Handelsschule zu besuchen, und da liegt Karibib ja fast am Weg! Wir wählen die Teerpad über Otjiwarongo, und dann geht es 200 Kilometer immer geradeaus nach Süden. Das Hochland ist wellig, so dass wir die Straße nicht immer so weit überblicken können, wie das aus manchen Teilen Australiens und den USA erzählt wird. Aber 10 Minuten kann es schon dauern, bis eines der spärlich fahrenden Autos, das wir am Horizont als Pünktchen sichten, uns wirklich begegnet.
Der endlose Busch hinter dem endlosen Zaun macht keinen sehr frischen Eindruck. Zwar zeigt er ab und zu gelbe Blüten, aber sein Grün, sofern überhaupt vorhanden, wirkt doch sehr matt und dünn. Wenig trockene Weide steht dazwischen, steiniger, staubiger Boden überall. Manchmal blühen Kräuter und sprießt wirklich grünes Gras am Rande der Straße, in einem begünstigten Sandstreifen, der das von der Fahrbahn ablaufende Wasser aufsaugen durfte. Aber das ist selten.
Anders sind die sandigen Trockenflüsse, die Riviere, die wir häufiger auf Brücken überqueren. Sie ziehen sich als grüne Bänder durch die dürstende Welt, ihre großen Bäume ziehen ihren Vorteil aus dem immer noch erreichbaren Grundwasserspiegel.
Manchmal durchbricht hellbrauner Granit die Eintönigkeit, und geradezu aufregend wird es, wenn sich dieses Gestein zu Trümmerbergen auftürmt, als habe ein Riese den Steinhaufen vom Spielen übrig gelassen. Dazwischen wächst es meist üppiger als in der Fläche – wahrscheinlich sind es auch begünstigte Orte, wo der wenige Regen in wenigen Felsspalten zusammenläuft und sich dort auch länger hält als anderswo.
Dass hier Menschen leben, bleibt wohl nur durch die Gegenwart von Straße und Zaun bewusst – und durch das Bahngleis, das stellenweise uns begleitet, die Verbindung zwischen der Küste und den Minen bei Tsumeb und Otavi, die alte Otavi-Bahn, fertiggestellt 1908. Ansonsten fahren wir durch Wildnis. Ganze zwei Ortschaften liegen an den 200 Straßenkilometern. Die eine ist Kalkfeld: Wenige, weit verstreut liegende Häuser, kaum zu erkennen, dass man überhaupt durch eine Ortschaft fährt. Neben zerfallenden Häusern und einer stillgelegten Tankstelle gibt es an der Ortsdurchfahrt zwei funktionierende Benzinzapfsäulen und einen Supermarkt.
Da zeigt Omaruru schon mehr her. Die Bebauung und erkennbares Leben konzentrieren sich an der vierspurigen Ortsdurchfahrt mit dem blühenden, Rasen bewachsenen Mittelstreifen. Wasser gibt es hier genug, das breite Omaruru-Rivier durchschneidet den Ort und lässt in den Gärten mächtige Palmen und Eukalyptusbäume wachsen. Überall blühen Bougainvillea und Rabatten aus Tagetes und bunten Korbblütlern, die wild im Namaqualand südlich des Oranje wachsen.
Unter den Häusern auch einige alte Exemplare – das deutsche Wort „Kindergarten“ ist auf einer verwahrlosten Fassade gerade noch zu entziffern.
Doch die schönen Anlagen täuschen. Die Vitalität ist schon seit langem stark angeschlagen, einige leer stehende, verfallende Häuser sind zu sehen, seit es hier keine arbeitenden Minen mehr gibt. Eine Futtermittelfabrik ist heute der größte gewerbliche Arbeitgeber. Die deutschsprachige Grundschule geht ihrem Ende entgegen.
Wilde Geschichten werden von dem deutschstämmigen Bäcker erzählt, der im festlichen Rahmen mit seinem Revolver einen Kronleuchter zur Strecke brachte und es sich nicht nehmen lässt, Hitlers Geburtstag zu feiern. Wahr ist, dass er einmal im Jahr auf Bestellung Hakenkreuzbrötchen backt. Er gehört wohl zur rührigen Minderheit der HNP, einer politischen Gruppierung am rechten Rand des politischen Spektrums, ein Hort des unverblümten Rassismus und nationalsozialistischer Traditionen, geistig verwandt mit der südafrikanischen Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) unter ihrem Führer Eugen Terreblanche sowie mit den südafrikanischen Parteien KP und HNP.
In Omaruru ließe es sich gut leben, aber der Schlüssel zu seiner Zukunft liegt wohl nicht hier. Überlegungen zur Wiederbelebung gibt es schon, der Ort liegt in zentraler und reizvoller Lage. Vielleicht ein Touristencamp als Ausgangspunkt für Safaris, Expeditionen? Vielleicht ein Thermalbad? Aber die heißen Quellen sind angeblich nicht ergiebig genug. Aufschwung durch Gold-Fieber? Entsprechende Meldungen sind wohl eher dem Wunschdenken entsprungen – zwar gibt es in der Nähe goldhaltiges Gestein, aber bei zwei bis drei Gramm Metall je Tonne springt nach bisherigen Kalkulationen nicht genug dabei heraus5.
Wir überqueren das breite Omaruru-Rivier in Richtung Süden. Es ist von zahlreichen Reifenspuren durchfurcht. Hier kann lange kein Wasser geflossen sein. Links hat in der Kolonialzeit irgendwo die deutsche Militärstation gestanden, rechts beginnt es gebirgig zu werden. Es sind die nördlichen Vorboten des Erongo-Gebirges, rötliche nackte Granitrücken und -kuppen, auch mal ein vulkanisch aussehender Kegelberg dazwischen. Wir sind noch 60 Kilometer von Karibib entfernt, die Spannung steigt.
Ich hätte jetzt gern im Ausguck gesessen, ganz allein mit meinen Gedanken und Gefühlen, bis in die Zehenspitzen erwartungsvoll gespannt, alles aufsaugend, um die Wirkung in mir zu spüren ... aber meine Begleiter haben viel zu erzählen, und so fühle ich mich eher auf Geschäftsreise.
Der Erongo scheint von Norden her allmählich anzusteigen, im Süden jedoch fällt er jäh ab, alpine Felswände aus dem rötlichen Granit, den wir vorhin schon sahen. Wir fahren östlich in großer Entfernung um ihn herum, an dem Krüger-Kopf vorbei, einem Berggrat-Profil, das angeblich Ähnlichkeit mit Ohm Krügers Charakternase hat6.
Je mehr wir uns unserem Ziel nähern, desto trostloser wird die Vegetation. Trockenes, vorjähriges Gras ist schon eine Seltenheit. Soweit das Auge blickt: Hitzeflimmernde Luft liegt blendend über grauem Busch. Sollte doch noch wahr werden, was ich mir zu Hause in Deutschland vorgestellt hatte?
Karibib – heiße Sandschneisen zwischen Häusern, und der ewige Wind rüttelt an den einsamen Dächern und treibt raschelnde, kratzende Strauchkugeln dem Staub hinterher...?
Zehn Kilometer vor Karibib steht rechts an der Teerpad ein unscheinbares Schild, das auf einen Flugplatz hinweist. Wir sehen auch einen wehenden Luftsack, sonst nichts.
Vor uns im Süden liegt Bergland mit abgerundeten Formen, „Mittelgebirge“ würden wir in Deutschland dazu sagen, besprenkelt mit brüchig-dunklen Tupfen – so wirkt der Busch aus großer Entfernung. Dahinter, weit am Horizont, noch einmal 60 Kilometer weiter, würden wir auf das Swakop-Rivier stoßen, das wildbewegte Khomas-Hochland...
Wir aber sind jetzt angekommen, obwohl man von Karibib noch nicht mehr sieht als das Wasserreservoir auf einem kleinen Berg. Wir stoßen auf eine Teerpad und eine Bahnlinie, die alte Verbindung zwischen der Küste und der Hauptstadt Windhoek. Wir sind 180 Kilometer von Swakopmund entfernt.
Und dann doch die ersten Häuser. Sie liegen links am Hang des Heliografenberges, auf dem der Wasserspeicher steht, und unten an der Straße ein hinter grünen Sträuchern fast verborgenes Hotel, die Waltz-„Garage“ (Tankstelle und Werkstatt) mit dem Markenzeichen „Mobil“ und dann eine kurze Ortsdurchfahrt mit flachen, auf den ersten Blick unscheinbaren Häusern links und rechts. Hinter der rechten Häuserreihe führt die Bahnlinie entlang nach Westen, und dann folgt bis zum 30 Kilometer entfernten Erongo eine Ebene mit zahlreichen Hügelketten. Nach links gibt es drei staubige Parallelstraßen in dem leicht zum Heliografenberg ansteigenden Gelände. Dort liegen verstreut die meisten Häuser, oft mit Wellblech gedeckt, einige rote Dächer sind auch darunter, und das Überraschende ist das viele Grün auf den bebauten Grundstücken, was mir endgültig die Sicherheit gibt, hier nicht in einer wüsten Westernbudenstadt gelandet zu sein.
Ich besorge mir zunächst den Landrover. Ich stehe vor diesem Ungetüm, das mir wie ein halber Lastwagen vorkommt, mit seinem altertümlichen Aufbau, dem riesigen Ersatzreifen auf der Kühlerhaube. Das Dach ist weiß und hat eine Gepäckreling, die Karosserie ist lindgrün. Dafür, dass dieses Gefährt schon elf Jahre alt ist, sieht es ganz gut aus. Vor allem ist kaum Rost zu sehen. Ich stelle mir vor, was in Schleswig-Holstein nach elf Jahren übrig bliebe...
Dann interessiert mich brennend, in welchem Haus wir in den nächsten Jahren leben sollen. Wie viel hängt davon ab! Wir kennen nur den Grundriss, haben gehört, dass ein Schattenbaum auf dem Grundstück stehen soll. Wir suchen den Besitzer auf. Er ist gleichzeitig Eigentümer des Marmorwerks, das auf der rechten Seite des anderen Ortsausgangs liegt. Und während Ulla bereits auf dem Weg nach Windhoek ist, fahren wir dem weißen BMW unseres Vermieters nach: erste Querstraße, zweite Querstraße. Es geht in Richtung Wasserreservoir den Berg hoch. Nach der dritten Querstraße ist das rechte Eckgrundstück unbebaut. Stapel von Zementsteinen stehen dort, als sei dem Besitzer bei seiner Bauplanung die Luft ausgegangen. Dahinter hohe, grüne, dornenlose Pfefferbäume über zwei roten Ziegeldächern. Das ist es! Dahin waren meine Augen schon vorhin gewandert, aber ich rechne von Natur aus nie mit dem Besten, und so hatte ich diese Möglichkeit als erfahrener Zweckpessimist verworfen, um mich – vielleicht – doppelt freuen zu können, wenn ich mich selbst widerlegte.
Das Haus – oder besser – die beiden Häuser sind in Karibib erste Wahl. Sie sind solide gebaut und stehen auf einem großzügigen Grundstück mit vielen Bäumen und einer herrlichen Sicht auf den Erongo.
Was brauchen wir mehr! Ich messe das Vorgefundene an meinen Erwartungen und bin erleichtert. Innen wird noch gearbeitet: Schwarze machen die Wände weiß.
Das Wichtigste ist somit erledigt. Jan und ich verspüren Lust auf eine kleine Stärkung, bevor wir nach Windhoek starten. Unten an der Ortsdurchfahrt haben wir einen Bäcker gesehen, in einem Haus mit alter Fassade aus deutscher Zeit und einer dicken Dattelpalme davor. Es ist ein ehemaliges Hotel aus den Gründungstagen Karibibs, also rund 80 Jahre alt. Der lange Gebäudeflügel, der die Seitenstraße hinaufreicht, ist der ehemalige Schießstand. Wir betreten die schattige Veranda und öffnen die mit Fliegendraht bespannte Holztür zum Laden. Sie schwingt auf, und wir stehen in einem hohen Raum mit stuckverzierter Decke. Hinter dem Ladentisch die Brotregale, rechts vor dem Tresen ohne weitere Abtrennung einige Tische und Stühle: Der Laden ist gleichzeitig ein nach unseren bisherigen Maßstäben nicht besonders einladendes Café.
Ein schmächtiger Schwarzer mit Schlips und weißer Bäckerjacke sieht uns freundlich fragend an. Die Verständigung ist kein Problem, er spricht gut Deutsch. Er geht, um uns die beiden belegten Brötchen zu holen, die wir bestellt haben. Wir sind allein und schauen uns um. Da öffnet sich links eine weiß lackierte Tür mit der Aufschrift „Privat“, heraus tritt ein fülliges, gelangweiltes Gesicht mit dunklen, glatt zurückgekämmten, zu einem Knoten gebundenen Haaren, eine kleine Frau in schwer zu schätzendem Alter, mit schwarzen Augen hinter dicken Brillengläsern. Sie schlendert hinter dem Ladentisch entlang und entgleitet unseren Blicken dort, wo auch der Schwarze verschwunden ist.
Wir wundern uns noch über den stummen Auftritt, da springt plötzlich die eiserne Ladenkasse mit einem lauten Klingeln auf, weil Jan sich auf dem Tresen etwas weit vorgebeugt und beim Aufstützen einen Hebel berührt hat. Wir lachen über unseren Schreck, und augenblicklich steht die Frau vor uns. Diesmal sieht sie böse aus. „Was soll denn das?“, will sie wissen, sie vermutet wohl Absicht. Ich lache sie an, erkläre die Harmlosigkeit des Vorfalls. Da öffnet sich zum zweiten Mal die weiß lackierte Tür und heraus tritt – wieder ein Grund zu erschrecken – ein riesenhaft wirkender, massiger Mann mit Dreiviertelglatze und bärbeißiger Miene. Er stapft den gleichen, schon beschriebenen Weg und verschwindet ohne Ton.
Was haben wir nur getan! Der Kunde fühlt sich irgendwie für irgendwas schuldig. Vielleicht sind wir nur lästig? In einem einsamen grauen Fischerdorf an der rauen irischen See hätte mich ja eine derartige Begegnung nicht weiter verwundert – obwohl ich noch nie in einem einsamen grauen Fischerdorf an der rauen irischen See war. Aber hier? Unter der ewigen Sonne?
Auch so ein Vorurteil, mit dem wir fertig werden müssen: Ewige Sonne garantiert keine heitere, mediterrane Lebenskunst, und wo die Menschen lachen, muss nicht die Sonne scheinen. Das kann ja heiter werden, denke ich.