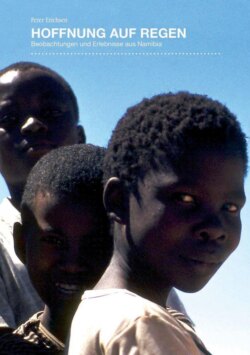Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
GEFAHREN
ОглавлениеZwei Tage später besucht uns ein Nachbar. Er trägt die Army-Uniform und gehört zum „Kommando“, einer militärisch organisierten Reservistenarmee, in der fast alle Weißen dieses Landes zusammengeschlossen sind. Sie treffen sich von Zeit zu Zeit, machen Schießübungen, Verkehrskontrollen und proben in Zusammenarbeit mit dem Militär den Ernstfall – der hier nur bedeuten kann: Die Abwehr von „Terroristen“, wie die SWAPO-Kämpfer ganz selbstverständlich genannt werden. Besonders in der Regenzeit – weil es dann leichter ist, im Busch zu überleben – dringen die „Terroristen“ von Angola her ein, versuchen die schwarze Bevölkerung (Ovambos, Kavangos, Caprivianer) zu verunsichern und betrachten es als besonderen Erfolg, ins weiße Farmgebiet eingedrungen zu sein. Es gehört zu den Schreckensvisionen der Farmer, sich vorzustellen, von SWAPOs überfallen zu werden.
Der Nachbar vom Kommando hat einen offiziellen Auftrag. Er soll den Schwarzen auf der Locasi Uniformstücke und Waffen der SWAPO-Kämpfer zeigen. Aufmerksame Schwarze haben schon oft entscheidende Beobachtungen gemacht.
Aber Hinrich muss auch selbst etwas für seine Sicherheit tun. Regelmäßig meldet er sich über Funk bei seinen Nachbarn. Die Army ist noch nicht ganz zufrieden mit dem Schussfeld. Es gibt zu viele Deckungsmöglichkeiten rund um das Haus. Feigensträucher im Garten verdecken die Sicht. Aber die Feigenblätter verdecken unserer Meinung nach noch mehr: Wenn wir uns den Ernstfall vorstellen, dann kommt uns das Farmhaus mit seinem leichten Dach wie eine Mausefalle vor: Wie leicht könnte man unbemerkt die Anhöhe mit dem Wasserreservoir besetzen! Wie leicht wäre der Diesel-Generator außerhalb der Umzäunung zu zerstören, die einzige Stromversorgung auf dieser Farm!
Es ist Abend geworden. Wir waren noch bei den Krälen am „Damm“, dort, wo das Regenwasser zusammenläuft und künstlich gestaut wird, um die Wasserversorgung abzusichern. Die Sonne war sehr schnell versunken, und über uns stand bereits dunkle Nacht. Aber hinter den schwarz liegenden Bergen glühte noch alles in leuchtendem Rot, und vor diesem Licht ragte scharfkantig schwarz das ruhende Windrad auf seinem Gerüst. Motive für ein Bilderbuch...
Irgendjemand im Haus brauchte Strom, betätigte einen Schalter, und langsam kam der Generator auf Touren, erfüllt von nun an für Stunden die Nacht mit seinem satten, dumpfen Takt.
Wir sitzen beim Abendbrot, als Frerk, der älteste Sohn, nach Hause kommt. Er spricht nicht viel, auch heute ist er sehr wortkarg. Er setzt sich, aber hat keinen Hunger. Eher beiläufig sagt er den Satz: „Ich hab ein Beest totgefahren“. Es dauert eine Weile, bis wir ihm Einzelheiten entlockt haben. Draußen, auf der Farmpad ist es passiert. Plötzlich hatte er ein „Beest“ (Rind) im Scheinwerferlicht seines VW. Er habe nicht mehr ausweichen können. Vielleicht sei er auch zu schnell gefahren, er wisse es nicht. Das Auto jedenfalls sei Schrott. Erregung ist ihm nicht anzumerken, aber am Haaransatz wächst eine Beule.
Das Abendbrot ist gelaufen. Wir brechen sofort auf, fahren im Dunkeln zur Locasi und sammeln ein paar Leute auf. Dann holpern wir über ausgespülte Querrinnen bis zur Farmpad und fahren ein ganzes Stück auf ihr entlang bis zur Unfallstelle. Sie gehört noch zu Hinrichs Farm, es ist auch Hinrichs Kuh, die da mit aufgerissenem Schädel in ihrem Blut liegt. Wir stellen unsere Wagen so, dass wir die ganze Szene mit den Scheinwerfern gut ausleuchten. An dem VW ist wirklich fast nichts mehr heil, alles eingedrückt, gesplittert. „Du hättest tot sein können“, meint Frerks Vater, der erst jetzt einen Schicksalshauch zu spüren scheint.
Währenddessen machen sich die Schwarzen an die Arbeit. Ihnen soll das ganze Tier gehören, nach dem Jagdglück von vorgestern zu viel des Guten, vor allem, wenn man keine Tiefkühltruhe hat. Aber nicht nur von den Buschmännern erzählt man sich von den ungeheuren Fähigkeiten, gewaltige Fleischmengen in kurzer Zeit zu vertilgen. Sie brechen das Rind auf, was nicht brauchbar ist, bleibt liegen. Die Schakale erledigen den Rest.
Zu Hause wird trotz der späten Stunde noch der Versicherungsagent angerufen. Und Frerk legt sich ins Bett – mit dem Ende des Schocks spürt er seine Blessuren...
Zehn inhaltsreiche Tage sind vergangen, unsere ersten Tage in Namibia. Ganz leise haben wir dieses Land betreten, keine Abordnung des Schulvereins hat uns empfangen, kein Betreuungslehrer hat uns zur Seite gestanden. Des Nachts haben wir uns hineingeschlichen und sind geradewegs auf eine Farm gefahren.
Diese Art der ersten Begegnung ist ein Glücksfall, und wir verdanken es Hinrich und Ulla, mit denen meine Frau verwandt ist. Wir sind vollgetankt mit Eindrücken und Informationen, dass uns ganz leicht ums Herz ist. Manche Beklemmung kommt gar nicht erst auf, die sonst normal wäre bei einer so einschneidenden Veränderung der Lebensumstände.
Ich denke an die vielen Farmerskinder, die ich unterrichten soll. Wie ich mich freue, dass ich jetzt schon etwas weiß über deren Alltag, über deren Probleme!
Auch unser Alltag soll demnächst beginnen, und vor meinem Dienstantritt ist noch ein Haus für eine fünfköpfige Familie einzurichten, ist noch ein Nest zu bauen, das uns möglichst für drei Jahre Geborgenheit geben soll. Und so ergreift uns neugierige Unruhe.
Der Landrover steht gepackt auf dem Hof. Eine beachtliche Portion Wildfleisch hat Ulla uns zugesteckt, worüber wir uns sehr freuen. Den Innenraum des Wagens hinter dem Vordersitz hat meine Frau mit Matratzen und weichen Gepäckstücken ausgepolstert, damit sich die Kinder nicht stoßen, wenn sie dort während der Fahrt spielen. Alles ist gerüstet. Die Sonne brennt schon wieder.
Aus dem Farmhaus dröhnt der Lautsprecher des Transistor-Radios. Das kennen wir schon: Hinrich sitzt im Flur und hört Nachrichten in Afrikaans, dieser eigenartigen Sprache, die in Afrika so fremd wirkt, diesen Singsang aus hart rollenden Rs und eher weich verbindenden Zwielauten und schleifenden Chs. Einzelne Wörter haben eine starke Ähnlichkeit mit dem Niederdeutschen, aber Sprachmelodie und Betonung machen mir ein Verstehen unmöglich.
Plötzlich bricht der Ton ab und die nimmermüden Heuschrecken erobern wieder den Luftraum mit ihren vibrierenden Tönen. „Wie soll das nur werden! Wie soll das nur werden!“ Hinrich steht vor mir und ringt die Hände. Was zunächst wie theatralische Gebärde wirkt, ist Ausdruck wachsender Erregung. „Nun will Dirk Mudge zurücktreten!“
Dirk Mudge, seit 1980 Vorsitzender des Ministerrats, hat gemerkt, dass seine Regierung nur für Sandkastenspiele vorgesehen ist. Ein Feiertag, der die Historie der Buren würdigt und somit nichts mit Namibia zu tun hat, darf dennoch nicht abgeschafft werden – das bringt das Fass der Frustrationen zum Überlaufen.
Und Hinrich hat soviel Hoffnung in diese Regierung gesetzt, so sehr an diesen Weg zur Selbstständigkeit geglaubt. Er ist kein „Parteimensch“, aber in diesem Falle haben er und viele seiner Bekannten sich der Republikanischen Partei (RP) angeschlossen, die zusammen mit andersrassigen Parteien der Demokratischen Turnhallenallianz (DTA) angehört. Er ist sogar politisch aktiv geworden, hat Versammlungen besucht, Parteiführer in seinem Haus zu Gast gehabt, die Erfahrung gemacht, dass man mit gebildeten Schwarzen hervorragend diskutieren kann.
Und nun will Dirk Mudge zurücktreten. Ist alle Hoffnung dahin? Er schimpft auf die Buren: Sie sind stur, uneinsichtig, kompromisslos! Soll er noch einmal auswandern? In Australien hat er sich schon einmal etwas angesehen – nur: Grund und Boden und Arbeitskräfte sind zu teuer. Ratlosigkeit. Wir verlassen einen deprimierten Hinrich.