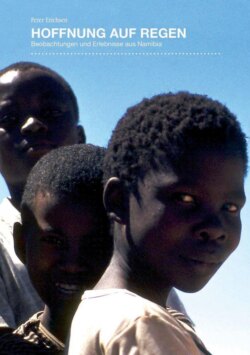Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ANGELAUSFLUG
ОглавлениеBäcker Karl hat alles organisiert. Sein Kombi („station waggon“) ist vollgepackt, hinten steht eine große Kühlkiste mit Bier und Eis. Zwille Bott und ich steigen bei ihm ein, und dann fahre ich das erste Mal in Richtung Westen. Ich bin neugierig auf die richtige Wüste und die Atlantikküste und bitte die beiden alten Hasen, mir möglichst viel zu zeigen und zu erzählen.
Nach 30 Kilometern Bergland erreichen wir den kleinen Ort Usakos. Vor uns liegt das Tal des Khan-Riviers und dahinter, eine Stufe tiefer, eine riesige Ebene.
Das schwarze Usakos liegt weit ab rechts am so genannten Kranzberg, wir sehen eine Ansammlung farbig gestrichener Häuschen, gruppiert um eine Kirche, auf einer Hügelkuppe. Dahinter ist noch einmal der Erongo zu sehen, das letzte Stück aus rötlichem Granit, das zur Wüste hin jäh abstürzt und auf seinem Dach die solarbetriebene Antenne für den Rundfunkempfang dieser Gegend trägt.
Das weiße Usakos hat eine hübsche Ortsdurchfahrt mit Palmen und Jacaranden und einigen Geschäften und endet an der Brücke, die über den breiten Khan führt.
Aus Usakos kommt der Arzt, der zweimal in der Woche von 10-12 Uhr seine Sprechstunde in Karibib hält. Hier gibt es auch ein katholisches Krankenhaus für Weiße und ein barackenähnliches für Schwarze.
Jenseits des Khans steigt die Ebene wieder etwas an. Noch sind wir in der Buschsteppe, aber die Wahrscheinlichkeit von Regen nimmt nach Westen hin stetig ab. Auch die Sträucher werden allmählich kümmerlicher und seltener. Das Wüstengras, in der hochstehenden Mittagssonne silbern glänzend, steht nur noch fleckenweise und am Straßenrand.
Rechts, schon kurz nach Usakos sichtbar, ragt jäh die Spitzkoppe aus der Ebene hervor, ein nacktes Granitmassiv, glatt und knollig wie ein kitschiger Kneteberg. Dahinter mit zehn Kilometer Abstand die „kleine“ Spitzkoppe, wo man Halbedelsteine wie Topas und Aquamarin finden kann. Gegenüber, am südlichen Horizont, begleiten uns die Berge des südlichen Swakop-Ufers. Etwa 50 Kilometer hinter Usakos ist das Land links und rechts der Teerpad immer noch eingezäunt, obwohl hier nichts Fressbares mehr wächst: Ein paar gelb blühende Sukkulenten und halbkugelige Milchbuschpolster – der gleiche Milchbusch, der zu Hause um den Braaivleis-Platz herum aufgrund der besseren Wasserversorgung zu weichstämmigen Bäumen herangewachsen ist.
Der Boden ist voller Steine, eine gelbgraue Schotterfläche, oft blendend hell für die ungeschützten Augen. Nun gibt es auch endlich keine Zäune mehr – es wirkt ja schon lächerlich, mit welcher Zähigkeit die Menschen die Natur bewirtschaften wollen! Jetzt sind wir wirklich in der Wüste.
Vor uns tauchen die letzten Berge auf dem Wege zur Küste auf – die Rössing-Berge. Von der gleichnamigen Uran-Mine habe ich schon viel gehört. Sie soll zu den größten der Welt gehören, mit Tagebau und einer besonders großen Aufbereitungsanlage für das relativ erzarme Gestein. Von der Straße aus sieht man im Süden manchmal Staubwolken aufsteigen, die durch die täglichen Sprengungen entstehen, und im Norden liegt, kaum sichtbar, die Rössing-Stadt Arandis für die etwa 3000 Arbeitnehmer.
Wer das nicht weiß, wird auch nichts davon bemerken, ihm wird höchstens auffallen, dass ihn von nun an auf dem Weg nach Swakopmund eine Pipeline begleitet, in gehörigem Abstand von der Straße. Sie führt gewaltige Mengen Wasser heran, die von der Stadt Arandis sowie von der Aufbereitungsanlage täglich gebraucht werden. Sie stammen aus dem Kuiseb-Rivier, das südlich vom Swakop ebenfalls durch die Wüste führt und bei Walvis Bay endet. Die großen Bäume des Kuiseb, die mitten in der Wüste wegen des guten Grundwassers oft waldartig zusammenstehen, sterben angeblich wegen der starken Grundwasser-Absenkung durch Rössing allmählich ab.
Karl und Zwille zeigen sich darüber besorgt, verlangen eine Beschleunigung der Meerwasserentsalzung. Sie sind sich nicht sicher, ob Rössing genügend kontrolliert wird, ob man dort nicht Raubbau betreibt.
Von anderer Seite habe ich schon wesentlich schärfere Kritik gehört: Staat im Staate, praktisch ohne staatliche Kontrolle, zahlt bisher keinen Cent Steuern, obwohl schon seit über zehn Jahren in Betrieb... Gelobt werden dagegen die sozialen Einrichtungen, die Unterkünfte, die Ausbildungsmöglichkeiten, die in ihrer Qualität weit über dem landesüblichen Niveau liegen. Auch mit der Überwindung der Apartheid ist Rössing weiter als andere, obwohl noch über 90 % der schwarzen Arbeitnehmer den sechs untersten Lohngruppen angehören. Natürlich – alles ist relativ. Nach bundesdeutschen Maß-stäben herrschen hier schlimme Zustände, und ich möchte nicht wissen, wie viel radioaktiven Staub die Arbeiter einatmen müssen...
So reisen wir bequem durch die älteste Wüste der Welt, durch die Namib, und nehmen gelegentlich einen Schluck eisgekühltes Bier zu uns.
Auf einmal bemerke ich, dass die Luft kühl geworden ist, die durch die heruntergedrehten Scheiben hereinweht. Links voraus taucht das Swakoptal auf, ein dunkel-graugrüner Streifen, der sich aus den Bergen herauswindet, der Küste entgegen. Im Trockenflussbett soll es sogar offenes Wasser geben. Bald erkenne ich üppiges Grün, viele Häuser, Gärten. Darüber, auf einem Hügel, thront eine weiße Festung wie aus der Schutztruppenzeit, mit Turm und Zinnen und schwarz-weiß-roter Fahne: ein erst kürzlich erbautes Ausflugslokal. Und dahinter, am Südufer des Swakop – die ersten Namib-Dünen.
Wir sind dicht vor der Küstenstadt Swakopmund. Unter einer dichten Nebelbank über dem nahen Meer sehe ich eine öde Ansammlung niedriger Häuser, von gelbgrauer Wüste umgehen. Doch als wir näherkommen, ist alles sehr grün, Palmenalleen sogar begleiten uns auf unserem Weg in den Ort. Wir fahren die Geschäftsstraße entlang, die hier Kaiser-Wilhelm-Straße heißt und direkt aufs Meer zuführt. Viele gut erhaltene Gebäude aus der deutschen Zeit zieren das Ortsbild. Während sich Karl erstmal ein paar kalte, folienverschweißte Würstchen kauft, weil ihn der Hunger plagt, fliegen große und kleine Schatten über uns hinweg: Schwaden reißen sich von der großen Nebelbank und fliehen in die Wüste, lösen sich dort auf über heißem Sand.
Swakopmund! Die Hauptattraktion für die weißen Südwester besonders in den Sommerferien, also um Weihnachten herum. Dann ist es im Inland oft über 40 Grad Celsius heiß, und alles lechzt nach atlantischer Kühle – und nach einer zünftigen Angeltour.
Wir verlassen Swakopmund in nördlicher Richtung auf einer Straße, die ich für eine Teerpad halte. Farbe, Struktur, Härte und die ebene Oberfläche deuten darauf hin. Aber wir befinden uns auf einer Salzpad: Salzhaltiger Sand wird feucht gewalzt, und die hohe Luftfeuchtigkeit verhindert ein Reißen. Eine praktische und billige Methode des Straßenbaus, die aber leider nur an der Küste funktioniert! Neben der Salzpad künden weiße Halden von Salzgewinnungsanlagen. Das Seewasser wird in flache Pfannen gepumpt und dort durch Verdunstung mit Kochsalz angereichert.
Die trostlose Wüste reicht bis an den Strand, an dem wir nun in Sichtweite entlangfahren. Seine Caravanplätze sind leer, aber in regelmäßigen Abständen stehen betongraue Toilettenhäuschen, wie Schutzbunker aus der Küstenverteidigung.
Die Angler kennen sich hier aus, jeder hat einen Geheimtipp. Karl schwärmt für Meile 28, bekannter sind Wlotzkas Baken und Jakkalspütz. Dicht an dicht standen sie hier in früheren Jahren und konnten die sagenhafte Beute an Fisch kaum bergen, die ihnen der kalte Benguela-Strom bescherte.
Dieses Schlaraffenland gibt es heute nicht mehr. Zuerst verschwanden die Wale, denen Walvis Bay seinen Namen verdankt, und dann gingen auch die übrigen Bestände dramatisch zurück – seit internationale Fangflotten aus aller Welt auch innerhalb der 12-Meilen-Zone den Fischreichtum ausbeuten. Ohne politische Selbstständigkeit kann aber Namibia sein Territorialgewässer nicht wirksam auf 12 Seemeilen, oder, wie in anderen Ländern schon üblich, auf 200 Seemeilen, ausdehnen. Und ohne Küstenschutzflotte nützt auch eine derartige Proklamation nichts9. Schon lange mischt die Republik Südafrika (RSA) bei diesem Raubbau eifrig mit – mit dem Erfolg, dass die früher vorhandene namibische Fischindustrie zerstört ist. Die RSA spielt sich als Schutzmacht auf, obwohl ihm die ganze Welt das Recht dazu bestreitet – aber krümmt keinen Finger, um das nationale Eigentum seines Schützlings zu bewahren. Sicht-bares Zeichen dieser Politik ist die Stadt Walvis Bay, 30 Kilometer südlich von Swakopmund, eine Exklave der Republik, vielfach gefördert und bevorzugt, als Fischereihafen ausgebaut, zum Nachteil des einzigen anderen natürlichen Hafens an dieser langen Wüstenküste, zum Nachteil von Lüderitzbucht und der Nation Namibia/Südwestafrika.
Vor Hentiesbay, einem jungen Küstenort mit burischer Prägung und ohne Anschluss an das öffentliche Stromnetz, biegen wir ab in die niedrigen Dünen. Kurz vor dem Strand wächst Schilf, ein Süßwasserloch, an dem es früher Löwen gegeben haben soll.
Die anderen neun Männer von den Karibiber Rollkutschern halten schon ihre Angeln in die Brandung. Die Sonne scheint, aber von der See weht ein steifer, kühler Wind. Ich setze mich in den Sand und entdecke überall braune Glasscherben, Barfußlaufen ist hier nicht zu empfehlen.
Den Profis gefällt dieser Platz aus anderen Gründen nicht. Wir fahren mit unseren vier Autos weiter, jetzt durch ein Labyrinth von festen, bewachsenen Dünenhügeln. Es geht unablässig auf und nieder, eine Achterbahn ist nichts dagegen, und es ist eine Lust, mit möglichst viel Karacho und ohne Rücksicht auf Materialverlust hindurchzufahren. Ich stehe mit Hubert auf der ausgeklappten Heckklappe eines Landrovers und bin kurz davor, heruntergeschleudert zu werden: Ein besonderer Reiz liegt darin, gleichzeitig zu rauchen und Bier zu trinken.
Durch drei oder vier Dünen vom windigen Strand getrennt richten wir unser Lager ein. Schlafstelle wird ein über den Boden gespanntes Segeltuch.
Vor dem Ufer ragen zahlreiche Klippen aus der starken Brandung. Braunalgenfelder schwanken im wildbewegten Wasser. Viele werden losgerissen und auf den Strand gespült, da liegen sie dann mit ihren meterlangen, armdicken Haftstielen und den langen, ledernen, riemenartigen Blättern und trocknen ein, krümmen sich in der saugenden Sonne und werden hart. „Wie wäre es“, sagt Werner Drechsler, „wenn wir zum nächsten Schulbasar ein Konzert mit Naturinstrumenten machten?“ Er will die Trompetenmundstücke in die Algenstiele stecken und die Schoten des Flame-Tree (Flamboie) als Rhythmus-Instrumente einsetzen. Er ist ein Musiker durch und durch – er sagt das nicht nur so, er bringt es auch fertig.
Gegen Abend im Lager entdeckt jemand verbotene dänische Porno-Spielkarten. Es ist nicht klar, wem sie gehören. Zwille sieht sie sich lange an und ist empört. „Das ist doch eine Schweinerei! Dass das sowas überhaupt gibt!“ Andere geben sich tolerant: „Das muss jeder selbst wissen. Verbieten ist unsinnig.“ – Da fällt mir ein, was Karl heute Mittag im Auto sagte, als wir durch Swakopmund fuhren. Energisch und ernsthaft forderte er die Einrichtung eines Puffs, eines ordentlichen Puffs mit „weißen Weibern“, dann müssen die notleidenden Weißen nicht immer zu den „Negerweibern“ gehen, und es entstehen weniger Coloureds (Mischlinge).
Das Lagerfeuer brennt schon längst im Schutze der Düne. Das mitgebrachte Kameldornholz braucht eine knappe Stunde, bis keine Flammen mehr züngeln und es als glühende Kohle unter den Grillrost geschaufelt werden kann. Dieses berühmte Akazienholz ist extrem hart, besonders im rötlich-braunen Kern, und hält lange die Glut.
Fleisch ist selbstverständlich reichlich vorhanden. Karl hat heute Nachmittag einen „Lachs“ gefangen, den er jetzt in Folie backen lässt. Ob es wirklich ein Lachs ist, weiß ich nicht. Ich bin mit diesen deutschen Bezeichnungen hierzulande vorsichtig – sie scheinen irgendwann einmal aus Deutschland importiert worden zu sein, um der neuen Heimat in Afrika ein wenig das Fremdartige zu nehmen, ein wenig heimische Atmosphäre zu schaffen. Veilchen gibt es hier, Fleißiges Lieschen, Flieder, Weißdorn und Gemsböcke – aber biologisch sind diese Namen nicht zu rechtfertigen, sie gaukeln Verwandtschaft vor, wo keine ist.
Es ist schnell dunkel geworden. Das sonst so lange Leuchten am westlichen Horizont hat heute der aufsteigende Nebel verdeckt. Die Brandung rauscht mächtig über die Dünen hinweg, und im Windschatten sitzen wir auf Holzklötzen und Klappstühlen im Schein des Feuers. Die abgenagten Knochen vom „Braaivleis“ werfen wir in hohem Bogen in die Dünen, denn heute Nacht werden die Schakale kommen. Jan Kolberg hat am Nachmittag einen gesehen, er kam ihm bis auf 20 Meter nahe. Es war ein Schabrackenschakal, der im Gegensatz zum Silberschakal eine lebhaft schwarz-weiß-braun gezeichnete Decke hat – ein kleiner, fuchsähnlicher und nachtaktiver Aasfresser, der gerne den Strand nach angespülten Tierkadavern absucht.
Werner schafft mit seinem Akkordeon die beliebte Lagerfeuerromantik. Gut, dass er auch die Texte kann, sonst sähe es kläglich aus. „Hohe Nacht der klaren Sterne“ hallt durch die Wüste. „Auf der Lüneburger Heide“ ebenfalls und natürlich auch „Wie oft sind wir geschritten“.
Tommi will „Scheiß“ machen. Er hat schon ungezählte Flaschen geleert, stänkert seit geraumer Zeit herum und will den Leuten „Suff“ aufzwingen – mit der Hartnäckigkeit, die Betrunkenen eigen ist. Er unterbricht Gespräche und zieht Jan den Holzklotz unterm Hintern weg.
Da explodiert Zwille: „Hör endlich auf, Tommi Waltz! Du bringst Unfrieden hier rein! Wir wollen in Kameradschaft zusammensitzen, und du machst alles kaputt!“ – Plötzlich hört man nur noch das Rauschen der Brandung. Tommi sagt kein Wort mehr, ganz gegen seine Gewohnheit. In ähnlichen Situationen hört man von ihm oft: „Wenn das so ist, Frau Fenske, zieh’n wir die Hosen wieder an!“ Aber jetzt zieht er sich schweigend und beleidigt zurück und legt sich in seinen Schlafsack.
Die Nacht unterm klaren Sternenhimmel ist kurz und unruhig. In Erwartung großer Kälte habe ich mich viel zu warm angezogen, und das viele Bier drückt auf die Blase. Kaum bin ich etwas eingenickt, da weckt mich ein lautes, beunruhigendes Schaben. Es ist sehr dunkel, die einzelnen Schläfer sind auf dem hellen Segeltuch nur schwach zu erkennen, und von der Feuerstelle geht nur noch ein dunkelrotes Glühen aus. Es dauert eine Weile, bis ich erkennen kann, dass der Hund eines Kegelbruders zwischen den Schlafsäcken liegt und genüsslich die Knochen abnagt, die wir in die Dünen geworfen hatten.
Ich döse wieder ein, höre von weither das Heulen der Schakale. Plötzlich schlägt der Hund an. Irgendjemand springt in sein Auto und schaltet die Scheinwerfer ein. Das grelle Licht erfasst für einen kurzen Moment den Schakal, der unser Lager umkreist. Dann versuchen wir wieder zu schlafen.
Am nächsten Tag fahren wir ständig an der Küste hin und her, immer wieder passt den großen Meistern die Angelstelle nicht. Erst am Nachmittag haben sie etwas Erfolg und fangen einige Kattfische, kleine Welse mit giftigen Flossenstrahlen. Zwei Rochen interessieren mich, einen kleinen Sandhai nehme ich mit für meine Klasse.
Meine eigenen Angelversuche beschränken sich vorwiegend auf Trockenübungen mit der Wurfangel im Dünensand. Doch ich bin nicht sehr geschickt, fast regelmäßig gibt es Leinensalat, weil ich die Rolle entweder zu früh loslasse oder zu spät bremse. In der Brandung macht es etwas mehr Spaß. Ich lerne, wie man Fischbeet (Köder) anbringt und ziehe zwei lange Braunalgen an Land.
Auf der Rückfahrt nehmen wir die Sandpad von Hentiesbay zur Spitzkoppe. Am Ende leiste ich Werner in seinem alten Landrover Gesellschaft. Werner ist über 50 Jahre alt und eine hagere Erscheinung. Er hat es durch eine Reihe von Beurlaubungen aus dem deutschen Schuldienst geschafft, seit nunmehr 12 Jahren hier zu sein, mit seiner Frau, einer ruhigen, sympathischen Südwesterin, lebt er hier sehr kritisch und bewusst und ist deshalb ein Mann, den man fragen kann. Er klagt über die Sturheit und den Rassismus vieler Weißer, berichtet von seinen Auseinandersetzungen mit diesen Leuten, von seinen schwarzen Bekanntschaften, vom zwangsläufigen Erstarken der SWAPO. Privat ist Werner ein Naturnarr und leidenschaftlicher Gärtner und Mineraliensammler, Anhänger alternativer Heilmethoden und Benutzer einer Kornmühle. Er rezitiert gerne, formuliert amüsant und bringt mit seinem gesunden Stimmband beachtliche Kopfstimmen-Gesänge zustande.