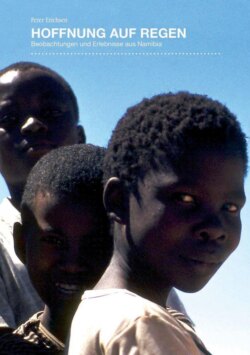Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
OSTERAUSFLUG
ОглавлениеWer von Karibib aus in südwestlicher Richtung auf der Gravel-Pad11 fährt und aufmerksam den Busch absucht, dem werden ab und zu ein paar unscheinbare Steinruinen und Erdwallreste auffallen. Hier führte einmal die erste Eisenbahn des Landes entlang – bis zum Swakoprivier und von da bis an die Küste. Es ist die alte Staatsbahn, die erst 1910 aufgegeben wurde, weil es schon längst eine bessere Verbindung über Usakos gab – sie war schneller und hatte weniger starke Steigungen zu überwinden.
Diese Stilllegung traf Karibib in einer kritischen Zeit. Die Entscheidung für Usakos als Ausgangspunkt für die Otavi-Bahn in den Norden war schon früher gefallen. Damit kam Karibib auch als Standort für die Eisenbahn-Betriebsinspektion nicht mehr in Frage. In Omaruru war das Bezirksgericht eingerichtet worden.
Und jetzt, 1910, kamen neue Gefahren auf den jungen Ort zu: Neben der Stilllegung der Staatsbahn erwog das Gouvernement in Windhoek die Auflösung des Bezirksamtes, der Bezirk Karibib sollte künftig von Okahandja mitverwaltet werden. Das gab Aufregung und eine heftige Sondersitzung des Gemeinderats, auf der eine Stellungnahme beschlossen wurde. Die Schließung konnte mit Mühe abgewendet werden.
Ebenso bedrohlich war in diesem Jahr die Entscheidung, dass auf der langen Bahnstrecke zwischen Swakopmund und Windhoek künftig der Ort Usakos Übernachtungsstation sein sollte. Die Bahnfahrt dauerte damals insgesamt zwei Tage, und in Richtung zur Küste war die Strecke bis Usakos gerade an einem Tag zu schaffen – Karibib lag also nicht in der Mitte.
Wie lange würde es dauern, bis auch die Eisenbahnwerkstätten abgezogen würden? Für die Weißen in Karibib – und nur um die ging es in jenen Tagen – stand viel auf dem Spiel.
Seit 1907 bestand eine deutsche Schule. Es gab Telefon und Wasserleitungen, ein Krankenhaus und drei Genossenschaften. Die Kirche war gerade eingeweiht worden. Das reiche Vereinsleben mit Schützenverein, Kriegerverein, Turnverein usw. konnte mit einer Kleinstadt des kaiserlichen Deutschland durchaus mithalten. Die sechs Hotels sorgten für den geselligen Rahmen. Es war ein blühendes Karibib, das 1908 zu Ehren des Staatssekretärs Dernburg einen „Festkommers“ gab. Für Ruhe und Ordnung sorgten als Hilfskräfte Hereropolizisten mit roten Schärpen, und im Hotelsaal spielte eine „Kaffernkapelle“ die populäre Weise „Trinken wir noch ein Tröpfchen aus dem kleinen Henkeltöpfchen ...“
Schwer vorstellbar ist das alles heute. Fast leblos liegt Karibib in dieser Dornbuschsteppe. Wer hier entlangfährt, der strebt zur Küste, hat kein Interesse, in diesem Ort zu verweilen.
Genau genommen hat damals der Existenzkampf begonnen und dauert immer noch an. Die Überreste der kleinen Steinbrücken sind Altertümer in diesem zeitgeschichtlich so jungen Land. Es ist ein Hobby von Zwille Bott, auf seinen Wanderungen deutsch-koloniale Spuren zu finden, Uniformstücke, Knöpfe...
Es ist Anfang April. Eine PSK-Karawane fährt hier entlang: Vorneweg der große Schulbus mit der aufgemalten, großen Sonne, dann folgt die „Lorry“ (Lastwagen) von Wanninger, hinten drauf die älteren Schüler und das Gepäck. Das Schlusslicht bildet der Küchenwagen – das bin ich mit meinem Landrover, der mit Fressalien vollgepackt ist. Der große Osterausflug des Heims, der alljährlich stattfindet, hat begonnen. Morgen kommt der Osterhase.
Unsere Fahrt endet am Haus der Farm Abbabis, etwa 30 Kilometer von Karibib entfernt. Auch hier gibt es noch alte Gemäuer. Abbabis, am Fuße des großen Otjipatera-Berges, war Bahn- und Poststation und während der großen Aufstände Genesungsheim für verwundete deutsche Schutztruppler.
Links neben den Farmgebäuden wachsen eine Menge Kaktusfeigen auf einem eigens dafür angelegten Feld. Ungewöhnlich ist dieses konzentrierte Grün. Und sie wachsen offensichtlich gut. Die Kakteen mit den riesigen, fleischigen, ohrenähnlichen Blättern sind schon mehrere Meter hoch. In schweren Dürrezeiten eignen sich die zerhackten Pflanzenteile gut dazu, einen Teil des Viehs vor dem Hungertod zu bewahren.
Wir überqueren das Gantzoab-Rivier und folgen ihm am Ufer auf seinem Weg durch die Otjipatera-Berge. Der Name „Gantzoab“ deutet auf Damaras als ursprüngliche Bewohner dieser Gegend, und er meint soviel wie „Öffnung in eine breite Fläche“. Warum das so heißt, sehen wir später.
Jetzt sind erst einmal Hindernisse zu überwinden, denn es lässt sich denken, dass diese Wildnis nicht darauf vorbereitet ist, einen Bus und eine Lorry aufzunehmen. Die schmale Pad, die sonst nur der Farmer mit seinem Bakkie benutzt, ist schlecht, lange Weißdornzweige hängen im Weg, und schließlich ist es ein beindicker Akazienast, der uns endgültig zum Halten zwingt. Aber daran kann in Südwestafrika nichts scheitern, das habe ich mittlerweile gelernt. Da macht man „einen Plan“, wie es hier im Sprachgebrauch heißt, und ein älterer Schüler klettert auf den Ast und müht sich mit einer Bügelsäge ab. So einfach ist das nicht, denn das Holz ist hart, und der Baum steht noch im Saft – wenn man ihm das auch nicht unbedingt ansieht.
Weit ist es auch nicht mehr bis zum vorgesehenen Lagerplatz, und so steigen die meisten Kinder aus und gehen im Sandbett des Flusses voraus.
Es ist früher Nachmittag. Die Fahrzeuge sind glücklich angekommen und parken im dichten Dornbusch – die paar Schrammen zählen nicht. Schlafsäcke, Kanister und Kühlkisten sind ausgepackt. Es ist Zeit, die Gegend zu erkunden. Das Rivierbett ist hier etwa 50 Meter breit. Nach etwa 500 Metern dringt es ins Gebirge ein, hat sich dort einen uralten Weg gebahnt, eine wilde, gewundene Schlucht voller Geröll und mächtiger Felsblöcke.
Kurz vorher durchzieht eine niedrige Natursteinmauer quer das Flussbett. Es ist eine so genannte Grundschwelle aus deutscher Zeit, die das heranbrausende Regenwasser eine Weile aufhalten sollte. So hatte es mehr Zeit, in den Boden einzusickern und das Grundwasser aufzufüllen, und ein ummauertes Becken am Ufer enthielt als Viehtränke noch etwas von dem kostbaren Nass, als das Rivier schon längst ausgetrocknet war.
In der Schlucht wartet eine Überraschung auf uns. Im Felsenschatten steht zwischen glatt geschliffenen Steinplatten – Wasser! Nicht viel, höchstens ein Tümpel, an den schlüpfrigen Rändern von grüner Algenwolle durchwachsen – aber augenscheinlich sauber, und es wimmelt von großen, hell gesprenkelten Kaulquappen, den gleichen, die wir beim Baden in Hinrichs Wasserbassin sahen.
Natürlich sitzen wir alle sofort drumherum, berühren entzückt dieses seltene Element, und Lutz, einer unserer Ältesten, nutzt die Gunst des Augenblicks und schluckt zu unserer Verblüffung mehrere Kaulquappen heil hinunter.
Es ist nicht das einzige Wasserloch. Nachdem wir mehrere Schluchtkurven durchklettert haben, versperrt uns eines geradezu den Weg. Es ist eine tiefe Mulde im glatten, grauen Gestein, umgeben von kleineren, grobkörnigen Kiesflächen und grünen Grasbüscheln. Links und rechts steigen die Felswände fast senkrecht auf, zusammengesetzt aus schräg himmelwärts ragenden, nur meterdicken Gesteinsschichten, die in sich gebrochen sind wie die Wachsrisse einer Batik, mit zahllosen unergründlichen Spalten und Löchern.
Wir Begleiter klettern vorsichtig an dem Wasser vorbei und freuen uns an dem Lustgeschrei der badenden Kinder.
Mit den älteren Schülern ab Klasse 6 setzen wir anschließend unsere Wanderung fort. Hermann Vogel, der hagere, sehnige Mann mit dem ewigen braunen Lederhut, der zusammen mit seiner Frau das Heim leitet, hat ein Seil dabei – wozu, verrät er uns nicht. Die Schlucht wird stellenweise recht eng, ein Wasserloch lässt sich nur schwimmend überwinden – einhändig, versteht sich, um Schuhe und Kleidung zu retten.
Dann stehen Felsbarrieren im Weg, die wir nur mit gegenseitiger Hilfe überwinden können. Bei einem „abkommenden“ Rivier muss sich hier das Wasser stauen, denn die zahlreichen Spalten haben wohl nicht den nötigen Querschnitt. Wahrscheinlich sind es herabgestürzte Felsmassen, die uns derart den Weg versperren. Obendrauf finden wir eingravierte Namen, eine unerwartete, merkwürdige Entdeckung in dieser Einsamkeit, deutsche Namen mit der Jahreszahl 1906, Soldaten vielleicht, die, wohl schon wieder recht einsatzfähig, der Schlucht einen Abschiedsbesuch machten.
Und dann leuchtet vor uns die Sonne. Keine neue Wegbiegung erwartet uns, sondern das Ende unserer Schlucht, eine Felskante, hinter der sich eine andere Landschaft dehnt, zurücktretende Berge, „Gantzoab“ eben, eine „Öffnung in die Fläche“.
Doch bevor wir die Felskante erreichen, müssen drei hintereinander liegende Wasserlöcher durchschwommen werden, die nur durch schmale Felsbrücken getrennt sind und in denen bewegungslos der blaue Himmel ruht.
Das kommt uns gerade recht, denn wir klettern schon länger als eine Stunde, und es war heiß in der Schlucht. Aber meine Erwartung, erfrischt zu werden, wird weit übertroffen: Das wonnekalte klare Wasser wirkt wie ein Rausch, bringt ein Glücksgefühl hervor, das von innen her den Hals hochsteigt und uns lachen lässt, als wären wir toll. Momente der Erregung, in denen man alles vergisst...
Als ich mich endlich aus dem Wasser löse, sattgetrunken und leicht, stehe ich am Abgrund. Zwanzig Meter unter mir ein kreisrunder See mit lehmig-braunem Inhalt, von steilen Felswänden eingeschlossen – nur uns gegenüber die Öffnung zur Fläche...
Hermann mit dem Herrenhut aus Leder verankert das mitgebrachte Seil in einer Felsenspalte und lässt uns daran hinunterklettern, und unten lassen wir uns fallen und schwimmen hinüber, erkunden das dortige Ufer, wo sich in den quer liegenden Felsrippen Teile eines alten Windmotors verkantet haben, wo wir Schlangenspuren im hellen Kies entdecken, wo in feuchten Ecken bunte Kräuter blühen.
Wo kommt nur das viele Wasser her? Das ist für mich die größte Überraschung dieses Ausflugs! Alle klagen über das nunmehr siebente Dürrejahr, und es sieht ja auch wirklich danach aus, wenn man durchs Land fährt – aber hier in dieser Schlucht herrscht Überfluss. Gut, die Verdunstung ist im Schatten nicht so groß, vielleicht wird auch der Verlust durch nachsickerndes Wasser aus unsichtbaren Zisternen ausgeglichen. Aber vielleicht hat es hier am hohen Otjipatera-Berg auch in der Dürre ab und zu geregnet, ohne dass die Menschen drumherum viel davon hatten.
Eine Überraschung ist für mich übrigens auch, mit welcher Selbstverständlichkeit – oder besser: Unbefangenheit – die Kinder einigen Risiken ausgesetzt werden. War schon das Klettern für die zum Teil erst 12-Jährigen nicht ohne Gefahr, so ist es das Abseilen erst recht – zumindest in den Augen eines bundesdeutschen Lehrers, der mit „Wandererlass“ und „Schulrecht“ zu leben gezwungen ist. Wie sind diese Kinder zu beneiden! Sie müssen nicht verstehen lernen, wa-rum ihnen die Erwachsenen dieses oder jenes vorenthalten, warum alles abgestellt ist auf das schlimme Ereignis x, das ja immerhin eintreten könnte und für das die Versicherung nur geradesteht, wenn vorher ein bestimmtes Verhalten gefordert, eingeübt und zumindest formal korrekt kontrolliert wurde...
Wie ist unser Leben in der Bundesrepublik arm geworden! Alles ist künstlich: Unsere Umwelt, das, was wir essen und was wir erleben! Wir haben keine Wildnis, wir trinken kein Wasser mehr und müssen unseren Erlebnishunger mit dem Fernsehen stillen!
Natürlich – die Begegnung mit Namibia beherrscht jetzt mein Bewusstsein, der Abstand zu Deutschland ist größer geworden. Da wird man leicht ungerecht. Ich sollte nicht die individuelle Not vergessen, in die Menschen geraten, wenn wirklich einmal etwas passiert. Aber muss deshalb bei uns drüben in Deutschland jedes normale Lebensrisiko vermieden werden, bis wir im Dschungel der Paragraphen und Versicherungen an Langeweile ersticken?
Herrliches Bild in der aufziehenden Dämmerung: Wir sind zurück im Lager, und in dem Sandbett des Riviers, an seinen buschüberwucherten Ufern haben sich auf tausend Meter Länge kleine Kindergesellschaften niedergelassen, haben ihr Nachtlager vorbereitet, Holz gesucht und Feuer gemacht. Überall, bis hin zum Eingang der Schlucht, steigen dünne Rauchsäulen auf und verraten, wo unsere 120 Schützlinge stecken.
In der Nähe der „Küche“, wo in dem Riesen-Dreifuß Rooibusch-Tee gekocht wird, türmen wir Holz für ein großes Lagerfeuer auf. Nach dem Abendbrot wird es entfacht und alles strömt hier zusammen. Zur Unterhaltung werden kleine Szenen und Sketche aufgeführt und begeistert beklatscht. Eine Vorführung ist für mich besonders beeindruckend und erinnert mich wieder an die Schattenseiten meiner neuen Heimat.
Der Farmer erteilt zwei Schwarzen den Auftrag, ein Loch zu graben. (Wofür? Das geht die Schwarzen nichts an, sie würden es ohnehin nicht begreifen.) Er macht es ihnen vor, wie man gräbt (denn Schwarze sind grundsätzlich dumm), und geht. Kaum ist er weg, stochern die Schwarzen lustlos im Sand herum, legen sich hin und teilen sich den Inhalt einer Schnapsflasche (Schwarze sind faul und versaufen bekanntlich alles.) Als der Farmer wieder erscheint und das Loch immer noch nicht gegraben ist, beginnt er zu schimpfen, nimmt sich sein Glasauge heraus, legt es neben die beiden und droht: „Ich sehe alles!“ (Schwarze sind nämlich abergläubisch und fallen auf solche Tricks herein.) Folgerichtig beginnen sie zu arbeiten. Weil sie nicht gerne beobachtet werden wollen, werfen sie das Glasauge in das entstandene Loch, das sie anschließend wieder zuwerfen. Als der Farmer wieder erscheint und die Bescherung entdeckt, jagt er die Schwarzen unter wüsten Beschimpfungen zum Teufel (sie sind eben zu nichts zu gebrauchen).
Der Sketch wird wirklich gut aufgeführt, die Zuschauer jubeln. Die fünfzehn Coloureds, unter ihnen die hübsche Adri mit ihren schwarzen Haaren und ihrer besonders dunklen Haut, sind wahrscheinlich nicht weiter irritiert. Im täglichen Heimleben gibt es schon gelegentlich rassisch gefärbte Auseinandersetzungen, und das Gefühl, anders zu sein, wird wohl durch manches böse Wort immer wieder gestärkt und durch tatsächliche Mentalitätsunterschiede auch bestätigt – aber die Weißen beschimpfen sich ja untereinander auch mit „Du Kaffer!“, und so bleibt das Zusammenleben erträglich. Kinder zanken sich nun mal und vergessen auch schnell wieder.
Aber dieser Sketch geht tiefer. Er zeigt, dass hinter der Fassade des normalen Kinderzanks tief verwurzelte Grundüberzeugungen verborgen sind. Schwarzenwitze sind keine Ostfriesenwitze.
Es ist dunkel geworden. Die Mutter eines Schülers, eine begeisterte Astronomin, richtet etwas abseits von uns ihr Teleskop auf den Saturn und öffnet einigen interessierten Kindern die Augen für das All. Aber dann werden die roten Glühpunkte unseres Lagers schwächer, und nur noch wir Erwachsenen sitzen im still gewordenen Rivier. Im Mondlicht verstecken wir die selbst gebackenen Osterhäschen. Die Ameisen finden trotz Cellophan einen Weg ins Innere, aber das schmälert am nächsten Morgen nicht die Wirkung von Ostern im afrikanischen Busch.