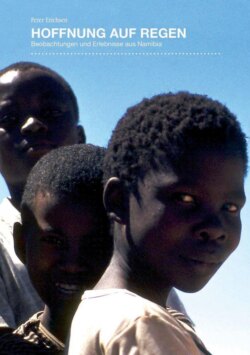Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SCHWIERIGE LAGE
ОглавлениеMeine künftige Wirkungsstätte hab ich mir natürlich schon vor Tagen angesehen – zuerst vorsichtig mit Abstand von außen, und dann in das Innere eindringend unter Führung Jan Kolbergs. Mein erster Eindruck ist ganz gut. Die relativ neuen Gebäude wurden um einen Schulhof herum gebaut, der etwa quadratisch ist, mit Platten belegt und durch drei natursteinummauerte Beete verschönt. An einer Fahnenstange hängt ein Stück Rohr, mit dem man Schallzeichen geben kann, wenn die Klingel einmal ausfällt.
Am Eingang an der Straße blüht eine Hecke, und eine kleine Dattelpalme kämpft sich mühsam durch den steinigen Boden. Ein großes Wappen mit einer Lilie und der Jubiläumszahl 75 daneben ziert die Wand des flachen Verwaltungsgebäudes. Hier ist das kleine Sekretariat untergebracht, der Arbeitsplatz von Uschi Seitz, der Frau meines vermittelten Kollegen. An der Schulhofseite werden die Räume dieses Gebäudes durch einen überdachten Schattengang erreicht. Der wichtigste Raum für mich ist das schmucklose Lehrerzimmer mit Holzstühlen und resopalbeschichteten Tischen, einer kleinen Teeküche und einer Lehrerbücherei voller Staub und heilloser Unordnung.
An der Westseite des Hofes steht das Turnhallengebäude, in dem auch Nebenräume wie Kegelbahn, Bibliothek, Kühlraum für Heimvorräte und ein Tagungsraum untergebracht sind. Die kleine Turnhalle mit Parkettfußboden und Empore hat außerdem eine Bühne, wird also als Mehrzweckraum genutzt.
An der Nordseite steht ein einstöckiges Haus mit sechs Klassen – die oberen drei werden durch eine Außentreppe und einen Außengang erschlossen. Schmucklos sind die Räume auch hier, und ebenfalls mit recht abgenutztem Mobiliar ausgestattet. Hinzu kommen noch zwei ältere Gebäude an der Ostseite mit den Fachräumen und den Klassenzimmern für die ganz Kleinen.
Der Luxus und die Perfektion bundesdeutscher Fachräume,
insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich, können hier kein Maßstab sein. Deshalb bin ich auch nicht enttäuscht über das Alter der Einrichtung und den Grad ihrer Abnutzung, über die Provisorien und den Staub. Ich hab damit gerechnet, improvisieren zu müssen oder auf manche Inhalte zu verzichten.
Das Schulgelände ist sehr weitläufig, große, steinige Freiflächen gehören dazu und sogar ein Tennisplatz – wenn auch mit gerissenem Betongussboden.
Auf der anderen Seite der Straße liegt das Heim. Das sind mehrere langgestreckte, barackenähnliche Gebäude mit Innenhöfen und viel Platz drumherum. Im Zentrum steht der Ess-Saal mit seinem repräsentativen, Marmor verzierten Eingang.
Auf den Freiflächen existierte früher ein richtiger Privatzoo. Brüchige Verschläge und Maschendrahtwände zeugen davon. Ein paar Truthähne und Enten laufen noch herum – und sogar zwei Paviane. Ansonsten ist das Gelände völlig verwildert.
Reptilien hat es gegeben, auch Antilopen. James Krüss war einmal hier (1966) und hatte ein Erlebnis mit einem Warzenschwein. Er schrieb darüber ein Gedicht und verhalf dem Heimzoo und damit auch der Privatschule (PSK) zu einem gewissen Ruhm, von dem man noch heute zehrt. Auf jeden Fall wurde das Gedicht in das Lesebuch für die unteren Klassen aufgenommen und wird nach wie vor stolz auswendig gelernt.
Den Schulen in Namibia sind fast immer Heime angeschlossen. Zu weit verstreut wohnen die Menschen, Schulen können deshalb nur an zentralen Orten eingerichtet werden, wo die Kinder in Heimen wohnen. Besonders weiße Farmkinder sind hiervon betroffen. Aber es gibt rassische, ethnische und damit auch politische Komplikationen, die eine normale Schulversorgung zusätzlich erschweren.
Der Einzugsbereich der PSK reicht vom 200 Kilometer nördlich liegenden Otjiwarongo bis zum 400 Kilometer südlich liegenden Marienthal. Diese gewaltige Streubreite ist nicht durch Zentralisation der Bildungsangebote allein zu erklären. Zwischen Otjiwarongo und Marienthal gibt es mindestens drei andere deutsche Schulen, die aber zum Leidwesen der deutschbewussten Südwester staatliche Schulen sind. Ihr Besuch ist zwar kostenlos, aber sie richten sich nach südafrikanischen Lehrplänen, Organisations- und Erziehungsmethoden. Ihnen fehlt die direkte Verbindung zu dem, was das heutige Deutschland ausmacht, es fehlen deutsche Lehrbücher und deutsche Lehrer. Die Pflege der deutschen Sprache, seit etwa 70 Jahren das Hauptanliegen der Deutschstämmigen, will man nicht unbedingt denen überlassen, die eine andere Muttersprache haben oder die selbst der „Pflege“ bedürfen.
Also kommt nur eine deutsche Privatschule in Frage, die materiell und personell erheblich durch die Bundesrepublik unterstützt wird. Aber da gibt es ja in Windhoek die wesentlich größere und leistungsstärkere DHPS (Deutsche Höhere Privatschule). Wer in Marienthal oder Windhoek wohnt, könnte also 200 Kilometer sparen – wenn die Rivalitäten nicht wären.
Die PSK hatte es nämlich immer schon etwas schwerer, genügend Schüler an sich zu ziehen. Ohne städtisches Einzugsgebiet ist sie zu einem besonders hohen Prozentsatz auf Farmerkinder angewiesen. Bleiben diese aus, zum Beispiel weil sich die wirtschaftliche Situation durch die Dürre verschlechtert hat oder weil die Schule auch andersrassige Kinder aufnimmt, so trifft dies die PSK ungleich härter als die DHPS. Da heißt es, klug zu sein und richtig zu taktieren, eine „Marktlücke“ zu finden, die eine Existenz im Schatten des großen Rivalen erlaubt.
Eine bewusst oder unbewusst betriebene Methode war die Schaffung eines besonders starken Zusammengehörigkeitsgefühls zwischen Schule und Elternschaft. Das wurde begünstigt durch die Überschaubarkeit der kleinen Schulgemeinde und die Aktivitäten der Ehemaligen. Es war etwas Besonderes, in der PSK zur Schule gegangen zu sein. Wenn man seine Kinder ins Heim brachte, ergab sich ein Treffen besonderer Art: Die Eltern einer besonderen Schule pflegten eine besondere Gemeinschaft, und weil Karibib etwas abseits liegt, blieben sie auch über Nacht, was zu berühmt gewordenen Festen führte.
Etwas Besonderes war und ist auch die Nähe zur Natur. Ausflüge, Tiererlebnisse, der Heimzoo und das Herumstrolchen im Busch, der gleich neben dem Heim beginnt. Da werden Buden und Höhlen gebaut und im nahen Klippenberg verbotene Abenteuer erlebt. Kein Wunder, wenn davon die Ehemaligen bis ins hohe Alter schwärmen!
Manchmal aber halfen diese Besonderheiten nicht, die Existenz zu sichern. Und so warb man mit dem Argument, die PSK kümmere sich auf Grund der fast familiären Atmosphäre besonders um die schwachen und hilfsbedürftigen Schüler. Dies war aber ein zweischneidiges Werbeinstrument.
Die PSK ist – wie alle Schulen in Südafrika – eine Einheitsschule, d.h. eine Gesamtschule vom ersten Schuljahr bis zum „Matrik“, dem landesüblichen Schulabschluss, der auf verschiedenen Niveaustufen erreicht werden kann.
In den höheren Klassen mehrzügiger Schulen gibt es einige wenige Differenzierungsmöglichkeiten. Auf die unterschiedlichen Begabungsmöglichkeiten könnte also im hiesigen Schulsystem meist nur im Rahmen des normalen Unterrichts Rücksicht genommen werden – und dazu sind die Lehrer noch weniger als wir in der Bundesrepublik ausgebildet. Ihnen fehlen die Freiheit und die Qualität eines guten alten deutschen Zwergschul- und Landlehrers. Ihre Aufgabe ist es, in 35-Minuten-Einheiten durch Vortrag und anschließende Schüler-Stillarbeit ein vorgegebenes Tagesziel zu schaffen.
Das ist zwar an den Privatschulen nicht so ausgeprägt – wir haben 40-Minuten-Stunden und keinen starren Zwang zur Planerfüllung. Aber eine besondere Betreuung der Schwachen und Hilfebedürftigen findet dennoch nicht statt – ausgenommen die Zuwendung, die allein durch die kleinen Klassen möglich wird. Schon wegen der Einzügigkeit gibt es in Karibib bis zum 9. Schuljahr keinerlei Differenzierung. Die Last „der besonderen Betreuung“ ruht deshalb fast ganz allein auf dem Heim.
Somit ist die Sache gescheitert, bevor sie überhaupt begonnen hat: Die Eltern, die dieser Werbung glauben, schicken ihre problematischen Kinder nach Karibib, die aber dort im Schulbetrieb genau wie anderswo völlig scheitern. Die weiteren Folgen: Das allgemeine Leistungsniveau sinkt, was sich allmählich herumspricht und die bildungsbewussten Eltern dazu veranlasst, ihre Kinder abzumelden oder gar nicht erst anzumelden, was wiederum zu einer Häufung von Problemkindern in der PSK führt – ein Teufelskreis.
Das Argument der „besonderen Betreuung“ war der Sündenfall im Konkurrenzkampf mit der DHPS, und als die Schulleitung in Furcht vor weiterem Schülerrückgang auch noch Schüler mitschleppte, die nicht normal bildungsfähig waren oder aufgrund ihrer Herkunft nur höchst mangelhaft die deutsche Sprache beherrschten, war der Niedergang der Schule vorprogrammiert.
Das alles wäre nicht so schlimm, ja könnte sogar ins Positive gewendet werden, wenn die Schule ihren Bildungsauftrag neu definieren würde – der „besonderen Betreuung“ im Heim müsste also auch eine „besondere Betreuung“ in der Schule folgen. Das heißt: Differenzierung nach Begabung, Schaffung eines Sonderzweigs oder Umwandlung in eine Art Sonderschule, Bildungsangebot für die mehr praktisch begabten Kinder und entsprechende Veränderungen im Lehrerpersonal.
Zurück zu dem großen Einzugsbereich der PSK: Er ist das Ergebnis der Konkurrenzsituation. Aber die Schule ist dennoch von 150 auf 120 Kinder geschrumpft, und die 120 sind uns treu geblieben aus alter Anhänglichkeit oder aufgrund fragwürdiger Werbesprüche, und das ist insgesamt eine schlechte Basis für die Zukunft. Schon in den ersten Wochen meiner Lehrtätigkeit drängt sich dieser Eindruck auf.
Ich habe beispielsweise eine Standard II (4. Klasse) als Klassenlehrer übernehmen müssen – an sich schon eine problematische Entscheidung, denn diese Klassenstufe kenne ich nur aus der Zeit meiner Ausbildung und einem späteren kurzen Gastspiel im Fach Kunst.
Aber die Klasse hat nur sieben (!) Schüler – na, das wird doch zu schaffen sein, denke ich, und das sagen auch die andern. Aber was sind das für Schüler! Drei Kinder würde ich als normal bezeichnen, die anderen sind – vorsichtig ausgedrückt – stark verhaltensauffällig. Verbale Aggressivität herrscht als Grundstimmung. Ein falscher Blick, ein Lächeln zur Unzeit, ein Wort kann zu viel sein, und ein Schüler steht auf und geht auf den andern los, mit plötzlich hassverzerrtem Gesicht. Absolute Unfähigkeit, Kritik zu ertragen, zeigt sich an den verzweifelten Gesichtern, an der völligen inneren Blockade, wenn nicht gemachte Hausaufgaben nachgeholt oder Fehler berichtigt werden sollen. Die völlige Unfähigkeit zuzuhören, führt immer wieder zu Missverständnissen und Konflikten. Und habe ich einmal durch Trick oder Druck ihre Aufmerksamkeit erworben, so sehen sie mich mit unruhig flackernden Augen an, lauernd, bereit zu jederzeitigem Absprung. Ich bin der Verzweiflung nah, der pädagogische Bankrott sitzt mir an der Gurgel, ich zweifle an meiner Berufung.
Wie schaffe ich es, dass Uwe nicht ständig herumläuft? Dass Clinton einen Satz abschreibt, obwohl er das Schreiben hasst? Dass Adri einmal für eine Minute schweigt, damit ich mit der Klasse ein Gespräch führen kann? Ich kann doch nicht immer nur vorlesen und singen!
Das Problem ist: Wie verschaffe ich den Kindern positive Erlebnisse, wenn sie doch so viel falsch machen, so viel nicht können und nicht wollen? Wie sehr müssen sie die Schule hassen, vielleicht auch die Erwachsenen, dass sie allem ausweichen und entfliehen, was damit zu tun hat! Wo ist die Gutwilligkeit, die Leistungsbereitschaft, die diesem Alter eigen ist?
Jede Zensur, die ich geben muss, ist Gift. Ich weiß das, aber finde kein Mittel, die explosive Wirkung dieses Gifts zu mildern. Ich gehe zu sehr von der „Normalschule“ aus, dabei müsste ich jetzt Heilpädagoge sein. Und es wird mir auch mehr und mehr klar, dass ich kein Grundschullehrer, sondern Realschullehrer bin. Könnte ich doch aus meinem methodischen Füllhorn schöpfen, hätte ich doch mehr Ideen zum Spielen!
Übrigens: Uwe, Clinton und Adri sind drei von den insgesamt 15 sogenannten Coloureds, d.h. sie sind Mischlinge, ein Elternteil oder Großelternteil ist weiß. Das Elternhaus ist zweisprachig und möchte das Kind in deutscher Sprache und Kultur erzogen wissen.
Das sollte man akzeptieren, und die deutsche Bundesregierung hat mit der vor einigen Jahren erzwungenen Öffnung der deutschen Privatschulen für alle Rassen die Aufnahme dieser Kinder möglich gemacht.
Wohl wissend, dass sie keine Leistungsdifferenzierung anbieten können, haben die südafrikanischen Schulvereine jedoch der Bundesregierung das Zugeständnis abgerungen, nur solche Kinder aufnehmen zu müssen, die des Deutschen mächtig sind. Die größeren Schulen wie in Windhoek, Johannesburg, Pretoria und Kapstadt bieten dazu vorbereitende Sprachkurse an. Das Ergebnis dieser höchst mangelhaften „Öffnung“: Kaum jemand wird übernommen, weil Sprachkurse allein, zusätzlich zum Besuch der bisherigen Schule, die notwendigen Fertigkeiten nicht vermitteln können.
Für Uwe, Adri und Clinton hat es nicht einmal Sprachkurse gegeben. Uwe hat sie auch nicht nötig, sein Deutsch ist besser als das der meisten weißen Schüler hier in Karibib. Clintons Verwahrlosung und Leistungsverweigerung hätte sowieso eine Teilnahme unmöglich gemacht. Adri hätte wahrscheinlich davon profitiert. So aber muss ich sagen, sind Clinton und Adri mit ihrem gebrochenen Deutsch eine schwere Belastung für die anderen Kinder. Was nützt das sprachliche Vorbild des Lehrers, wenn ständig ein Teil der Kinder schlimmstes Deutsch von sich gibt? Und zwar in einer derartigen Konzentration, dass es unkorrigierbar ist? Ich müsste Adri und Clinton den Mund verbieten, um die anderen zu schützen.
Und Schutz vor fremdsprachlichen Einflüssen brauchen diese Kinder dringend – wenigstens im Deutschunterricht! Das allgegenwärtige Afrikaans, die Sprache der Buren, das Englisch der Geschäftswelt, Herero, Nama, Ndonga – die Sprachen der Bediensteten und Arbeiter – alles wirkt auf das Kind ein, das noch nicht einmal seine Muttersprache beherrscht. Und dann beginnen die beiden deutschen Privatschulen auch noch im 3. Schuljahr mit dem Pflichtfach Afrikaans! In der Vielsprachigkeit stecken große Chancen, aber auch große Risiken.
Die deutschstämmigen Kinder in Karibib haben ebenfalls sprachliche Defizite. Und wenn ich die Erwachsenen reden höre – ihre Eltern –, dann wundere ich mich nicht. Das so genannte Südwesterdeutsch ist leider keine Jugendsprache, die sich später wie von selbst erledigt, sondern dieses Konglomerat von Vokabeln verschiedenster Herkunft und die grammatischen Verstümmelungen durch Übertragung fremder Sprachstrukturen auf die deutsche Muttersprache (Interferenzen) wird auch fleißig von vielen Erwachsenen gesprochen. Und ich habe den Eindruck, dass sie sich des Ausmaßes dieses Sprachverfalls nicht bewusst sind. Vielleicht wird hieran auch wieder deutlich, wie sehr sich in Karibib ein Personenkreis konzentriert, der nicht genügend Energie in die Erziehung steckt oder stecken kann.
Südwester-Deutsch:
Jong, diese bleddie Schreibmaschine dschoppt nicht.
Ich wunder, was die hat!
Ein Kack! Ich krieg schwer, um das alles mit der Hand
zu schreiben. Und ich hab noch stief zu tun, bis das Buch
klar ist! Miskien nehm ich mir ne schmahrte Alte...
Übersetzung:
Junge, Junge – diese blöde Schreibmaschine
funktioniert nicht. Ich frag mich, was mit der los ist! So ein
Mist! Es wird mir schwer fallen, alles mit der Hand zu
schreiben. Und ich hab noch so viel zu tun, bis das Buch
fertig ist! Vielleicht sollte ich mir eine tüchtige Schreibkraft
nehmen …
In der Bundesrepublik gibt es seit Jahren eine Dauerdiskussion um die gesunkenen Rechtschreibleistungen. Auch in diesem Bereich gibt es hier – wie sich denken lässt – noch viel größere Probleme. Da habe ich nun schon vorsichtigerweise in der 7. Klasse einen Text diktiert, den ich in Deutschland einer 5. Realschulklasse zumute, und komme auf einen Durchschnitt (ohne Zeichensetzung) von 12 Fehlern!
Trotz aller inneren Bereitschaft, diesen Leistungsstand als gegeben hinzunehmen und ihn als Ausgangspunkt für die weitere Arbeit zu akzeptieren, bin ich doch immer wieder fassungslos. Es beschleicht mich dieses hilflose Gefühl machtlos zu sein, nicht genug bewirken zu können, weil alles schon zu sehr verfestigt ist und weil ich als Deutschlehrer offensichtlich der einzige bin, der diesen Kampf kämpft.
Ich habe mich zu einer besonderen Förderung einiger Kinder entschlossen, obwohl ich bereits 30 Wochenstunden unterrichte. Erfahrungen mit der Betreuung von Legasthenikern habe ich ja. Es sind auch ein paar LÜK-Kästen da, die ich mit einsetze. Aber Wörter wie „drängen, zürnen, wirken, Raupe“ muss ich erst erklären, damit die Kinder die Hefte durcharbeiten können.