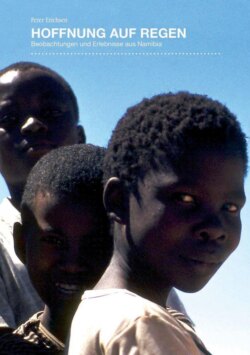Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE FARM
ОглавлениеHeiß brennt die Sonne, als wir nach kurzem Schlaf ins Freie treten. Schnell wird uns klar, dass wir Hüte tragen müssen, und wir suchen den Schatten, treten heraus aus der blendend hellen Luft, über die sich der makellos blaue Himmel streckt. Sonntagsruhe liegt über der Farm – aber das bedeutet nicht, dass es still wäre. Durchdringendes Pfeifen der Singzikaden liegt in der Luft, auch Grillenmusik mischt sich dazwischen, und hin und wieder das grobschlächtige, stoßartige Alarmgeschrei der Sandhühner im nahen Busch rundum, dieses heisere Stakkato, das allmählich verebbt und wieder versinkt im fast schmerzhaft hohen Dauerton der Zikaden.
Auch die kräftigen „Irish Terrier“ unserer Gastgeber sorgen für akustische Abwechslung, wenn irgendetwas Fremdes sich regt oder unsere Kinder ihrem Verhau zu nahe kommen. Oder auf der dreihundert Meter entfernt liegenden Locasi, wo die Familien der schwarzen Farmarbeiter wohnen, schreit ein Donkie, wie der Esel hier genannt wird. Sein heiseres Quietschen, mit mechanischer Genauigkeit mehrmals wiederholt, hat wenig Ähnlichkeit mit dem Wohlklang eines „I – A“, erinnert mich eher an die harte Arbeit eines schlecht geölten Windrades, das hier überall im Farmgebiet das Wasser aus der Tiefe holt.
Die beiden Gästezimmer bilden den rückwärtigen Teil der Farmgarage. Die Türen führen direkt ins Freie, in den Hof zwischen der äußeren und inneren Umzäunung. Da steht auch ein kleines Klo-häuschen mit Wasserspülung, ein kleiner Frosch hat sich ins Keramikbecken verirrt und sorgt für Aufregung bei den ohnehin aufgeregten Kindern.
Dünnen Schatten finden wir unter einer mächtigen Weißdornakazie, deren altersschwere Äste durch Eisenringe und Stangen gestützt werden. Die eindrucksvollen vier bis fünf Zentimeter langen weißlichen Dornen geben fast mehr Schatten als die winzigen Fiederblättchen.
Wir haben Angst um die nackten Füße unserer Kinder, und so beginnt hier schon Immes nervenaufreibender Kampf um das Schuhe anziehen. Mal ist der Boden zum Verbrennen heiß, mal liegen auf ihm Dornen oder „Pieker“ oder die Fliesen im Innern der Häuser sind zu kalt, mal empfiehlt es sich als Schutz gegen Schlangen und Skorpione – ein Grund fürs Schuhe tragen findet sich immer für mitteleuropäische Eltern.
Es ist fast unerträglich heiß, etwa 40 Grad Celsius. Aber leichte, möglichst baumwollene T-Shirts sollen wir trotzdem tragen, die Verdunstungskälte auf der Haut birgt Erkältungsgefahren.
Aber wir können baden. Hinter dem weiß getünchten Farmhaus steht auf einer Anhöhe ein Betonring, etwa 1.80 Meter hoch und vier Meter im Durchmesser. Hier hinein wird das Grundwasser gepumpt, das die Windräder fördern, und von hier fließt es wieder hinab zu den Wasserhähnen des Farmhauses. Wir packen unsere Badesachen und gehen eine kurze Strecke durch die Sonne, durchqueren die innere Umzäunung, an den Zitrusbäumen vorbei, an dem kreisrund gemauerten Kühler, an der Küche des Farmhauses, wo zwei schwarze „Weiber“ arbeiten, schließen wieder sorgfältig zwei Zauntore hinter uns und ersteigen so das doppelt gesicherte Wasserreservoir.
Es ist kurz vorher gerade gereinigt worden. Nur auf dem Boden ist es noch etwas glatt von Algenbewuchs. In dem klaren Wasser schwimmen zahlreiche Kaulquappen, schwarz und silbrig gesprenkelt, in allen Größen, und zwischen schillernden, treibenden Käferleichen huschen Wasserläufer hin und her.
Erschrockene Vögel steigen auf aus dem trockenen Gebüsch ringsum, als unsere drei Kinder mit ihren lustigroten Schwimmärmeln das herrlich frische Wasser erobern. Die Sehnsucht nach Wasser, und wie sie sich erfüllt!
Aber genauso faszinierend ist der Rundblick von hier oben! Eingetaucht drehe ich mich langsam auf einem Bein, während die Sonne mein Haarpolster aufheizt, und genieße das 360-Grad-Panorama. Das Land ist eine Ebene, besonders im Osten und Norden gleitet der Blick über endlosen Busch und findet keine Grenze. Irgendwo dort, vielleicht 40 Kilometer entfernt, liegt der nächste Ort, Otjiwarongo. In unmittelbarer Nähe des Farmhauses erkennen wir die Viehkräle, eine kreisrunde Viehtränke, Vorratsgebäude mit Windmotor, landwirtschaftliche Maschinen, Wellblechdächer und dünne Rauchsäulen: die Locasi oder auch „Werft“ mit den wenig ursprünglichen „Pontoks“, wie die Behausungen der Schwarzen überall genannt werden. Und dazwischen immer wieder die unvermeidlichen Termitenhügel, oft regelrechte Dome aus Sand, zwei bis vier Meter hoch, je nach Bodenbeschaffenheit mal kalkig-weiß oder lehmig-beige oder sandig-rot.
Im Westen fällt unser Blick auf eine Bergkette. Die Grenze der 9000 Hektar großen Farm führt oben auf dem Grat entlang, alles ist mit Busch bewachsen, nur selten sehen wir nackte Felswände hervorglänzen.
Im Anschluss daran steht im Süden ein markanter Kegelberg, der Paresis, der wie ein Markenzeichen die Farm beherrscht, und durch den freibleibenden Einschnitt in der Südwestecke führt die Farmpad in Richtung Süden – der nächste Nachbar, hinter den Bergen, wohnt 15 Kilometer entfernt.
Vom Paresis-Berg führt ein schmaler, holperiger Weg auf uns zu, auf das gerodete Schussfeld rund um den äußeren Zaun, auf das Haupttor und zeigt mit fast barocker Symmetrie durch die Pforte der inneren Umzäunung durch den Garten genau auf die Mitte des langgestreckten, flachdachigen, blechgedeckten Farmhauses, dorthin, wo sich die Haustür befindet, die bei jedem Öffnen zweistimmig klingelt.
Der Garten des inneren Kreises ist durch Zäune aufgeteilt. Links und rechts liegen Zitrus- und Gemüsegärten mit dem Hundezwinger, aber vor der schmucklosen Hausfront blüht um einen grünen Rasen herum Hibiscus und Bougainvillea, und es duftet nach Oleander und Apfelsinenblüten.
Unter dem Wohngebäude einer größeren Farm haben wir uns mehr vorgestellt, etwas mehr Pracht am Bau, vielleicht ein bisschen „vom Winde verweht“ – aber unsere Gastgeber wohnen sehr einfach. Es ist nicht nur das Farmhaus, das sie vor 13 Jahren übernommen haben, als sie ihren landwirtschaftlichen Betrieb in der Bundesrepublik an die ansiedlungswillige Großindustrie verkauft hatten. Auch die Einrichtung, die Küche zum Beispiel, verrät keine großen Bedürfnisse.
Aber was reden wir! Wir Bundesdeutschen wissen nicht, welche Folgen eine Bevölkerungsdichte von einer Person pro Quadratkilometer hat! Mehr Menschen, mehr Kaufkraft, mehr Werbung – und schon reicht der abgestoßene Milchtopf nicht mehr, schon fühlt man sich unwohl auf dem ewig knitterigen Läufer, schon meint man mithalten zu müssen mit den ewig konsumierenden, renommierenden Nachbarn, die man täglich sehen muss.
15 Kilometer vom nächsten Nachbarn, 40 Kilometer vom nächsten Ort entfernt – an städtisches oder gar großstädtisches Leben ist nicht zu denken. Wo Geselligkeit selten ist, werden offizielle Anlässe wie die Beerdigungen zum gesellschaftlichen Ereignis. Dafür fahren die Leute auch ohne Bedenken 200 Kilometer. Aber die geringe Bevölkerungszahl – deutschsprachige Südwester dürfte es höchstens 20.000 geben – bringt es mit sich, dass sie dennoch unter sich bleiben. Überall kennt man sich, gibt es verwandtschaftliche Beziehungen – eine solche Gemeinschaft ändert sich nur langsam, lässt nur nach heftigem Abwehrkampf Neues oder Fremdes an sich heran.
Der gesamten südlichen Fassade des Hauses war ursprünglich eine lange, überdachte Veranda vorgebaut, die dann später geschlossen wurde. Heute ist es ein langer Flur, von dem aus man sämtliche Räume erreichen kann, die ihrerseits zum Teil noch die alten Fenster haben. Auf diesem Flur sitzen wir oft, wenn wir auf die Mahlzeiten warten. Die Möbel, die Illustrierten auf dem Tisch, die Garderobe an der Wand erinnern mich an ein Wartezimmer beim Arzt. In einer Flurecke steht eine von den mit Petroleum geheizten Tiefkühltruhen.
In diesen Tagen gibt es in den Abendstunden regelrechte Insekteninvasionen. Sie stürzen sich auf uns, setzen sich auf unsere Haut, vom Falter bis zum Kerbtier von der Größe unserer Junikäfer, brummen und summen, dass wir nur noch um uns schlagen. Aber jede Abwehr ist aussichtslos. Wenn wir hastig die klingelnde Haustür hinter uns zugeworfen haben, ist es wieder einer Insektenwolke gelungen, die knappe Öffnung zu nutzen. Wir sollten duldsamer werden, unserer Nerven wegen.
Die Hausfrau sieht es nicht gerne, dass ich mich als Mann in der Küche nützlich mache. Das erklärt, warum ich hier oft allein mit Hinrich und den sonst doch nur störenden Kindern warte. Auch nach dem Essen machen sich die Männer schnell aus dem Staub – aber nur bei mir hinterlässt das ein anerzogen schlechtes Gewissen. Morgens und mittags helfen ein oder zwei „Weiber“ von der Locasi. Die Frau des Hauses lässt kein gutes Haar an ihnen: Sie sind unzuverlässig und dumm. Nur Kinder können sie kriegen – und die sitzen dann oft geduldig vor der Küchentür und warten, bis ihre Mutter fertig ist. Hinrich ist nach Meinung seiner Frau zu gutmütig gegenüber seinen „lieben Negerlein“, hat zu viel Verständnis.
Was sie damit meint, wird klar, wenn wir mit Hinrich allein sind und ihn auf seinen täglichen Kontrollfahrten über die Farm begleiten. Dann legt er seine „Platten“ auf, dann philosophiert er zum soundsovielten Male über Gott und die Welt, und er braucht nicht unbedingt Reaktionen, wenn er so richtig loslegt. Und da für uns alles neu und interessant ist, findet er gute Zuhörer.
So erfahren wir von acht Schülern, die er sich von der benachbarten staatlichen Versuchsfarm geholt hat, zum Maishacken. Die einfachsten Handgriffe muss er immer wieder erklären und einüben, es ist zum Verzweifeln. Händeringend lässt Hinrich sein Steuer los, so sehr erregt ihn das. Aber seine eigenen Leute sind nicht viel besser. Da sollen sie zum Beispiel Mais nachsäen. Aber anstatt nun Reihe für Reihe systematisch vorzugehen, laufen sie einfach so ins Feld. Das können sie einfach nicht, dafür haben sie einfach keinen Sinn.
Wir hören von dem jungen Schwarzen, der vorhin den Hofplatz harkte: Er ist Vater zweier Kinder und ist mit seiner Familie vor einiger Zeit von einer benachbarten Farm gekommen (50 km). Als die Frau Heimweh bekam, schickte er sie und die Kinder „in den Tabak“ und nahm sich eine 16-Jährige von der Locasi.
Oder die Geschichte von Paul: Ein guter Arbeiter (das gibt es also auch!), seit acht Jahren auf der Farm. Aber seine vitale Frau macht ihn systematisch kaputt, sie geht fremd. Eines Tages schließt sie sich als „Marketenderin“ einer politischen Wahlkampftruppe von der DTA (Demokratische Turnhallenallianz) an, herausgeputzt mit Kleid, Hut und Stöckelschuhen. Das gibt ihrem Mann den Rest. Er erklärt seinem Baas: „Mister, ich gehe morgen weg.“ Sprach’s und ward nicht mehr gesehen. Hinrich: „War immer ehrlich, und jetzt hat der Hund meine Drahtzange mitgenommen!“ Das Werkzeug, Wert 20 Rand, findet sich jedoch später wieder an.
Oder die Geschichte von dem „Aussteiger“ Ben, einem Schwarzen aus der Republik, der dort in den Goldminen gutes Geld gemacht hatte und sich einen Goldzahn ins Gebiss bauen ließ. Dann wurde er krank und verließ aus irgendeinem Grunde seine Heimat. Nun lebt er auf Hinrichs Farm als Ziegenhirt, wandelt anspruchslos, fast heiter seiner Herde hinterher, ein Außenseiter, hager, mit einem silbern aussehenden Ring im Ohr und dem Alkohol ergeben. Hinrich hält ihn für sehr intelligent, aber er macht nichts mehr daraus. Immer wenn Ben am Zauntor steht, nach seinem Mister ruft und um 10 Rand Vorschuss bittet, dann weiß der Farmer: Elisabeth ist wieder da und erleichtert die Männer auf der Locasi um ihr bisschen Geld. Einmal bin ich dabei, als Hinrich ihm wenig glaubhaft erklärt, er habe selbst kein Geld, er müsse erst zur Bank. Schließlich gibt er ihm einen kleinen Betrag, und ich hoffe nur, dass es zur Beseitigung eines vorübergehenden Notstands reicht...
Wir spüren: Hinrich beschäftigt sich mit seinen Leuten. Er registriert nicht nur ihr Versagen bei der Beachtung mitteleuropäischer Wertvorstellungen. Er geht weiter, versucht menschliche Dimensionen zu erfassen. Das ist in diesem Land nicht selbstverständlich, wie wir noch oft erfahren werden. Hier ist ein Urteil schnell bei der Hand, oder besser, was die Schwarzen betrifft: Es ist seit vielen Jahrzehnten fertig, seitdem wenig verändert worden.
Theodor Leutwein, erster Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika, hatte noch ein recht ausgewogenes Urteil. Seine 1909 veröffentlichen Erinnerungen enthalten eine Reihe Beispiele dafür. Er wehrt sich sogar gegen Vereinfachungen und Vorurteile, die damals natürlich schon weit verbreitet waren. Spätestens seit den „Eingeborenenaufständen“ 1904-1907, in deren Folge mehr und mehr apartheidstypische Bestimmungen das Nebeneinander regeln, haben intellektuell redliche Einschätzungen keine Chance mehr.
Nachdem in unserer Zeit die Schwarzen Afrikas mit Ausnahme Namibias und Südafrikas ihre Erfahrungen mit einer rechtlichen Unabhängigkeit machen durften und ihre Lern- und Bildungsfähigkeit grundsätzlich nicht mehr angezweifelt werden kann, gibt es eine Neubesinnung. Aber sie setzt sich erschreckend langsam durch in einem Land wie Namibia, in dem die Weißen etwas zu verlieren haben.
Aber wie weit dringt Hinrich vor bei der Erforschung der schwarzen Seele? Weiß er, was man so redet, abends an den Feuern vor den „Pontoks“, wenn man sich unbeobachtet fühlt? Was weiß er von Liebe, Zorn und Wut? Kennt er ihre Geschichten?
Er und seine Frau und die meisten Weißen in diesem Land kennen nur ein Nebeneinander der Rassen. Nie waren sie bereit, miteinander zu leben, ihr Urteil ist von äußerlichen Wahrnehmungen geprägt.
Oft geriet ich in der Folgezeit ungewollt in Gesprächssituationen, die mich darüber belehren sollten, dass ich ein Greenhorn sei und auch eins bleiben würde – ein Dscherrieländer eben, einer von den Neunmalklugen von drüben. „Leb du erst mal zehn Jahre mit den Schwarzen, dann kannst du vielleicht mitreden!“ Mal sollte die Probezeit zehn Jahre dauern, mal sechs, mal zwanzig Jahre, je nachdem, wie verbittert mein Gesprächspartner gerade war, jedenfalls unerreichbar für mich. Meist hatte ich für diese Zurechtweisung gar keinen Anlass gegeben, es sei denn durch meine bloße Anwesenheit.
Und immer deutlicher entlarvte sich das Scheinargument: Keiner von den Südwestern hatte jemals mit den Schwarzen gelebt. Und auch ein Schwarzer hält das kaum für eine realistische Möglichkeit. Nicht nur die Weißen leben „apart“, auch die Schwarzen zeigen kein erkennbares Interesse an den Stämmen der Weißen. Sie sind seit vielen Jahrzehnten daran gewöhnt, von ihnen abhängig zu sein. Ihre besonders auf dem Lande oft hündische Unterwürfigkeit mit ihren Verbeugungen und ihrem ständigen „Ja, Mister! Ja, Missis!“ kam uns vor wie ein automatisiertes Verhalten, mit dem sich leidlich leben lässt und hinter dem man trefflich seine wahre Identität verbergen kann.
Wenn wir in Europa von Völkerverständigung reden, dann meinen wir den Versuch, durch gegenseitige Besuche, persönliche Kontakte, das Lernen der anderen Sprache, durch Leben in den anderen Familien die anderen zu verstehen, uns mit ihnen zu verständigen. Der so verstandene Begriff ist in Namibia ein Fremdwort. Umso bemerkenswerter sind die Äußerungen des Swakopmunder Bürgermeisters im Jahre 1985, der zu eben dieser Völkerverständigung aufruft.
Auf den Kontrollfahrten mit Hinrichs Isuzu-„Bakkie“ lernen wir viel. Die 9000 Hektar sind in 28 Camps eingeteilt, die hauptsächlich der Rinderzucht dienen. Die Umtriebswirtschaft wird ergänzt durch eigene Produktion von Kraftfutter für die 1a-Ochsen.
Das Gebiet hier ist einigermaßen regensicher, d. h. es fallen pro Jahr durchschnittlich etwa 400 Millimeter, und wenn man den richtigen Riecher hat und die Saat rechtzeitig vor dem ersten großen Regen in die Erde bringt – das ist meist so zwischen Weihnachten und Neujahr der Fall – und wenn dann der Regen sich noch einigermaßen auf die Wochen verteilt, dann gedeiht in dem roten Sand mit seiner leidlichen Wasserbindungsstruktur alles hervorragend: Hirse („Kaffernkorn“ genannt), Mais, Bohnen, Futtergras.
Aber in weiten Teilen des Landes herrscht eine schon sechs Jahre andauernde Dürre. Vor kurzem erst war es auch auf Hinrichs Farm besonders schlimm. Um seine Rinder durchzufüttern, musste er dornenlosen Busch hacken, Gelbholz, von dem es hier in der Dornbusch-Savanne Gott sei Dank einiges gibt. Auch jetzt steht nicht viel gelbes Gras auf dem Halm. Vor allem mangelt es noch an wertvollem mehrjährigem Gras, das in dichten Bulten wächst.
Sogar Sonnenblumen hat unser Gastgeber schon einmal angebaut und wurde dafür von seinen Nachbarn für verrückt erklärt. Die meisten machen sich nicht die Mühe mit dem Ackerbau, sie wirtschaften extensiv, überstocken leicht und zerstören sich damit den Ast, auf dem sie sitzen: die Grasnarbe.
„Die Rinder gehören hier nicht her“, sagt Hinrich, der Rinderfarmer, während er am Viehposten gerade kontrolliert, ob genügend Wasser in dem hohen Betonring steht. Hier, am Schnittpunkt mehrerer Camps, ist tatsächlich alles zertreten und staubig. Im dünnen Schatten der Dornbüsche steht gut aussehendes, rotbuntes Vieh und glotzt uns kauend an. Die hätte ich mal sehen sollen, als er sie auf einer Versteigerung im Hereroland erwarb! Hinrich freut sich auf ein gutes Geschäft.
Wir haben heute keinen Schwarzen von der Locasi hinten auf der Ladefläche stehen. Deswegen bin ich als Beifahrer dran, bei jedem Farmtor herauszuspringen, um es zu öffnen und hinter dem Isuzu wieder zu schließen. Wer das nicht kennt, erfährt manchmal die Grenzen seiner Intelligenz: Es ist erstaunlich, wie viele verschiedene Verschlussmöglichkeiten aus so einfachen Dingen wie Eisenzapfen, Eisenring und Kette konstruierbar sind.
Hinrich doziert weiter: Das Rind zerstört die Pflanzendecke, es zertrampelt sie mit seinen groben Hufen und reißt die Gräser mit der Wurzel aus. Das Gras steht aber in Konkurrenz zum Busch. Ist die Grasnarbe zerstört, haben auch die tiefer liegenden Wurzeln der Sträucher eine größere Chance. Die Folge ist eine zunehmende Verbuschung, die kaum noch Grasweide wachsen lässt. In der funktionierenden Natur gibt es von Zeit zu Zeit Buschbrände, bei denen der Busch aber nur dann abgetötet wird, wenn noch vorhandene Grasweide für die nötige Hitzeentwicklung sorgt.
Hinrichs Kampf gegen die Verbuschung ist zweigleisig: Erstens vermeidet er Überstockung, und zweitens lässt er vom Flugzeug aus gezielt Entlaubungsmittel versprühen. Er glaubt, dass das Gift schnell genug wieder abgebaut ist und befürchtet bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen auch sonst keine Nachteile. Aber vielleicht weiß er nur keine ökologisch und ökonomisch vertretbare Alternative.
Er zeigt mir ein mit Gift behandeltes Camp. Die Wirkung ist nicht zu übersehen. Der tote Busch wird umgeschlagen, und das Gras hat wieder eine Chance.
„Die Weißen machen alles kaputt“, beginnt Hinrich urplötzlich einen seiner Ausflüge ins Grundsätzliche. Die Radikalität dieser Selbstkritik überrascht mich immer wieder. Aber vielleicht ist er noch nicht lange genug im Land? „Kultur und Religion der Weißen haben die Schwarzen entwurzelt. Der Eingeborene ist von Natur aus anspruchslos und arbeitsscheu. Diese Lebensweise ist eigentlich vernünftig und der Umwelt am besten angepasst.“
Bezogen auf die Rinder heißt das: Die Hereros waren zwar große Viehzüchter und hatten den Ehrgeiz, ihre Herden wachsen zu lassen, weil dadurch auch Macht und Einfluss der Besitzer stiegen. Aber erst die Weißen brachten die Idee mit, daraus ein Geschäft zu machen.
Und es lässt sich nun einmal kein Geschäft machen mit Rindern, die auf der Suche nach Weidegründen Hunderte von Kilometern durch den Busch getrieben werden und irgendwann an Altersschwäche eingehen. Und da die Schwarzen das nicht begreifen wollten, mussten die Weißen die Sache in die Hand nehmen. Dazu brauchten sie das Land, bei dessen Erwerb sie – im Gegensatz zu manch anderen Kolonialmächten – zunächst zumindest den Schein der Legalität wahrten (Kaufverträge). Und so veränderten sie die Natur, nicht zuletzt durch die Millionen Kilometer Zaun, die den natürlichen Wanderbewegungen des Wildes Einhalt geboten. Der Ackerbau dagegen ist immer noch ein Stiefkind der Wirtschaft. Hinrich ist überzeugt, dass Südwest Selbstversorger sein könnte. „Stattdessen produzieren wir nur 20 % der notwendigen landwirtschaftlichen Produkte. Wir arbeiten nicht genug 3.“ Auch er habe im Grunde nicht viel zu tun, aber er sei immer noch fleißiger als die meisten anderen Farmer. Er gehört zu den wenigen, die sich überhaupt mit Ackerbau beschäftigen und wird von manchen belächelt. Aber er sieht sich auf dem richtigen Weg. Wenn ihm der weiße Mais gelingt, dann mahlt er ihn sogar selbst mit seiner Hammermühle – das volle Korn, nahrhaft, wie man es im Laden nicht kaufen kann. Das Maismehl ist für seine Leute ein überragendes Grundnahrungsmittel, aus dem griesbreiähnlicher Milipapp gekocht wird.
Wir fahren zurück, immer an den Zäunen der Camps entlang. An einigen Stellen steckt der Boden voller Blumenzwiebeln, wir sehen breite, flach am Boden liegende Blätter, die an Amaryllis erinnern. Ein Schwarm rotgrüner Vögel fliegt auf, zwei prächtige Kudubullen mit weit ausladenden, gedrehten Hörnern flüchten im dichten Busch. Eine Warzenschweinfamilie kreuzt den Weg – es gibt hier sehr viele von ihnen, und sie richten zum Ärger des Farmers einigen Schaden in dem Maisfeld an.
Vorhin schon hatten wir im Nordosten über Otjiwarongo eine dunkle Wolkenbank gesehen. Es ist jetzt 14.30 Uhr, und der Himmel über uns zieht sich zu. Das Donnergrollen ist näher gekommen, und Hinrich hofft wieder. Der Mais braucht dringend Regen, er hält nicht mehr lange durch. Das wäre mal wieder ein großer Verlust. Das Kraut käme in die Silage – um wenigstens etwas zu retten.
Wir halten an und steigen aus. Hinrich zeigt mir einen mächtigen beige-farbenen Bullen mit einer weit herunterhängenden Wamme, ein Brahmane für die Zucht.
Ein würziger, erdiger Geruch hängt in der Luft. Er ist unglaublich intensiv, ich glaube ihn gleichzeitig riechen, schmecken und fühlen zu können. So riecht der Regen, wird mir erklärt. Oder, genauer: Es ist der Duft, der der heißen Erde entströmt, wenn sie von frischen Regentropfen nassgeküsst wird. Dann zerplatzen erste Himmelsgeschosse in dem heißen Sand und überziehen ihn mit duftenden Sommersprossen. Schnell wird der Regen dichter. Wir flüchten unters Autodach und schließen die Fenster. Ohrenbetäubend und hart schlägt das viele Wasser gegen das Blech. Bald sitzen wir in tropisch schwüler Luft, aber auch draußen ist eine Waschküche.
Wir setzen uns langsam in Bewegung, an den Scheibenwischern vorbei sehen wir stäubendes, springendes, dampfendes Wasser auf der Kühlerhaube. Die Umgebung ist grau verhüllt. Im Nu strömt es in reißenden Bächen über die Pad, obwohl uns doch das Farmgelände bisher so eben vorgekommen war. Das gibt eine Menge Arbeit, die verspülten Wege wieder herzurichten, aber Hinrich neben mir schmunzelt. Offensichtlich hat er soeben entschieden, dass dies der ersehnte Regen sei: „Dann könn’ wir nachher ja mal `n Sekt trinken.“
Als wir am Farmhaus ankommen, ist der Boden neben den Pfützen weiß. Murmelgroße Hagelkörner sind hier heruntergekommen. Der Regenlärm verebbt, aber ein mächtiges Rauschen ist noch in der Luft. Zuerst glauben wir an anhaltende Niederschläge oder Windböen in der Nähe. Aber das Rauschen steht in einem merkwürdigen Kontrast zu der Ruhe, die uns umgibt in der wieder hervorbrechenden Sonne. Von der Locasi schallen Rufe herüber.
„Das Rivier4 ist abgekommen“, sagt Jan, der Sohn der Familie, und schnappt sich sein Motorrad, und wir fahren neugierig hinterher. Zwischen der Locasi und dem neuen Feld, das im nächsten Jahr erstmalig genutzt werden soll, strömt wild gurgelndes, wirbelndes Wasser in etwa drei Meter Breite. Als wir heute Morgen hier hindurchfuhren, war es nur ein unbedeutendes Hindernis, eine kurvige schmale Kiesrinne. Jan gebärdet sich wie ein wildes Fohlen, er rauscht übermütig mit seiner Maschine quer durchs Rivier und schafft es auch so gerade eben. Hinrich sieht das nicht gern, er schimpft, macht sich Sorgen über die Unbekümmertheit seines Sohnes.
Aber es geht ja alles gut. Und der Regen hat 25 Millimeter gebracht.
Aus „Demokritos afrikanus“, Im Affenland, Berlin 1912