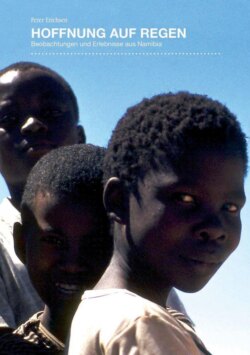Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINKAUFEN
Оглавление„Heute wollten sie mich schon wieder zuerst drannehmen!“, erzählt mir meine Frau am Mittagstisch. Sie war einkaufen, das ist morgens ihre wichtigste Beschäftigung. Vor dem Ladentisch war allerhand los, alles Schwarze. Sie richtete sich auf längeres Warten ein, als es plötzlich hieß: „Frau Erichsen, was darf es sein?“ Die anderen Kunden, obwohl früher gekommen, machten scheu und willig Platz.
Und das war nicht das erste Mal. Offensichtlich ist das hier üblich, das Verhalten der Menschen beweist es. Aber nicht mit meiner Frau! So etwas geht ihr gegen den Strich, und energisch und furchtlos ist sie auch. Was sie in solchen Situationen sagt, klingt nicht immer sehr diplomatisch, aber jetzt sagt sie nur ganz freundlich: „Nein, ich bin noch nicht dran!“ und weist auf die anderen Kunden.
Die aber machen auch keine Anstalten, bedient zu werden, und so entsteht Verlegenheit auf allen Seiten – bis es dem Kaufmann zu viel wird und er unwirsch alle und niemanden anblafft: „Ja --- was ist nun! Wer will hier was haben!“
Geschickte Geschäftsleute lassen sich nichts anmerken, sie tun so, als habe dieser Angriff auf den gesellschaftlichen Konsens, diese Beleidigung landesüblicher Sitten gar nicht stattgefunden. Nun ist Frau Erichsen in diesem kleinen Nest ja auch nicht irgendwer – und Rücksichtnahme bis zur Selbstverleugnung im Geschäftsleben nichts Besonderes. Aber es gibt hier auch noch Menschen von altem Schrot und Korn, die ihre aufrechte Gesinnung nicht schnödem Geschäftssinn opfern. Bei denen erntet man schon einmal ein Achselzucken, ein Kopfschütteln oder eine ärgerliche Bemerkung.
Natürlich, in den Augen dieser Menschen beweist meine Frau mit ihrem Verhalten mal wieder, dass sie noch überhaupt nichts verstanden hat. Sie bestätigt das Klischee von den Dscherries, den naiven Weltverbesserern, den Negerfreunden.
Auf der Barclay’s Bank ist es übrigens anders. Alle, ob schwarz oder weiß, stehen in einer Schlange. Vielleicht schlägt hier englische Tradition durch, denn „english people like to queue“. Meine Frau, die etwas gegen uniformiertes Strammstehen hat, erfährt eines Tages, als sie lässig aus der Reihe tanzt, einen anderen Grund: Genaues Hintereinanderstehen sei hier üblich, denn es brauchte ja niemand zu sehen, was der andere an Geld habe oder erhalte. Persönlicher Datenschutz also! Wer hätte das gedacht.
Ansonsten werden wir sehr zuvorkommend und hilfsbereit bedient. Besonders im alten Hälbich-Store herrscht ein sehr persönlicher Ton. Wie früher in unseren Tante-Emma-Läden erkundigt man sich gegenseitig nach dem werten Befinden und bespricht mehr oder weniger wichtige Tagesereignisse – und solange müssen die anderen Kunden warten.
Auf dem Ladentisch wird noch eine Waage mit Gewichten benutzt, um beispielsweise Obst zu wiegen, und an allen Wänden ringsum stehen Holzregale bis zur Decke des hohen, schmalen Ladens. Viele Artikel sind nur mit einer Leiter zu erreichen: Töpfe, Eimer, Pfannen, Schüsseln. Die beiden Kühlschränke für Getränke und abgepackte Lebensmittel wollen dagegen nicht recht zur übrigen Einrichtung passen.
Sind gerade keine Zitronen da, so wird der schwarze Bote geschickt – oder es wird auch einmal aus privaten Beständen ausgeholfen. Im Nachbarraum werden Textilien angeboten, und hinten im Lager sitzt Hartmut Hälbich, zuständig für Handwerkerbedarf. Hierhin gehe ich, wenn ich etwas reparieren will und es nicht kann oder eine spezielle Schraube brauche – Hartmut Hälbich, ruhig und freundlich, weiß meistens Rat.
Das Verhältnis zu den schwarzen Mitarbeitern scheint frei zu sein von Überheblichkeit und Geringschätzung. Da hab ich schon anderes erlebt. Als ich zum Beispiel in Otjiwarongo auf der Post war, um ein Gespräch nach Deutschland vermitteln zu lassen: Diese Herablassung, mit der die kleine blonde Afrikaanerin ihrem schwarzen, uniformierten Mitarbeiter die Gnade erwies, ihr die Zigaretten holen zu dürfen und – wenig später auch noch den Aschenbecher! Das war schon beeindruckend.
Aber auch hier auf der Karibiber Post: Wie der junge, weiße Dienststellenleiter mit dem fettigen, glatten Haar in absoluter Herrenmanier seinen schwarzen Mitarbeiter heranwinkt und ihm mit lässigen Fingerbewegungen klarmacht, dass sein Hemd nicht ordentlich in der Hose stecke. Und das alles ohne Humor, ohne Augenzwinkern, sondern eine bierernste Demonstration vor meinen Augen – als wollte hier eine geschundene Kreatur auch einmal ganz oben sein und die Puppen tanzen lassen. Dummheit und Arroganz ergeben zusammen eine gefährliche Mischung. Ob, wie mir neulich ein deutschsprechender Südwester sagte, diese Mischung besonders bei den Buren auftritt? Ob die Deutschen ein grundsätzlich besseres Verhältnis zu den Schwarzen haben?
Aber zurück zum Einkaufen: Dass die Versorgung in Windhoek besser ist als in Karibib, liegt auf der Hand. Sofern die Ware nicht ohnehin an Ort und Stelle hergestellt wird, gestattet der größere Absatzmarkt auch einen größeren Transportaufwand. Besonders leicht verderbliche Ware ist deshalb in Karibib oft von schlechter Qualität – und trotzdem teuer.
Einige Gemüsearten werden allerdings ganz in der Nähe produziert, was mich sehr überrascht. Ich habe neulich eine Farm etwa 20 Kilometer östlich von Karibib gesehen – mit großen Gemüsefeldern mitten im steinigen, sandigen Busch! Und ohne Sonnenschutz-Abdeckung! Allerdings ist diese Farm bekannt für ihr ausgezeichnetes, ergiebiges Grundwasser und war deshalb früher schon Haltestation für die Bahn zum Zwecke der Wasseraufnahme. Und angeblich wachsen dort auch keine Karotten ohne massiven Einsatz von Insektiziden, Herbiziden und Kunstdünger.
Diese insgesamt doch recht zaghaften Versuche zur Eigenproduktion in Namibia werden übrigens massiv von der Republik Südafrika gestört. Regelmäßig starten in dem gemüse- und obstreichen Süden riesenhafte Lastzüge zu ihren Kreuzzügen durch die arme Namibia-Provinz und unterbieten die lokale Konkurrenz. Das gilt nicht als Import, denn eine Grenze zwischen diesen beiden Ländern gibt es ja nicht, und den Südafrikanern ist vermutlich alles recht, was ihrer eigenen Wirtschaft dient. Das deckt sich mit dem, was mir Wilhelm Sonnenberg über die Industrieansiedlung erzählte.
Das Einkaufen in Karibib ist also vorwiegend eine Beschäftigung meiner Frau. Es ist ihre Möglichkeit, unter Leute zu kommen, die einzige Abwechslung, die sie hat, während ich meinem Lehrerberuf nachgehe. Viel ist das nicht für sie, die paar Geschäfte sind schnell abgeklappert, und es empfiehlt sich, ohne Einkaufszettel auszukommen, damit man immer wieder einen Grund hat, noch einmal loszufahren.
Hier und da wird ihr eine Tasse Kaffee angeboten, besonders in dem Laden-Wohnzimmer der alten Frau Vollert, mit der sie sich ganz gut versteht. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann, der ein bekannter Kunstmaler ist, einen Mineralien- und Souvenierhandel für durchreisende Touristen, plaudert gern in geschliffenem Deutsch und ist auch deshalb interessant, weil sie zum alten Karibiber Inventar gehört. Frau Waltz und Wilhelm Sonnenberg sind ihre Geschwister, die sich allerdings nicht unbedingt in Liebe verbunden fühlen.
Dann und wann kommen interessante Kunden hereingestaubt. Dieser Laden ist für Imme fast so etwas wie das Fenster zu einer großen Welt, die ab und zu dem kleinen Karibib die Ehre einer flüchtigen Begegnung gibt. Deutsche sind darunter, die aus unserer Heimat kommen und mit denen meine Frau sogar gelegentlich gemeinsame Bekannte ausmacht – so verrückt das auch klingen mag! Aber es kommen auch die Schwarzen. Plastiktüten tragen sie herein, gefüllt mit den unterirdischen Knollen der Teufelskralle. Sie werden gewogen und bar bezahlt. Hartmut Vollert, der Sohn, handelt damit, bezieht sie zum Teil auch aus dem Ovamboland, vertreibt sie bis nach Deutschland und macht nach eigenen Aussagen ein gutes Geschäft. Seit einiger Zeit baut er sich auf einer Kleinfarm kurz vor Karibib eine Anlage zusammen, mit der er die Weiterverarbeitung der Teufelskralle zu Tee anstrebt.
Der Pflanze wird eine große Heilwirkung zugeschrieben. Die alte Frau Vollert schwört darauf – sie sei dadurch von Arthritis und Arthrose befreit worden. Das violettblühende Kraut mit den widerhakigen, geweihähnlichen Früchten wächst an mehreren Stellen außerhalb von Karibib. Am Flugplatz haben wir weite Strecken durchwühlter Erde gesehen – hier nutzen einige Einheimische ihre Chance, ein paar Rand zu verdienen. Die Bestände, so Hartmut Vollert, seien dadurch nicht gefährdet.
Andere Schwarze wiederum erscheinen mit kleinen Säckchen im Laden. Irgendwo haben sie im Sand gekratzt oder Gestein zerhauen, um ein paar „Klippekies“ (klippetjies) zu finden, für die weiße Mineraliensammler oder Touristen Geld geben könnten. Wahrscheinlich kennen sie auch zahlreiche ruhende Minen in der Gegend, in denen nicht gearbeitet wird, deren Eigentümer ihnen unbekannt ist, in denen mit einfachen Mitteln noch ein paar Turmaline zu finden sind. Wer fragt sie nach dem Woher? Wer könnte die Richtigkeit ihrer Angaben überprüfen? Sie brauchen Geld, und Vollerts haben Interesse an günstigen Steinen – und so kommt der Handel zustande.
Oder auch nicht – wenn es wertloses Material ist oder wenn, wie Vollerts erklären, der Schwarze „unverschämt“ wird. Meine Frau, die nebenan sitzt und auch einmal mitbekommt, wie Hartmut Vollert mit einer Peitsche einem Schwarzen hinterherläuft, kann nicht beurteilen, wer da wem etwas antun will – die sprachliche Barriere ist zu hoch. Wer der Stärkere ist, steht für sie allerdings nie außer Zweifel.
Ab und zu wird Karibib aber doch zu eng. Und dann bricht sie aus nach Windhoek, nutzt irgendeine Mitfahrgelegenheit oder fährt selbst, kann dann endlich einmal die bunte Vielfalt genießen, die sie schon lange entbehrt, das Warenangebot, bei Wecke & Voigt, die Schaufenster, all die Versuchungen und Lockungen, an die sie doch so gewöhnt ist. Schwer bepackt kehrt sie dann, meist erst am nächsten Tag, zurück, bereit, wieder ein paar trockene Wochen in Kauf zu nehmen.