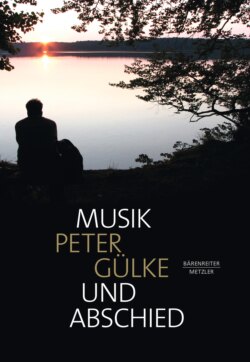Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|23| 5
ОглавлениеDavor und danach
Fern kann er nicht mehr sein,
der tod
Ich liege wach,
damit ich zwischen abendrot und morgenrot
mich an die finsternis gewöhne
Noch dämmert er,
der neue tag
Doch sag ich, ehe ich’s
nicht mehr vermag:
Lebt wohl!
Verneigt vor alten bäumen euch,
und grüßt mir alles schöne.
In Reiner Kunzes dem eigenen 80. Geburtstag zugesprochenen Gedicht ist außer zwei epilogisch auslaufenden Versen der fünfte (»mich an die finsternis gewöhne«) der einzige, der das vierhebige Metrum (-/-/-/-/-) als Zeilenganzes ungestört wahrt. Es fällt nicht schwer, das zwischen Spruch und Strophenordnung schwebende Kleinod zu verschandeln, es versuchsweise ins Streckbett jenes Metrums zu zwingen – nicht, um es zu »enttarnen«, vielmehr, um einen latenten Hintergrund in den Blick zu bekommen, von dem aus Licht auf rhythmische Freiheiten, unregelmäßige »Takte« fällt, dank derer es zwingender, gebundener erscheint, als es in streng gebundener Sprache der Fall wäre:
Fern kann er nicht mehr sein, der Tod.
Ich liege wach, damit ich zwischen
Abendrot und Morgenrot
mich an die Finsternis gewöhne.
Noch dämmert er, der neue Tag,
|24| doch sag ich, eh ich’s nicht vermag:
Lebt wohl!
Verneigt vor alten Bäumen euch,
und grüßt mir alles Schöne.
Das ist grässlich. Beim zweiten und dritten Vers dieser Version knirscht es erheblich, im sechsten dürfte »mehr« nicht wegfallen, zudem lassen alle Verse vor »Lebt wohl!« außer »Abendrot und Morgenrot« am Anfang auch daktylische Skansion zu: /- -/-/-/(-). Diese Ambivalenz gibt dem Anfangswort besonderes Gewicht – im Jambus ist »Fern« leicht, im Daktylus schwer; ohnehin empfindet man das Gedicht als mit zwei Schweren beginnend: »Fern kann er …« Nur in den beiden letzten Versen läuft der vierhebige Jambus unbehelligt geradeaus; insofern könnte man sie als Fluchtpunkt und Offenlegung jenes Hintergrundes deuten, wären sie nicht »Coda«, Vermächtnis, da mit »Lebt wohl« und dem einzigen Satzzeichen am Ende einer Strophe bereits das Schlusswort gesprochen scheint.
Andererseits nehmen sie den Tonfall des Anfangs auf. Die entspannte Diktion von »Fern kann er nicht mehr sein, / der tod« lässt für sich genommen nicht darauf schließen, dass es sich um ein Gedicht handelt; allmählich spricht sich der Dichter in dieses hinein. Am ehesten deutet das nachgestellte »der tod« auf gebundene Sprache hin, jedoch wäre es bei »Fern kann der Tod nicht mehr sein« aufgrund des dann möglichen, durchlaufenden Daktylus (/- -/- -/) noch stärker der Fall. Das Schlüsselwort bedarf eines Anlaufs; wenn nicht nachgesetzt, käme der Tod zu selbstverständlich daher.
Die Coda der zwei Schlussverse steigert die Redeweise des Beginns, wobei die metrische Bindung die sanft ironische Tönung unterstreicht: Es müssen nicht unbedingt »alte Bäume« sein, vor denen wir uns verneigen sollen, sie stehen für vieles andere; und wenn wir »alles schöne« grüßen sollten, hätten wir viel zu tun. Das mit dunklen, letzten Dingen befasste Gedicht soll leicht enden, nahe bei Heines salopper Volte: »Wenn du eine Rose schaust, / sag, ich lass sie grüßen«, auch nicht weit weg von Hyperion-Hölderlins bekennerischer Schwere: »Wenn du an mein Grab kommst …, auch die Bäume grüße und die fröhlichen Bäche, und lass, du Liebe! dir mein Bild dabei begegnen.«
|25| Als reiche für den Tod der syntaktische Anlauf nicht aus, bekommt er eine eigene Zeile; dem Schlaflosen (»Ich liege wach«) wird die Nacht auch in der weitaus längsten, syntaktisch kompliziertesten Zeile lang; und das oben hypothetisch ins Versmaß gezwungene »Doch sag ich, eh ich’s nicht vermag« muss gestört, zur stauenden Barriere aufgehöht werden, um dem »Lebt wohl!« Nachdruck und Gewicht einer Mündung, des eigentlich letzten Wortes zu verschaffen. An solchen Unebenheiten – Klopstock nannte es »körnigten Styl« – hat die Möglichkeit der glatteren, metrisch »einverstandenen« Formulierung untergründig teil.
Angesichts des Gegenstandes verwundert nicht, dass der Text sich in allegorisch dicht besetztem Terrain bewegt. Dem scheint unter anderem Rechnung getragen, wenn »abendrot und morgenrot« sich in die vierte Zeile drängen und sie zur sperrigsten, längsten machen, »abendrot« symbolisch prallvoll, »morgenrot« bis hin zu »leuchtest mir zum frühen Tod« kaum weniger, beides zusammen präjudiziert unter anderem durch Wilhelm Müllers »Vom Abendrot zum Morgenlicht / ward mancher Kopf zum Greise«. Und in der »finsternis«, an die das Ich des Gedichts sich gewöhnen will, treffen Schlaf und Tod sich in lang eingeübter Brüderlichkeit. Dies bestätigt der zögernd heraufkommende Morgen (»Noch dämmert er, / der neue tag«), als traue der Sprechende sich eine emphatische Begrüßung der Sonne, von Licht und Leben nicht mehr zu.
Wenn fühlbar aus normativen Strukturen herausgesprengt, sprechen Details eindringlicher; demgemäß liegen Trümmer des supponierten metrischen Gehäuses noch anderswo herum. Auch als Widerpart zu »Lebt wohl!« als dem einzigen anderen zweisilbigen Vers musste »der tod« von dem ersten abgetrennt werden, zudem findet er so deutlicher ein Klangecho bei »abendrot« und »morgenrot«; »noch« und »doch« signalisieren, dass sie innerhalb ein und derselben Strophe als zwei Versanfänge nebeneinander gestanden haben könnten; und die dichte Folge der Reimworte »tag«, »sag« und »vermag« trägt zum Imbroglio vor der Auflösung ins »Lebt wohl« wesentlich bei. Dass dieses als Quintessenz ungereimt für sich bleibt, ist kein Zufall – umso weniger, als andererseits die Leichtigkeit des Schlusses mit »schöne« befördert wird, weil »gewöhne« als Reimwort von fern aus der fünften Zeile herüberwinkt.
· · · · ·
|26|Musik in den Ohren der Sterbenden –
Musik in den Ohren der Sterbenden –
Wenn die Wirbeltrommel der Erde
leise nachgewitternd auszieht –
wenn die singende Sehnsucht der fliegenden Sonnen,
die Geheimnisse deutungsloser Planeten
und die Wanderstimme des Mondes nach dem Tod
in die Ohren der Sterbenden fließen,
Melodienkrüge füllend im abgezehrten Staub.
Staub, der offen steht zur seligen Begegnung,
Staub, der sein Wesen auffahren läßt,
Wesen, das sich einmischt in die Rede
der Engel und Liebenden –
und vielleicht schon eine dunkle Sonne
neu entzünden hilft –
denn alles stirbt sich gleich:
Stern und Apfelbaum
und nach Mitternacht
reden nur Geschwister –
In der Nähe von Sterbenden oder eben Gestorbenen leise zu reden mahnt jede Krankenschwester, nicht nur aus Pietät. Woher kommen Ahnung oder Wissen, dass jene uns noch hören, der Hörsinn zuletzt stirbt? Bei Nelly Sachs zieht »die Wirbeltrommel der Erde leise nachgewitternd aus«, nicht »ab«, war also nicht nur um die Sterbenden, sondern in ihnen; und sie geht wie selbstverständlich in die Musik der Sterne über, »harmonia caelestis« im Sinne der Alten. Die fließt »nach dem Tod in die Ohren der Sterbenden« – gegen den Einwand, Sterbende seien noch nicht tot.
»Nach dem Tod« hätte Nelly Sachs weglassen können; strikte Trennung von Hier und Drüben indes, das »Messer zwischen Leben und Tod« duldet sie nicht. Die Rede von »dunklen Sonnen« macht deutlich, dass »Israels Leib … aufgelöst in Rauch« auch ins Jenseits hineinweht; andererseits zweifelt sie selbst beim ermordeten Bräutigam nicht daran, dass »diese Erde keinen ungeliebt von hinnen gehen läßt«, dass der Tod uns in »die göttlich entzündete Geometrie des Weltalls« hinübergeleitet. |27| Wie sehr begreift sie Musik als Teil des anderen Lebens, gar als dieses selbst? Drüben, »nach Mitternacht«, sind alle Gestorbenen, ist alles Gestorbene füreinander »Geschwister«. Muss man den Gedankenstrich am Ende der letzten Zeile als hinter diese Gewissheit schüchtern gesetztes Fragezeichen lesen?
Jener Glaube wäre zynisch verkleinert, sähe man in ihm vornehmlich die Trostzuflucht einer Frau, die nie verwunden hat, den Schrecken des Judenmords entgangen zu sein, nie weitab war von den Konsequenzen derer, die es nicht ertrugen: Tadeusz Borowski, Jean Améry, Primo Levi, Paul Celan, Peter Szondi. Fast alle Angehörigen hat sie in den Vernichtungslagern verloren und 1961 um Gnade für Eichmann gebeten. »Melodienkrüge« füllen sich ihr sogar im »abgezehrten Staub«.
Damit prallt sie im Blick auf »selige Begegnung« auf ein Schlüsselwort. »Staub, Rauch, Asche sind … immer gegenwärtig« (Enzensberger); Staub kann sich seligen Begegnungen öffnen und »sein Wesen auffahren« lassen. »Unser Gestirn ist vergraben in Staub«, heißt es in einem anderen Gedicht; dennoch weiß sie den Stern der Erlösung leuchten. »Es gibt und gab und ist mit jedem Atemzug in mir der Glaube an die Durchschmerzung, an die Durchseelung des Staubes als eine Tätigkeit wozu wir angetreten«, schreibt sie am 9. Januar 1958 an Celan; »ich glaube an ein unsichtbares Universum, darin wir unser dunkel Vollbrachtes einzeichnen. Ich spüre die Energie des Lichts, die den Stein in Musik aufbrechen läßt.« In ihrem bekanntesten Gedicht wird »Israels Leib … aufgelöst in Rauch« von einem Stern empfangen, »der schwarz wurde«. »Oder war es ein Sonnenstrahl?«, fragt sie dennoch.
Fliegender, sehnsüchtig singender Sonnen, geheimnisvoller Planeten, der Wanderstimme des Mondes ist sie so sicher, dass ihre Rede sich von deren Schwingungen anstecken lässt, wie in einem Exordium vorbereitet schon im ersten Vers: »Musík in den Óhren der Stérbenden«. Danach klingt »die síngende Séhnsucht der flíegenden Sónnen« wie eine jubelnde Steigerung, als bedürften die Worte beflügelnder Vorstellungen, um daktylisch abzuheben – »Musik«, die gegen das Gewicht und die Kontur der Worte bzw. Bilder immer neu hergestellt werden muss. Bei »in die Óhren der Stérbenden flíeßen« hat der Daktylus nochmals freie Bahn.
|28| »Staub« verändert Ton, Sprechweise und Syntax. Vor der letzten Zeile der ersten Strophe stand in sieben Zeilen ein unvollständiger Satz, ein wie ungeduldig von einer Jenseitsvorstellung zur nächsten forteilendes Sprechen. Nun, da das beladene Wort gefallen ist, wird es wiederholt, als müsse das Gedicht sich seiner und seines Bedeutungsumkreises versichern. So kommt es, dreimal an »Staub …, Staub …, Wesen« anschließend, zu kleinteilig zerpflückter, wie überstürzt gesprochener Syntax. Nachdem schon die erste Strophe dringlich deklamiert erschien, mutet die zweite atemlos an, aufgefangen endlich im weit ausschwingenden »eínmischt in die Réde der Éngel und Líebenden«, sodann abgebremst im trochäischen »únd vielleícht schon eíne dúnkle Sónne néu entzünden hílft«.
Dies liegt im Vorfeld der großen Kadenz, einer Doxologie, des feierlich zelebrierten Schlusschorals, nun weitab von metrischen Beunruhigungen. Dem in diesem Gedicht einzig vollständigen Satz und dem Gleichschritt der vier Zeilen fügt sich, zusammengezogen aus »es stirbt sich« und »alle sterben gleich«, auch die erste:
(Denn) álles stírbt sich gleích:
Stérn und Ápfelbáum
únd nach Mítternácht
réden núr Geschwíster –
Der Eindruck getragener Feierlichkeit erklärt sich aus jenem inneren Tempo, das von der Dichte, dem Eigenprofil der Bilder und Begriffe ebenso bestimmt wird wie vom Metrum und von klanglichen Valeurs – etwa der »singenden Sehnsucht der Sonnen«. Am Ende hat das Gedicht sein Flussbett gefunden. Hier ganz und gar, wie überall in Dichtungen der Nelly Sachs, wird gebetet.