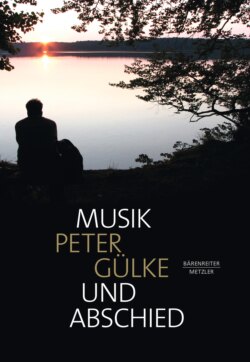Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Selbstgespräche I
ОглавлениеGibt es wirklich, was wir nie genau wissen werden: dass der Tod kurz vor Toresschluss, wenn die Schwelle niedrig und sein Sieg sicher ist, locker lässt und die Zuständigkeit über den letzten Schritt dem Betroffenen überlässt; dass sich entgegen aller zuvor verloren gegangenen Verfügungsgewalt eine letzte Enklave von Entscheidungsfreiheit auftut?
Ein Uralter, der etliche hohe Geburtstage hinter sich hat, den nächsten samt lästigen Aufmerksamkeiten vor sich weiß, auf die er nicht mehr reagieren mag, stirbt in der Nacht zuvor. Eine 60-Jährige liegt nach langer Quälerei mit Krebs und Krebstherapien endgültig darnieder, hält die bedrückten Gesichter der Kinder nicht aus, erbittet den Besuch einer Verwandten, die es gelassener nehmen wird, redet eine Weile mit ihr, dreht sich zur Wand und stirbt.
Steckt in Wallensteins Worten auf den toten Max Piccolomini – »Er ist der Glückliche« – nicht auch Nekrolog auf sich selbst, hinter seiner Gleichgültigkeit gegenüber den Warnzeichen Einverständnis mit dem, was da kommt? |45| Könnte Robert Walser nicht – Umnachtung hin und her – im Schnee am 25. Dezember 1956 der Gedanke überfallen haben, dass es jetzt genau so sei, wie er es fast 40 Jahre zuvor in der »Weihnachtsgeschichte« beschrieben hatte? »In all der Lautlosigkeit leuchteten Lichter. Es war mir, als könne es jetzt nur schöne Heimstätten und liebe Leute und allerlei frohen Mut und freundliche Reden und ein unsägliches Wohlsein auf der Welt geben«.
Spezialisten für Nahtoderfahrungen mögen die Frage töricht finden. Ihr »Natürlich ist’s so« interessiert mich nicht, mögen die Belege sich noch so sehr häufen. Im Anrennen steckt mehr Wahrheit als in soliden Bestätigungen. So frage ich immer wieder: Wird da ein letzter Willensakt gewährt, eine Freiheit, zu der auch gehört, dass selbst die Nächsten zurückbleiben, weil sie auf den letzten Stationen mehr stören als Pfleger und Krankenschwestern? Vielleicht ist es in jener Morgenstunde so gewesen; vielleicht wollte sie nicht, dass die Allernächste, ihre Tochter, die sie unterwegs wusste, sie ablenken, sterben sehen würde. Das gelang, sie starb rechtzeitig.
· · · · ·
Fleischbeschau: Sie liegt auf der Intensivstation, an Apparate angeschlossen, ein Arm mit Kanülen bestückt, der andere bandagiert, weil sie aus dem Bett gefallen, das Schlüsselbein gebrochen war und ruhiggestellt werden musste. Ich sitze bei ihr, halte ihre Hand und suche im halb abwesenden Gesicht nach Hoffnungszeichen. Laut und leutselig rauscht der Chefarzt mitsamt Gefolge herein, will Leben in die Bude bringen; Zeit zur Begrüßung von Kranken oder Angehörigen nimmt er sich nicht, tritt ans Bett und stößt an mich, ohne zu reagieren. Kein Blick ins Gesicht der Kranken – es geht um die Krankheit und darum, sie dem Gefolge vorzuführen. Er hebt die Bettdecke, zeigt auf den nackten, gedunsenen Leib, diktiert geschäftig ein paar Worte und ist aus dem Zimmer heraus, ehe ich, halb betäubt, begreife, was geschehen ist. Wo blieb, was so leicht fiele – Zuwendung, Zuspruch?
Wie hilfreich dagegen die durch kein Dankeswort abgeltbare Fürsorge anderer – Schwestern, Pfleger, Ärzte! Sind elementare Ausübungen von Humanität überflüssig, wenn zielgenaue Therapien den Kranken auf den Inhaber eines segmenthaft angepeilten Defizits reduzieren; kann ein Mensch überhaupt an nur einer Stelle krank sein?
· · · · ·
|46| »Tristesse commerciale« gibt’s auch, neben geschäftsfördernden Verbindlichkeiten, die in Frankreich »sourire commercial« heißen. Die Frau in der Bestattungsfirma redet leise, als sei ich krank und sie die Betroffene. Eine Woche später überbietet sie der Angestellte, der die Urne pathetisch hocherhoben wie eine Monstranz zum Grab trägt. Ich erwische mich bei der Vorstellung, in dem rotglänzenden Töpfchen würde jemand leise vor sich hin kichern.
Abstand zwischen eigener Trauer und Ritualen lässt sich nie vermeiden. Zudem hilft das »con sordino« des Umgangs, weil ich noch für den Anschein von Einfühlung empfänglich bin. Im Krankenhaus auf der anderen Straßenseite liegt die Tote, kaum erkaltet, und mich beschäftigen Kremation, Holzsorten, Sargbeschläge, Blumenbuketts. Schlimm genug, dass von Geld die Rede sein muss, das Berechnen der einzelnen Posten ist entsetzlich. »Einfach, so einfach wie möglich«, höre ich mich sagen, denke daran, dass sie möglichst wenig Aufhebens gewünscht hatte, und bin sicher, dass die Dame es anders versteht: Er will’s billig. Die Aufrechnung ergibt eine Summe, über die zu wundern ich mir verbiete.
Bei der Trauerfeier steht auf einem malerisch gerafften Teppich, von einer Blumenpyramide überwölbt ein Sarg in Hochglanzpolitur. Mit der, die drinliegt, hat das nichts zu tun – vergraben, ehe sie begraben ist; als wolle man mit der Leiche den Tod überhaupt beiseiteschaffen. Damit haben wir’s inzwischen weit gebracht, erledigen Tötungen über Kontinente hinweg per Knopfdruck.
· · · · ·
Wo bist du? Die Frage widerlegt sich selbst, die Worte greifen ins Leere. »Wo« unterstellt einen Ort, an dem sie sich aufhält. Bei »bist« kann man nicht seinsvergessen genug sein, um es als sinnfreie Kopula zu verstehen; können Tote auf irgendeine Weise noch »sein«? »Du« setzt voraus, dass es etwas als »du« Ansprechbares gäbe.
Ein Freund hat den Nächsten während seines qualvollen Sterbens das paradoxe Beieinander von Nichtsein und Zeitlichkeit heiter zusprechen wollen: »Würzt mir am Grab mit der Fröhlichkeit glücklichen Seins meine Tage, / denn ich verbringe doch hier nur mit Nichtsein die Zeit« (Eberhard Schmidt).
· · · · ·
|47| Du öffnest die Haustür, Stille dröhnt dir entgegen, als hätte alles sich zur Verweigerung verschworen, hätte alle Hinweise auf Gebrauch, Umgang und Leben in Fragezeichen und Drohgebärden verwandelt. Wie es jenseits von absoluter Leere schwarze Löcher, Anti-Materie, ein Noch-mehr-als-Nichts gibt, so hinter der Stille Anti-Lärm, unerträglich schrilles Schweigen.
· · · · ·
Die Uhr sei abgelaufen, sagten Ärzte, nicht nur sie, und meinten Trost zu spenden: da das Ende, weil notwendig, von ihr gar gewollt, doch auch Sinn gehabt habe. Welcher Betroffene aber will es sinnvoll finden, will getröstet sein? Selbst technisch verlängertes Verdämmern macht es schwer. Auch hätte vieles im Gestorbenen noch leben können, wurde nur mitgerissen. Noch der bestgemeinte Trost erscheint abstrakt, hängt zu hoch über dem Geschehenen. Den Nächsten nämlich erlebt man als beweglichsten; zu dieser Beweglichkeit gehört das »ad infinitum« so sehr, dass der Bescheid der abgelaufenen Uhr anmaßend erscheint, sei er diagnostisch noch so gut fundiert. Der Tod ist groß, dunkel und allemal plötzlich; mit Begründungen sollten wir ihm nicht nachrennen.
· · · · ·
»Die Luft ist still, als atmete man kaum.« »Die Blätter fallen, fallen wie von weit.« Die schönsten Gedichte hätten zu verdeutlichen nicht ausgereicht, wie wir es in den Tagen zwischen Tod und Trauerfeier wahrgenommen haben: herumgelaufen in einem sonnigen, golden prunkenden Herbst, der alle Preislieder beschämte. Windstille, in der die Blätter gemächlich, jedes anders gefärbt, jedes anders schaukelnd, in je anderen Kurven heruntertrudelten. »O stört sie nicht, die Feier der Natur!« Dann brach jäh November ein, wenig später deckte der erste Schnee das Grab. Das war, soweit man so reden darf, richtig.
· · · · ·
»Ein helles Haus, und eine liebe Seele drin«: das Licht im Wohnzimmer, wenn er nach Hause kam; das Gesicht hinter der Fensterscheibe, wenn er das Fahrrad draußen vorbeischob; die vorweg geöffnete Tür – vorbei. Nicht nur sie ist gegangen. Jetzt erfährt er, wie sehr alles, heideggersch gesprochen, |48| nicht nur vorhanden, sondern zuhanden gewesen ist – das Knarren der Dielen redet von ihren Tritten; Kochlöffel reden von der Hand, die sie führte; Bücher von der, die sie las; der Schreibtisch davon, dass sie dort saß und schrieb; Musik von der, die sie hörte.
Zuweilen, wenn der Erinnerung keine Spur genügen will, löscht er die Lichter und wartet auf das im Dunkel heranschleichende Geflüster, darauf, dass die Tote aus dem Totsein heraustreten werde. Doch wird ihm nur Bescheid, dass sie das wichtigste Zuhause mitgenommen hat, wie alles auf sie bezogen war. Muss man es nun von jeglicher Alltäglichkeit, jeder Türklinke, jedem Einkaufsgang abkratzen? Leben heißt Bezogensein; je weniger man bezogen ist, desto weniger lebt man.
· · · · ·
Man wird empfindlich – ad exemplum: »Am 4. März stirbt Franz Marc. Er fällt während eines Erkundungsritts in der Nähe des Dorfes Braquis bei Verdun. Doch durch seinen Glauben an eine neue Wirklichkeit hat er den Tod längst überwunden.« So weiß es die Verfasserin eines Katalogs. Ein bisschen Transzendenz, schon haben wir’s! Und brauchen nicht mehr schlimm zu finden, dass einer erschossen wurde. Er hat’s ja vorher schon überwunden. Als ob es die »neue Wirklichkeit« leicht gemacht hätte, er es ihr schuldig gewesen sei, sich abknallen zu lassen.
Wohl gibt es staunenswerte, schreckenerregende Formen von Todesbereitschaft, Fanatismen und Konstellationen, die sie erzwingen, zumindest begünstigen. Sofern es nicht um rituelle Bewusstmachungen oder Verheißungen geht – altägyptische, christliche, buddhistische, islamische –, dürfen wir sie aus der Distanz Lebender nicht unterstellen. Allzu leicht hilft ein zur Transzendenz ausgelegter roter Teppich, Nöte, Schmerzen und Verzweiflungen beiseitezuschieben, nicht weitab von der Anmaßung, wir würden es gegebenenfalls hinkriegen. Wer weiß, wie Franz Marc zu Tode gekommen ist.
· · · · ·
Es beginnt beim Alltäglichen und endet weit draußen im verdunkelten Lebenshorizont: sie nicht mehr da, die man fragen, mit der man reden konnte. Auf der Mitte zwischen Anprall am Nicht-Begreifen und schlechtem Gewissen – »hätte ich doch noch …« – rumoren je nach Stimmungslage Verdacht |49| oder Gewissheit, dass die Kameradschaft, das Geschenk der Gemeinsamkeit zu selbstverständlich waren. Dagegen hilft die Einsicht wenig, dass zum Geschenk auch die Selbstverständlichkeit gehörte.
· · · · ·
Vordruck-Beileid glanzkaschiert: »In tiefster Anteilnahme« steht in Zierschrift auf dem blitzblanken Faltkärtchen, artig in diskretes Dunkelbraun nebst brennender Kerze gesetzt; innendrin eilig geschrieben »Ihre …«. Betroffene müssen nicht überempfindlich sein, um sich nicht ernst genommen zu fühlen: Vorgefertigtes beim persönlichsten Anlass. »Wenn es keine Worte mehr gibt, kommen die Klischees. Das fühlt sich schrecklich an. Als würde dir jemand ein Eisenhemd überziehen« (David Grossmann). Als Zeichen, das für mehr steht, kommt das Kärtchen zu prätentiös daher, eher sagt es, der Trauerfall sei damit für »Ihre …« erledigt. »Tiefst« Anteil nehmen kann man aus der Ferne ebenso wenig, wie man nach einer Mahlzeit Hunger empfinden kann. Zu gestehen, man könne es nicht, würde mehr Anteilnahme verraten. Da aber fehlen unterschriftsreif aufbereitete Vordrucke.
Neuerdings geht’s noch leichter, ohne Kärtchen: mithilfe der »Beileids-App, die Tipps zum richtigen Kondolieren gibt. Insbesondere der jungen Generation kann die App helfen, richtig Beileid auszusprechen … Die App enthält einen Assistenten, der vorgefertigte Beileidsschreiben erstellt – angepasst jeweils an das Verhältnis zum Verstorbenen.« Jetzt fehlen noch vorgefertigte Sterbearten.
· · · · ·
Jetzt überrascht es mich, die Möglichkeit, dass sie sterben werde, in Notaten aus den letzten Monaten mehrmals angesprochen zu finden; die Erinnerung hat jene Zeit ins Licht der Hoffnung geschoben, alles könne wieder gut werden. Hoffnungen waren zumindest so weit im Recht, als man zwar den Tod, nicht aber den nächsten Menschen, solange er lebt, tot denken, beides zusammenbringen kann. So blieb der naheliegende Gedanke abstrakt – ein Menetekel im Blick auf das Konjunktivische, Freischwebende von vielem, was wir denken. Sie lebte ja! Das hat uns in Hoffnungen Eingesperrte für die aufs Ende deutenden Wirklichkeiten blind gemacht.
· · · · ·
|50| Unerreichbar, unbelangbar – vom letzten Morgen kommt die Erinnerung nicht los. Je mehr Zeit vergehe, so sagt man, desto eher löse sich die Obsession, nur der schlimmste Kummer schaffe Nähe, halte Rückwege offen. Vielleicht löst sie sich, weil niemand extreme Gemütslagen lange durchhält, immerfort die Geißel des schlechten Gewissens über sich schwingen kann, wenn er anderen Dingen zugewendet war, mit Freunden gelacht und erlebt hat, wie verschieden er sich geben und sein kann. Wie sehr war der, der hier sich in Arbeit versenkt, dort mit anderen lacht, derselbe, der danach in schwarze Löcher fiel? »Moi un autre.«
Immer mehr gerät das Bild, so sehr ich mich gegen die Ikone sträube, vor einen Goldgrund, tritt ins Licht von etwas, wofür »Majestät des Todes« als Charakteristik nicht zu groß gewählt erscheint. Das mag helfen, wogegen vieles sich wehrt: dies Leben nicht als jäh abgebrochen, wenn schon nicht vollendet, wenigstens als notwendig beendet zu begreifen. Vielleicht lässt sich irgendwann gelassener erinnern, dass gemeinsame Erlebnisse stets Vorausschau, einen Überschuss enthielten – das Versprechen, Ähnliches noch oft erleben zu können. Dass es Erlebnisse »im Hinblick auf …« nicht mehr geben wird, weil die Resonanzen beim anderen ein Teil von ihnen waren, mag irgendwann von der Vorstellung aufgefangen werden, es sei auf den Tod zugelaufen, er habe Sinn gehabt als Ende eines Weges, auf dem sie dem Leben mehr und mehr den Rücken zukehrte, wir sie nicht halten konnten. »Majestät des Todes« benennt zudem den schweigsamen Stolz derer, die »die Welt überwunden« haben, keine der nachgerufenen Beteuerungen mehr hören und denen voraus sind, deren Zurückbleiben ihnen gleichgültig wurde – das Tor des Todes ist zu groß. »Sie ruhen von ihrer Arbeit aus«: Auch das nehmen sie nicht mehr wahr.
· · · · ·
Wann hat die Reise begonnen, wann hat sie sie bewusst angetreten, sie bejaht? »Sie arbeitet nicht mit«, war die Auskunft einer Ärztin etliche Wochen, bevor wir spürten, dennoch nicht wahrhaben wollten, dass sie von der gemeinsamen Lebensbahn in eine eigene abzubiegen begann. Dass sie in den letzten Jahren oft sagte, sie habe genug gesehen, gehört, erlebt, dass der Lebenshunger mancher Altgewordenen sie abstieß, rückt sie nah heran an die, die (frei nach Horaz) »am Ende Abschied nehmen wie ein gesättigter Gast«. |51| Schon, als es nicht bedrohlich aussah, litt sie ausführliche Krankenbesuche selten, schickte uns weg und zog sich in sich selbst zurück, als müsse sie die Reise vorbereiten, sich auf das heranfahrende dunkle Tor konzentrieren.
Wir wehrten uns gegen die Vorstellung, sie brauche uns nicht mehr. Wer weiß, wie früh der Kanal verengt, die Strömung unwiderstehlich geworden war, sie ihr sich ergeben hatte – wir zurückgeblieben, von törichter Hilflosigkeit veranlasst, einem schwer begreiflichen Eigensinn Sterbender nachzuhängen.
· · · · ·
Manches, was sie sagte, wie sie es erlebte und reflektierte, erklärt sich jetzt leichter. War der stille, zunehmend einverstandene Abschied schon in jener rätselhaften, hinter aller Courage liegenden Zaghaftigkeit enthalten, mit der sie ins Leben und seine Unvorhersehbarkeiten hinaustrat? Gibt es verschiedene Grade, in der Wirklichkeit anzukommen?
Die Toten fügen sich den Launen unserer Erinnerung, können den leichter gewordenen Erklärungen nicht widersprechen, nicht sich wehren, uns nicht mehr ärgern. Irgendwann vor ikonenhafte Goldgründe geratend, rücken sie tiefer ins Totsein hinein. Sub specie finis wollen Erinnerungen ein konsistentes Bild zusammenfügen. Vordem war alles vorläufig, korrigierbar; angesichts der beim Nächsten stärker als anderswo empfundenen Unerklärbarkeit galt das offenhaltende Einstweilen. Das »nihil nisi bene« jedoch leidet keine Beunruhigungen; Bewahren liegt nahe bei Verklären, und dies, vorzugsweise an freundlichen Erinnerungen sich wärmen, heißt auch Wegschieben.
· · · · ·
In den ironischen Übertreibungen, mit denen sie Malaisen beschrieb, lieferte sie heitere Zurücknahmen mit, Einladungen zu »ganz so schlimm wird’s nicht sein«: depressive Dunkelheiten nicht ganz so dunkel, Blockierungen nicht ganz so quälend. Sie wollte nicht zur Last fallen, wir brauchten Hoffnungszeichen – beides zusammen begünstigte Illusionen von Spielräumen, die es nicht gab. Jetzt wissen wir’s und sind verdächtig, ihre Nöte nicht ernst genommen zu haben.
· · · · ·
|52| Wie schön, wie tröstlich die Vorstellung, die Toten blickten von oben auf uns herab! Brauchen wir die Seele – die es schon irgendwie gibt, irgendwie! – nicht auch, um etwas zu haben, das sich mit Unsterblichkeit zusammendenken lässt, uns aber positive Beweise erspart? Brauchen wir Himmel und Ewigkeit nicht schon, weil Denken stets über Gegebenes hinausdenken heißt, der Tod dies aber verbietet; weil uns Barrieren unerträglich sind, über die wir nicht hinausblicken können? Schreibt, malt und komponiert man sich ans Jenseits nicht auch in Metaphern heran, weil man es direkt hindenkend nicht erreicht? War der an der »Missa solemnis« arbeitende Beethoven vielleicht gläubiger als der mit »Fidelio« beschäftigte, hat Heines Ärger am zu Kreuze kriechenden Mendelssohn nicht damit zu tun, dass er für die religiöse Prädisposition von Musik keinen Sinn hatte? Hat Dante sein Jenseits auch realistisch bevölkert, um sich Anhalte zu schaffen? Immerhin war das von einem Heiden als Fremdenführer betreute Sightseeing auch eine Anmaßung.
»Wenn man den Himmel leerfegt«, schreibt ein Gehirnforscher, »dann nimmt natürlich das Gefühl der Geworfenheit stark zu. Ich sehe bloß nicht, warum das zu einem Angriff auf die Menschenwürde umgemünzt werden muß. Ich denke, daß nichts würdiger wäre, als diese Erkenntnis auszuhalten. Das Leben und das bißchen Glück, das wir haben, würde uns als das Kostbarste erscheinen, das wir besitzen, und wir würden es höher achten als bisher.« Ein Himmel ist unter anderem eine Entlastung, die Sehnsucht danach bereits Religion. Wir brauchen etwas über uns. »Chaque dogme en particulier m’est répulsif, mais je considère le sentiment qui les a inventés comme le plus naturel et le plus poétique de l’humanité«, schrieb Gustave Flaubert im März 1857 an Mademoiselle Leroyer de Chantepie (Jedes Dogma für sich stößt mich ab, aber ich betrachte das Gefühl, aus dem heraus sie geschaffen wurden, als das natürlichste und poetischste der Menschen). Wir müssen ein eigentliches Leben nicht gleich drüben vermuten und das Diesseits unter den theologisch-platonischen Scheffel stellen, als Jammertal, wo »wir als Sterbliche Zombies sind, lebende Tote, die in der eigenen Leiche herumlaufen mit dem gräßlichen Anspruch, am Leben zu sein« (Sloterdijk).
· · · · ·
Vergangenes Leben immer mehr, erwartbares immer weniger – die Verschiebung arbeitet von Geburt an. Spielt sie im Untergrund unserer |53| Befindlichkeiten mit, bevor wir über sie nachdenken? An der Bezauberung durch Kindergesichter hat auch der Neid teil, dass die Kleinen hiervon nichts wissen. Und an der Autorität der Alten haben Erfahrungshintergründe teil, in die nur sie hineinblicken, aus denen sie leben, die sie noch im Alltäglichen ausspielen – unfair spätestens, wenn sie sich legitimatorisch gebärden: »Was wisst ihr schon!« Wen der Tod des Nächsten auf Erinnerungen zurückwirft, dem wird die Verschiebung zur Last. Nun geht es nicht mehr nur um Quantitäten, zählbare Jahre, sondern um spezifische Gewichte. Von Stund an wiegt das gehabte Leben schwerer, bindet und prägt sein Fühlen und Denken stärker, von Stund an ist er älter.