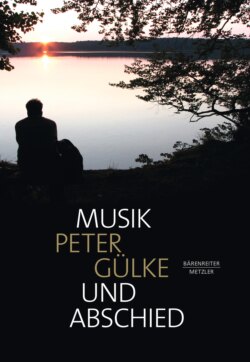Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеVox humana – Totenrede auf Dietrich Fischer-Dieskau Worte passen in diese Stunde nicht. Nur »Musik und des Verewigten Wort« hatte Thomas Mann bei der Trauerfeier für Gerhart Hauptmann gewünscht. Wie nun gar, wenn des Verewigten Wort größtenteils Musik war, bis in die letzte Körperfaser hinein gelebte Musik? Da müsste doch er reden – in der Glaubensfestigkeit des »Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden«, oder mit dem unsagbar innigen Schlummerlied für Magelone: »Schlafe, schlaf ein, … ich will dein Wächter sein.« Das holt kein Wort ein, wie immer Worte die Gemeinsamkeit des Gedenkens artikulieren mögen. Denn jeder hat ein Recht auf die eigene Art des Gedenkens, auch das Recht, auf eigene Weise untröstlich zu sein. Nachrufe werden auch durch die Hilflosigkeit beglaubigt, mit der sie nach-rufen, hinterherrufen.
|36| Vor drei Wochen konnten Worte am Sarg wenigstens den Abstand verringern zwischen jener persönlichsten, gegen alle Umwege allergischen Trauer und den normativen Ritualen von Tod und Begräbnis. Dennoch entkam ich dem Hader mit jenem Abstand nicht, als der Sarg grässlich präzise in die Erde hinabfuhr und die Vorstellung sich aufdrängte, irgendwo oben, vermutlich im Paradies, Abteilung Musik, würde, angeführt von Schubert, Schumann, Brahms und Mahler, ein Empfangskomitee an der Pforte stehen und ihn willkommen heißen: »Hier gibt’s genug Engelsgezirp und amtlichen Palestrina; nun, Dieter, singe Du!«
In dieser Stunde interessiert mich nicht, dass manchem die Rede vom Recht, untröstlich zu sein, überzogen erscheint. Man könnte meinen, der Einschlag des Todes sei durch 87 Lebensjahre und die Legende abgefangen, die Dietrich Fischer-Dieskau der Anwesenheit eines Mitlebenden längst enthoben hat. Sie hat es nicht. Nicht nur Nahestehende, die von den Nöten der letzten Jahre und Monate wussten, traf die Nachricht unvermittelt hart. Es gibt Tode, auf die man entgegen aller Wahrscheinlichkeit nicht vorbereitet ist, hier zudem, weil jene Legende von einer Art ist, die keine geminderte Gegenwart verträgt. Wer Fischer-Dieskau singen hört, kann sich dem Auf-Du-und-Du, dem Eindruck nahezu physischer Anwesenheit kaum entziehen.
Gewiss spielt hier das Privileg der emotional direkt redenden Musik mit – »das Ohr ist der Seele am nächsten« (Herder). Große Interpreten wischen ohnehin jene Historizität beiseite, deren Maßgaben zu sagen erlauben würden, Bach könne man heute nicht mehr singen wie Fischer-Dieskau um 1950 bei Karl Ristenpart. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass wir von dort so weit entfernt sind wie damals er von den Sängern, mit denen Mahler in Wien zu tun hatte.
Dies könnte wie Abwehr der langen Schatten anmuten, die Fischer-Dieskau über ein Terrain wirft, in dem schon die zweite Generation nach ihm zu Hause ist. Sie hat es nicht leicht – und profitiert zugleich, im Blick auf eine schwindelnd hoch liegende Messlatte, unter anderem davon, dass Liederabende mit anspruchsvollen Programmen erst durch ihn selbstverständlich geworden sind. Wer hätte zuvor gewagt, Schumanns Kerner- oder Brahms’ »Magelone-Lieder« als Zyklen zu begreifen und öffentlich zu präsentieren?
|37| Auch andere Kontexte waren im Spiel – die Stunde Null der deutschen Katastrophe, wonach vieles, was deutsch hieß, neu legitimiert werden musste. Ihr und den folgenden Jahren wurde in dem jungen Sänger ein Herold geschenkt, dem von der jüngsten Vergangenheit nichts anhing. Wie fragwürdig die Unterscheidung eines »bösen« vom »guten« Deutschland immer bleiben mag, bei ihm fand sie Anhalt. Manche Nachkriegserfolge Daheimgebliebener waren den Emigranten zu Recht ärgerlich – bei ihm war es anders, er durfte die Herzkammern deutsch-romantischer Innerlichkeit den Landsleuten und den Kriegsgegnern von gestern unbefangen aufschließen. Die politische Relevanz dieser deutschen »vox humana«, des erklärtermaßen apolitischen Missionars war enorm, einem englischen Biografen galt er als »Inbegriff deutscher Kultur«.
So präzise der kometenhafte Aufstieg in die Szenerie der Nachkriegszeit gebettet war, so bald – mit zunehmenden Jahren immer mehr – sah Fischer-Dieskau sich als verspäteten Propheten einer heiligen, auf letzten Ernst vereidigten Kunst, trotz dröhnender Erfolge unsicher, ob man die Botschaft so verstehen werde, wie er sie meinte. Was seit etwa 20 Jahren auf den Bühnen grassiert, war für ihn der pure Horror, seit Langem schon hat man ihn, der in mehr als 60 Rollen geglänzt hatte, im Publikum nicht mehr gesehen.
Dies unter altersbedingter Konservativität abzubuchen, wäre billig. Vielmehr sprach ein Abstand mit, der aus angestrengter Selbstbewahrung herrührte und am ehesten bei gemeinsamer Arbeit oder im kleinen Kreis vertrauter Menschen dahinschwand. Kein dermaßen existenziell verfasstes Kunstverständnis kommt ohne Abgrenzung aus, je höher einer steigt, desto einsamer ist er. Noch in privateste Lebensbereiche hat Fischer-Dieskau seine mönchische, vom Alltag abgeschottete Arbeitsklausur hineingeschnitten, die in manchen Formen von Lebensfremdheit an Thales, den bei der Betrachtung des Himmels versehentlich in den Brunnen stürzenden Philosophen, erinnert, in der rücksichtslosen Fixierung auf ein einzig und allein Wichtiges an E. T. A. Hoffmanns Cardillac.
Sonderbare Unschuld desjenigen, der an sich höchste Ansprüche stellt und erstaunt ist, wenn andere das nicht begreifen, nicht tun, nicht können! Mancher, der sich beim Musizieren in innige Kommunikation |38| eingebunden fand, hat erleben müssen, dass es sie darüber hinaus kaum gab; Jubelfeiern nach Konzerten oder Premieren sind seine Sache nie gewesen. Immerhin haben ihn viele, wie Brigitte Fassbaender, auch als »sehr normalen Menschen, … herzlichen und lustigen Kollegen« erlebt; »er hat herrlich lachen können.« Ihre Kollegin Marjana Lipovšek, danach gefragt, wie man im Münchner Ensemble zurechtgekommen sei, benannte die Sache schlagend: »Ganz einfach: Wir haben ihn angehimmelt, und er fand es selbstverständlich.«
Wie auch nicht, da er, wo immer er auftrat, im Mittelpunkt stand und Sturzbächen rühmender Superlative ausgesetzt war: ein »Gott, dem alles geschenkt wurde« (Elisabeth Schwarzkopf), »der größte Sänger des Jahrhunderts« (Leonard Bernstein), »der größte Musiker, der mir begegnet ist« (Swjatoslaw Richter). Man sollte meinen, sein Rang hätte ihn von Lob und Tadel unabhängig gemacht – weit gefehlt! In übergroßen Empfindlichkeiten verriet sich die Anspannung, unter der er stand.
Abgesehen davon, dass Urteile Außenstehender diejenigen kalt erwischen, die aus der Hitze des Vollzugs kommen und wissen, dass sie gegeben haben, was hier und heute irgend möglich war, ärgerte Fischer-Dieskau die Profilierungssucht derer, die sich an ihm schadlos hielten. Wenn der Anspruch, der schärfste Kritiker seiner selbst zu sein, von mittleren Geistern angefochten wird, reagiert man allergisch, besonders, wenn sie eigene Unsicherheiten bestätigen. Wer außer ihnen selbst ermisst schon, wie sehr Musizierende mit jeder Aufführung von vorn beginnen, mit dem Werk sich selbst riskieren? Das sollte angesichts der minutiös durchgeformten Hochämter seiner Konzerte nicht vergessen werden.
Kein anderer Sänger hat weit über 40 Jahre höchste Ansprüche vertreten und ihnen genügt, kein anderer ein so vielfältiges Repertoire vertreten, kein anderer hat derart umfangreichen Einsatz für neuere und neueste Musik neben dem klassisch-romantischen Repertoire gewagt und diesem so viel zurückgewonnen, keiner hat so viele Einspielungen hinterlassen. Ein vor zwölf Jahren erschienener Katalog zählt 190 Komponisten, 25 »Figaros«, 9 »Matthäuspassionen«, 14-mal Brahms’ »Deutsches Requiem«, 18-mal »Die schöne Magelone«, 23-mal die »Lieder eines fahrenden Gesellen«, 33-mal »Die Winterreise« – Belege nicht nur ungeheuren Widerhalls und der Geschäftstüchtigkeit von Dritten, sondern |39| auch einer kreativen, unverwandt auf Herausforderungen ausgehenden Neugier. Differenzen der Aufnahmen bezeugen das nicht weniger als Grenzgänge, seien es Partien wie Busonis Faust, Henzes Mittenhofer, Reimanns Lear, oder fachlich am Rande liegende, der »Rheingold«-Wotan und Sachs.
Er hätte es leichter haben können. Der lyrische Schmelz seines hohen Baritons, sehr bald in allen Registern sichergestellt und vertieft durch etwas, was man, um Charakterisierungen verlegen, »tönende Humanität« nennen könnte, hätte anderen allemal ausgereicht, mindestens zu dem, was er als »Belkantisieren« bespöttelte. Ihm reichte es nicht. Da Elisabeth Schwarzkopf ihn den nannte, »dem alles geschenkt wurde«, hat sie hinzuzufügen vergessen, dass er selbst sich nichts geschenkt hat. Zu so sicherer Beherrschung von tausenden Liedstrophen, zu solcher Reichweite, solch subtiler Kontrolle des Atems gelangt man nicht ohne konsequentes, hartes Training. Wenn irgendeiner seine Begabung als Auftrag und Verpflichtung begriff, dann er; wenn irgendwo bei einem Sänger Genie auch Fleiß war, dann bei ihm, noch in der Arbeit am Anschein, dass dies, als »frei von den Göttern« herabkommend, nicht so sei.
Deshalb gefiel es ihm nicht, wenn Kollegen von Pingeligkeiten auf szenischen Proben berichteten; Regisseuren und Dirigenten, die es nicht genau nahmen, rechnete er die Spielräume keineswegs positiv an, die hierbei offenblieben, Schluderei war ihm ein Gräuel. Er wollte es genau wissen und konnte, in der Recherche de l’absolu auf Kameradschaft angewiesen, verletzbar und wehrlos erscheinen. Bei Schostakowitschs Vierzehnter Sinfonie habe ich es vom Pult aus erlebt: Noch bei der kleinsten Unregelmäßigkeit zuckte er zusammen.
Der Ärger über jene Berichte hatte allerdings, besonders den Liedgesang betreffend, ernstere Gründe: In der Arbeit noch an kleinsten Nuancen stellte Fischer-Dieskau mit seinen Mitstreitern eine Einmütigkeit her, die am Ende, oberhalb aller Vorfestlegung, durchaus ungeplante Freiheiten ermöglichte. Im Konzert, das wissen die Klavierbegleiter am besten, konnte es plötzlich anders ausfallen als zuvor erarbeitet – und hätte dennoch ohne die Vorarbeit nicht anders sein können! So blieben die Konzertabende sternenweit entfernt von Blaupausen vorangegangener Aufführungen oder Einspielungen – hundertmal Gesungenes jeweils |40| hier und jetzt neu wahrgenommen, neu erlebt, fundamental unwiederholt, immer auf dem Wege zu Valérys »possible à chaque instant«, einem »So und nicht anders«, worin aufgehoben bleibt, dass es auch anders hätte sein können.
»Sie sind ja gar kein Sänger, Sie sind ja ’n Barde«: Hindemiths Kompliment liegt nahe beim oft bemühten Orpheus-Vergleich, ist mehr als blumige Metapher, weil der Singende stärker als jeder andere der Musik schutzlos gegenübertritt: Kein vermittelndes, objektivierendes Instrument schiebt sich zwischen ihn und sie, er selbst, sein Körper, ist das Instrument; auch bei rein technischem Training bleibt er an intimste Befindlichkeiten gekettet. Überdeutlich dank totaler Instrumentalisierung seiner selbst sang nie nur Fischer-Dieskaus Stimme, sondern – Kopf, Herz und Physis zum Ton hin fokussierend – stets der ganze Mann.
Dunkle Stunden des Altgewordenen erklärten sich großenteils daher, dass er von jenem »zweiten Stoffwechsel« zunehmend abgeschnitten war, als welcher Musik die Körperlichkeit des Singenden bis in die letzte Faser durchströmt. Eben dies hatte den epiphanienhaften Beglaubigungen zugrunde gelegen, dank derer Wort und Ton wie endgültig wiedervereinigt anmuten und der Traum von der Ursprache sich momentweise zu erfüllen scheint. Wer könnte das je vergessen: das lösende, todtraurige Dur bei »Will dich im Traum nicht stören«; die bebend verhaltene Andacht, die in Eichendorff-Schumanns »Mondnacht« den schwebenden Konjunktiv von Worten und Tönen aufnimmt (»Es war, als hätt’ der Himmel …«); die Quintessenz aller Innigkeit im »Schlafe, schlaf ein« der »Magelone«, das verschämte Schwelgen in Vorstellungen eines schönen Todes bei »Sterb ich, so hüllt in Blumen meine Glieder« oder »O sieh, wie eine Silberbarke schwebt der Mond« im »Lied von der Erde« – schon der Sextaufschlag und der Wechsel von »o« zu »i« (»O sieh«) blicken zum Nachthimmel auf. Konsonanten werden intentional aufgeladen – im zögernden »sch« von »Schönheit« steckt die scheue Annäherung (»er schuf die Schönheit und dein Angesicht«), schon das gehauchte »h« – »Heil sei dem Freudenlicht der Welt« im ersten der »Kindertotenlieder« – enthält, wie schwer es dem verwaisten Vater wird, das Freudenlicht der Welt freudig zu begrüßen. Der tief reflektierte Ernst und die Noblesse seiner Kunst bleiben sängerischen Verführungen nichts schuldig, ohne ihnen |41| zu verfallen; nicht ein Schatten von Salon oder Schmachtfetzen bleibt bei Strauss’ »Traum durch die Dämmerung«, und die dreiste Schmissigkeit von »Auf, hebe die funkelnde Schale« erscheint zugleich schwunghaft wahrgenommen wie durch die aufgehellte Stimme distanzierend überhöht – der Liedsänger in einer Rolle.
Auf der Bühne hat es sich bruchlos fortgesetzt, der Opernsänger verdankt dem Liedsänger so viel wie dieser jenem. Der »vecchio filosofo« der »Così« bleibt in umfassenderem als dem gängigen Sinn Philosoph, weniger ein Zyniker auf der Linie der »Liaisons dangereuses« als lebenskundiger Skeptiker, der gegen Ende erschrocken wahrnimmt, wohin das leichtfertig verabredete Spiel treibt. Die Plänkelei mit Evchen im zweiten »Meistersinger«-Akt wird, als Fragezeichen hinter Stolzings erwartbarem Triumph, zum humanen Angelpunkt, weil deutlich durchklingt, dass der Alte das Mädchen anders, klüger, treuer liebt als jener; weitab von der Emphase eines Wunschkonzertstücks tropfen die Worte »Wahn, Wahn, überall Wahn« aus einer resignativen Nachdenklichkeit, die zu vollständigen Sätzen erst noch hinfinden muss. Zwischen Wotans präpotentem »Vollendet das ewige Werk«, fadenscheinigen Gemeinheiten gegenüber Fricka und jämmerlicher Abhängigkeit von Loges List spannt Fischer-Dieskau eine Röntgenaufnahme des Platzhirschen im Götterhimmel unerhört suggestiv auf. Wenn sein Mathis das Malgerät einpackt, hängen darüber alle dunklen Wolken eines endgültigen Welt- und Selbstverzichts.
Welch eine Kunst des doppelten Bodens! Vielbewundert und nicht selten dem Verdacht ausgesetzt, der notorisch Reflektierende bedürfe etlicher Mühe, um wenigstens bei einer »zweiten« Naivität anzukommen. Nicht zufällig reagierte er hier allergisch; Komplimente ob reflexionsferner Momente – wunderbare Stimme, hinreißendes Spiel etc. – hörte der Sängerphilosoph, Verfasser etlicher Bücher und Freund von Akademikern lieber als solche zu subtiler Rhetorik oder intellektuellem Anspruch. Die auf pralle Naivität Fixierten übersahen gern, was er dem Abstand zwischen persönlicher Identität und Rollenprofil abgewann. Warum waren Falstaff und Schicchi so umwerfend heiter, beschwingt und komisch, ebenso der »Kontrabandiste«, »Hoffärtig seid Ihr, schönes Kind« oder »Geselle, woll’n wir uns in Kutten hüllen«? Nicht zuletzt, weil immer |42| viel Fischer-Dieskau enthalten blieb. Die Wahrnehmung jener Doppelung erbrachte Profile und Nuancen, die nicht aufscheinen, wo einer von vornherein auf der Rolle sitzt. Gewiss war der Abstand zu problembeladenen Charakteren wie Sachs Amfortas, Barak, Wozzeck, Cardillac, Mathis, Mittenhofer, Lear geringer. Ohnehin hat man es auf den Brettern mit substanzieller, zugleich leichtfüßiger Heiterkeit schwerer – und sollte im Übrigen bei Schiller über die besonderen Legitimationen des »Unnaiven« nachlesen.
Abstand und Überbrückung auch anderswo: Die letztgenannten Partien erreicht ein lyrischer Bariton nicht ohne Weiteres. Das ließ manchen Fachfixierten nach Passagen fahnden, in denen Überforderungen offenlägen, die Stimme pathetisch ausgezogenen Bögen oder massiv auffahrenden Orchestern nicht gewachsen wäre. Mit wenig Erfolg: Gängigen Kategorien war Fischer-Dieskau schon bald entwachsen, vornehmlich dank einer in erster Linie mental, erst danach physisch bedingten Tragfähigkeit der Stimme, die von der bis zum Äußersten präzisierten Intention, einer unerhörten »Kraft des Meinens« herrührt und von der Materialität der Phonstärken nahezu unabhängig erscheint: Keine Note nur gesungen, weil sie geschrieben steht; je »meinender« einer singt, desto besser hört man ihn. Allerdings – wer seine Ausbrüche als Gunther, Amfortas oder Mandryka gehört hat, braucht solche Erklärungen nicht.
Normalerweise unterscheiden wir in der Musik festgeschriebene Texte und die klingende Realität je neu und anders ausfallender Aufführungen. Allerdings wird die Unterscheidung unterlaufen, weil wir die Texte vor dem Hintergrund aktueller Erfahrungen unter wechselnden Vorzeichen lesen – nicht zu reden davon, dass Musiker eigene Interpretationen, ob sie wollen oder nicht, auch aus dem Verhältnis zu anderen Interpretationen bestimmen. Zu Rang und Eindringlichkeit großer Deutungen gehört, dass wir sie schon im Ohr haben, wenn wir den Textstand nur »als solchen« zur Kenntnis zu nehmen meinen: Sie haben sich dort eingegraben. Der Urtext eines Schubert-Liedes mag so »ur« wie irgend möglich, mag quellenkritisch noch so gut ausgeputzt sein – sobald wir mit ihm umzugehen, ihn nur zu lesen beginnen, kommt zwischen den Notenzeichen der Fischer-Dieskau zum Vorschein.
|43| Der Altgewordene hat das nicht wahrhaben wollen – auch in Abwehr einer Welt, die immer seltener nach ihm fragte, einer Abwehr mit Vorgeschichte: Einerseits war da die risikofreudige, durchaus avantgardistische Interpretation, die als solche dank seiner überlegenen Könnerschaft kaum wahrgenommen wurde; wobei Schubert, Schumann, Brahms etc. in Ives, Schönberg, Henze, Reimann, Ruzicka etc. enthalten blieben – und umgekehrt: Keiner hat sich zeitgenössischer Musik so ausführlich gewidmet, ohne spezialistisch zu werden. Das erscheint arg pauschal formuliert angesichts der naheliegenden Frage, ob einer Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Mahler etc. wie er singen konnte, ohne sich bei ihnen in der Herzmitte seiner musikalischen Welt zu befinden – sodass einerseits Bach, andererseits die Modernen zugeordnet, auf irgendeine Weise randständig erscheinen müssten. Wie immer auch Verantwortung gegenüber den Zeitgenossen und Freude an der Herausforderung mitgespielt haben mögen – die Frage prallt am Niveau der musikalischen Bewältigung und an der Suggestivität der persönlichen Beglaubigung ab, an dem, was oben »Kraft des Meinens« genannt wurde. Auch müsste man dagegenhalten, dass die Deutung romantischer Lieder in solcher Form erst im 20. Jahrhundert möglich war, vorab im allenthalben durchscheinenden Moment der Rettung eines gefährdeten Reservats. Fischer-Dieskau war ein Zeitgenosse der Moderne.
Ohne deren Ästhetik zu teilen! Hier hielt er eher an konservativen Positionen fest. Die Divergenz indes ergibt keinen Widerspruch, weil die Risiken des Musizierens des stabilisierenden Widerlagers bedurften. Eine Parallele findet sich beim »romantischen Dekonstruktivisten« Furtwängler; nicht zufällig sah dieser in dem 40 Jahre Jüngeren einen, der sein Erbe, die kunstfromme Ethik des leidenschaftlich bekennenden Musizierens weitertragen würde.
Ebenfalls wie Furtwängler duldete Fischer-Dieskau keine Beschränkung auf ein Ressort. Früh kamen Rezitationen und Schauspielerei hinzu, Bücher, Dirigieren, Lehrtätigkeit und Malerei. Das Gewicht, das er alldem beimaß, die hierbei angemeldeten Ansprüche und der schiere Umfang müssten ausschließlich dem Sänger gewidmete Nachrufe verbieten – wäre dieser nicht so hoch gestiegen, dass man es vornehmlich als ihm zugeordnet begreift, als Markierungen eines weitgefächerten |44| Horizontes und Einzugsgebietes, welche in allem, was er sang, aufgehoben blieben. »Je n’ai rien négligé« (Poussin) – »nichts außer Acht gelassen«, so hätte er mit einem Recht wie nur wenige sagen können und war dazu nicht imstande.
Von dunklen Stunden war die Rede, weil es Begegnungen gab, bei denen man wünschte, ihm einen Bruchteil jener Beglückungen zurückerstatten zu können, die er geschenkt hat. Dennoch bliebe die Rede von Dunkelheiten ungerecht ohne Blick auf das Bündnis, ohne Dank an die Frau, die ihm zuliebe eine große Karriere früh beendet hat, sein Jungbrunnen, solange es möglich war. Ohne sie hätte es die besondere Kameradschaft der letzten zwölf Jahre nicht gegeben, die nach einer riskanten Operation beide als Gnade des Schicksals bewusst gelebt haben.
Was für ein Geschenk sind er und seine Kunst gewesen! Staunen und Dankbarkeit dürften nie enden. Auch die besten der heute Singenden beleidige ich nicht, wenn ich sage: Wir werden seinesgleichen nicht mehr sehen.