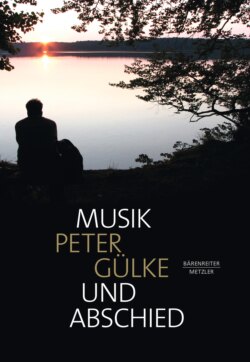Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|29| 6
ОглавлениеNächtliches Totenamt Er sitzt im Dunklen und hört die »Missa pro defunctis« von Pierre de la Rue, einem der in Europa weit herumgekommenen Niederländer, zeitweise im Dienst Kaiser Maximilians, später Favoritmusiker von dessen Tochter Margarete. Die nachtschwarze Dunkelheit der tiefen Lagen – vom Bass wird mehrmals das große C und das Contra-B verlangt – verträgt sich gut mit der Dunkelheit im Zimmer, im Streulicht entfernter Straßenlampen treten die Gegenstände nur schattenhaft hervor. Obwohl das »Dies irae«, die geballte Ladung augustinischer »Logik des Schreckens«, ausgespart ist, bleibt die Musik auf weiten Strecken schroff und ungefällig, seraphisch aufgehellte Wohlklänge sind selten. Hierzu würde gut passen, was der häufig angestrengte Ausdruck Singender auf Bildern von damals nahelegt: dass sie anders, »kehliger« sangen als heute, möglicherweise weitab von den Klangbädern, mit denen manche Ensembles sich und uns den Zugang zu jener Musik erleichtern.
Nichts beleidigt ihn derzeit mehr als Weichspül-Theologie unter anderem im Kielwasser von falsch verstandenem Schleiermacher, die alles Kierkegaard’sche »Furcht und Zittern« wegkratzt, an die entsetzlichste Hinrichtungsart mit Lobpreisungen eines barmherzigen Gottes herandrängelt und im Nazarener-Kitsch, der Butzenscheiben-Frömmigkeit cäcilianischer Musik manch schlimme Blüte trieb. Sein Großvater, berichtete die Mutter, habe in der Kirche, sonst als Vorsänger die Gemeinde anführend, bei »Mein Mund, er träuft zu jeder Zeit / von süßem Sanftmutsöle« aus Protest pausiert.
In Pierre de la Rues Requiem fließt kein Sanftmutsöl. Insgesamt hält sich der musikalische Satz eng an die liturgischen Vorlagen und beansprucht, wie meisterhaft immer gefügt, wenig für sich – große Kunst, die nicht primär Kunst sein soll. Vermutlich sind gregorianische Melodien damals nicht nur von Eingeweihten als Hintergrund mitgehört, Polyphonie vornehmlich als direkte Verlängerung und schmückende Ausfaltung, als Predigt wahrgenommen worden; enge Imitationen in Duo-Passagen erwecken den Eindruck, dass um die Wette gepredigt |30| wird, man einander ungeduldig ins Wort fällt. Weil der Text nicht ungestört fortläuft, erzwingen sie besondere Aufmerksamkeit. Bei Trauermusik mag die Empfindlichkeit gegenüber luxurierender Polyphonie besonders groß gewesen sein.
Welch eine Dramaturgie beim Wechsel zwischen einem Sänger, zweien oder allen! Zu Beginn hält der Komponist die Schwelle zwischen dem Anruf des Rezitanten – nur das Wort »Requiem« – und dem Einstieg des Chores so niedrig wie möglich, indem er die Stimmen direkt an die liturgische Melodie anschließen und nacheinander einsetzen lässt – leise daherkommende Verzweigung ein und desselben. Zeit zu kontrapunktischer Entfaltung hat die Musik nicht, weil »et lux perpetua« griffig formuliert und paarig imitiert gesungen werden soll – Trittbrett zu weit ausholenden, die Lichtverheißung auf unterschiedliche Weise wiederholenden Verflechtungen. Fast ließe sich von einer Exposition der Konstellation von Vorsänger und – mehrfach gestaffeltem – Tutti sprechen. Jener holt den Chor mit »Te decet hymnus, Deus, in Sion« (Dir, Gott, gebührt ein Loblied in Sion) aus der Feier des »ewigen Lichts« zurück; dem aber antwortet das Tutti und verstärkt die Aussage mit »Et tibi reddetur votum in Jerusalem« (Dir erfülle man das Gelübde in Jerusalem). Wenig später akzentuiert es die Eindringlichkeit des »Exaudi« (erhöre) durch akkordischen Gleichschritt, erstmals und im ersten Satz nur hier.
Im Offertorium baut La Rue die beiden auf »Quam olim Abrahae« zulaufenden Komplexe ähnlich auf, beide Male als große Steigerungen, mit imitierenden Duo-Passagen beginnend, die – wiederum niedrige Schwelle – direkt an den Rezitanten anschließen; nach dessen »Domine Jesu Christe« will das obere Stimmpaar beim ersten Mal das preisende »Rex gloriae« für sich, beim zweiten Mal redet das tiefe Stimmpaar für alle mit der Bitte, der Herr möge Opfer und Gebete annehmen »für jene Seelen, deren Gedenken wir heute feiern (»pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus«). Die erste Steigerung läuft auf das – wieder akkordisch-eindringlich deklamierte – »repraesentet« zu: Der heilige Michael möge sie ins heilige Licht »geleiten«; in der zweiten verdichtet sich die Polyphonie nach den Duo-Passagen, kulminiert in den taktweise gestuften Einsätzen bei »in requiem sempiternam« und mündet in ekstatische Wiederholungen von »gaudere«, der Vorausschau auf ewige Freuden.
|31| Ähnlich den Texten zugewandt, zugleich anders verfährt der Komponist in den übrigen Sätzen und trägt dem Umstand Rechnung, dass in der abschließenden Communio von der »lux aeterna« bzw. »perpetua« bis hin zur wörtlichen Übereinstimmung mit dem Introitus-Beginn abermals die Rede ist und dieser finalegemäß übertroffen werden sollte. Wenn es so war, geben die kostbaren, durch den Rahmen der »Cumsanctis-tuis«-Abschnitte umschlossenen Takte ingeniöse Antwort: nochmals »Et lux perpetua luceat eis« deklamierend, in rascherem akkordischem Gleichschritt beginnend und bei »luceat« ohne Wortwiederholung sich verzweigend. Wie am Beginn der Communio »leuchtet« das Licht auch im Satz – er liegt höher als fast alles Vorangegangene.
Wie er da sitzt und hört, in die Musik hineinkriechen, sie tief in sich einlassen will, verblassen Fragen wie: Ob da einer sei, der ewige Ruhe schenken kann, wie diese Ruhe beschaffen sei, ob es die »lux aeterna« gebe, die den Toten leuchtet, offenbar aber nicht sicher leuchtet.
Selbst in sakrosankten Texten spielen zuweilen Momente mit, die mit Gottergebenheit wenig zu tun haben: Im Offertorium wird der »rex gloriae« nicht nur gebeten, die Seelen der Verstorbenen vor den Qualen der Hölle, den Tiefen der Unterwelt, dem Rachen des Löwen zu bewahren und sie friedlich »de morte … ad vitam«, ins ewige Leben hinüber zu geleiten, zweimal wird er eindringlich gleichlautend darauf hingewiesen, er habe es dem Abraham »et semini euius« einstmals versprochen. Mozart hat es »molto energico« komponiert.
Dezidiert Tröstendes begegnet in dieser Musik nicht, eher eine von oben verbürgte Kameradschaft, insoweit Musik nicht nur die vergänglichste aller Künste, sondern tönende Vergänglichkeit selbst ist – und Kameradschaft mit denen, die sich vor 500 Jahren ähnlich fassungslos ins Ritual retten wollten.
· · · · ·
Das mehrstimmige Requiem hatte noch keine lange Geschichte, als Pierre de la Rue um 1500 die »Missa pro defunctis« komponierte. Die Benennung weist darauf hin, woher es kam; als Gattung eigenen Rechts kann es, Teile des Ordinarium missae mit solchen des Proprium de tempore mischend, nicht einmal in der Konfiguration der Sätze gelten: |32| Graduale, Tractus und Offertorium bleiben oft fakultativ, das »Dies irae« war erst seit dem Trienter Konzil obligatorisch. Ob Jan Ockeghems Requiem, das erste erhaltene, unvollständig ist, weil Sanctus, Agnus Dei und Communio fehlen, lässt sich deshalb nicht entscheiden.
Nur von einem vorangegangenen wissen wir; Guillaume Du Fay hat es vermutlich in den 1440er-Jahren für die alljährlich abgehaltenen Versammlungen des Ordens vom Goldenen Vlies komponiert – jeweils am dritten Tag feierte der Orden die Totenmesse. Später hat er es in die Chorbücher der Kathedrale zu Cambrai eintragen lassen und als nach seinem Begräbnis aufzuführen verfügt. Ob es dazu gekommen ist, wissen wir nicht; der Tod des 77-Jährigen trat wohl überraschend ein, auf dem Sterbebett hat er nicht, wie ebenfalls verfügt, seine »Ave-regina«-Motette hören können. Anders als diese ist das Requiem, noch in den 1520er-Jahren in Cambrai gesungen, verloren gegangen.
Dass Du Fay den Zeitgenossen als »lumen totius musicae atque cantorum lumen« galt und eigene Werke als Vermächtnis zusammenstellen ließ, begünstigt den Eindruck, mit solchen Verfügungen – es betrifft auch seine alljährlich zu singende Antonius-Messe – sei über Sicherung des Gedenkens hinaus einige Glorifizierung beabsichtigt gewesen. Dabei bliebe unbedacht, wie wenig wir die Konsequenzen täglich geübter, die Ars moriendi einschließender Gläubigkeit nachvollziehen können, dass Musik mehr war als Wegweiser, Akzidens der Jenseitsfahrt: der Orpheus-Sage vergleichbar ein Türöffner; dass Gott die in Cambrai gesungene Musik, mit der Du Fay vor ihn tritt, tatsächlich hören und als Vorposten der unhörbaren, von ihm veranstalteten »harmonia caelestis« erkennen würde; dass sie entliehen sei und dem eigentlichen Autor vom Protokollanten nunmehr zurückgegeben werde.
Die Vorstellung, bestimmte Kunstfertigkeiten könnten an einer Werkstruktur auch teilhaben, wenn sie, als Möglichkeit im Hintergrund, nicht zum Einsatz kämen, mutet spekulativ an; einige Passagen im Requiem von Jan Ockeghem, der Du Fay als unbestritten erster Musiker seiner Zeit nachfolgte, legen sie dennoch nahe. Direkte Niederschläge der legendären Kanonkünste, die allererst und einseitig mit ihm und Wunderzeugnissen vorausdenkender Imagination wie der »Missa cuiusvis toni« oder der »Missa prolationum« verbunden waren, findet man |33| hier nicht, indirekte umso mehr. Das betrifft unter anderem Duo-Passagen, in denen beide Linien subtil und innig verschlungen sind und zugleich sich als eine einzige, der deklamativen Eindringlichkeit zuliebe aufgespaltene, als potenziertes gregorianisches Psalmodieren darstellen; ebenso betrifft es furios redende, von einer musikalischen Prägung zur nächsten fortstürzende Partien im Graduale, deren kadenz- und zäsurloses Dahinfluten rhetorischen Verdeutlichungen zunächst nicht günstig erscheint und dennoch den Worten aus dem 22. Psalm ein Podest bietet; die sich zudem weniger polyphon geben als sie sind. Es betrifft allgemein eine Diskretion, die die Musik abhält, sich selbstbezüglich vorzudrängen. Das wäre innerhalb des tönenden »Seins zum Tode« peinlich, obwohl sie hier – »Todesraum grenzt vermittelt an Musik« (Bloch) – zuständiger ist als andere Künste.
Dort jedoch, wo Wort und Ton einander semantisch oder strukturell nahekommen, gar in Einklang gebracht werden können, setzt Ockeghem auf vielerlei Weise an. Antiphonische, in liturgischer Einstimmigkeit vorgeformte Traditionen erscheinen am Beginn von Introitus und Graduale ins Szenenhafte projiziert, wenn der Chor dem Anruf des Rezitanten antwortet – zunächst als homophones Echo und sich als Medium der Vertiefung ausweisend, da dies den Worten viel Raum schafft. Dem folgt beim gelängten »aeternam« eine so behutsame wie direkte Wortausdeutung, ähnlich im Offertorium bei dem mit »de morte transire ad vitam« angesprochenen ewigen Leben. Durchweg verfährt Ockeghem bei rhetorischen Momenten diskret, weitab vom Auftrumpfen mit eigenen Möglichkeiten: am Ende des Tractus beim Nachdruck der Tag und Nacht peinigenden Frage »Ubi est Deus?« ebenso wie im Offertorium bei der Bitte um Rettung vor Hölle und Abgrund, auch bei der – wiederholten – Mahnung, dies habe Gott schon dem Abraham versprochen.
Antiphonisch inspiriert erscheint auch das Gegeneinander zwei- bzw. drei- oder vierstimmiger Partien, auffällig nicht nur bei vollstimmigen Bekräftigungen – »consolata sunt« im Graduale, »Ubi es Deus tuus?« im Tractus, »rex gloriae« im Offertorium –, sondern auch im Wechsel unterschiedlicher, wie aus gegensätzlichen Richtungen, aus der Tiefe bzw. Höhe einander zusingender Gruppen; dass Tonlagen seinerzeit nicht nur symbolhaft räumlich begriffen wurden, steht außer Frage – |34| wie sehr Klangerlebnisse in Kathedralen zugleich Raumerlebnisse waren, belegen zeitgenössische Berichte.
Für die Exposition jener Antiphonie gab das Kyrie mit drei je dreigliedrigen Teilen erwünschte Gelegenheit: die erste »Kyrie«-Anrufung drei-, die zweite zwei-, die dritte wieder dreistimmig, die drei »Christe«-Rufe umgekehrt, der zweite, wiederum dreigliedrige »Kyrie«-Teil wie der erste, von diesem abweichend nur in der letzten, als abschließende Bekräftigung vierstimmig gesetzten Anrufung. So ergibt sich ein regelmäßiger Wechsel der Besetzungen und, diese betreffend und durch die weitgehende Identität der flankierenden »Kyrie«-Teile bestätigt, die fast zentralsymmetrische Disposition:
a – b – a / b – a – b / a – b – c
Dergestalt potenziert die Musik das In-sich-Kreisen der Worte und deren Inständigkeit.
In einer Hinsicht scheint schon in den ersten Totenmessen ein eigener Weg eingeschlagen: Sie halten zur liturgischen Einstimmigkeit mehr Nähe; zumeist liegen die Cantus, anders als bei den Versteckspielen längst üblicher Messzyklen, in den Oberstimmen. Offenbar wird Distanz zum Ritual angesichts des ernsten Gegenstandes schnell als abgehoben verdächtig. Pierre de la Rues Generationsgenosse Antoine Brumel, wie jener zumindest im weiteren Sinne Schüler von Ockeghem, hat ein Requiem hinterlassen, das sich in der fast durchgängigen Beschränkung auf harmonische Stützung des Cantus wie ein ängstlich verengtes Gegenstück zu La Rues freizügiger Gestaltung ausnimmt. Dessen Requiem maßgebend zu nennen, fällt dank dieser Konstellation nicht schwer, wiewohl dahinter das verschollene von Du Fay steht; wie viele verlorene außerdem?
Beim exzentrischen Antoine Brumel, dem ersten bedeutenden Franzosen in einer von Niederländern dominierten Epoche, der trotz unsteten Lebensgangs – Chartres, Paris, Genf, Chambéry, Laon, Ferrara, Rom; mehrmals unfriedlich entlassen – ein ansehnliches Werk hinterließ, schlagen die Anforderungen der Totenmesse in differierenden Niveaus offen durch. Im Sanctus und Agnus, als wiederholte Anrufe mit wenig Worten der Musik leicht zugänglich, beschränkt er sich auf eine akkordische Fundierung des liturgischen, zudem sparsam ausgezierten Cantus |35| und bleibt der Vertiefung des Gesagten einiges schuldig; im wortreichen »Dies irae«, dem einzigen vor dem Trienter Konzil in einem Requiem erscheinenden, wechselt er im Ablauf der Strophe regelmäßig zwischen Ein- und Mehrstimmigkeit und gerät mehrmals an solche, die sich für die jeweils andere Behandlung besser eignen würden, muss damit naheliegende Frage-Antwort-Konstellationen ignorieren. Derlei Beschränkung liegt sternenweit weg von Werken wie seiner zwölfstimmigen »Missa Et ecce terrae motus«, einem grandiosen, raffinierte Kanonbildungen einschließenden Klangbad, das humanistisch oder tridentinisch beflügelte Puristen das Fürchten gelehrt haben müsste.
In seinem Requiem heben sich Introitus und Communio wie befreiende Ausbrüche von den kargen Lösungen ab, besonders an den Schlüssen, wo die Musik, als sei sie selbst ein Stück Ewigkeit, von der »lux aeterna«, die den Toten leuchten möge, und dem »requiem sempiternam« nicht lassen will. Nun fährt sie frei aus, schon als klingendes Medium dem Jenseits nahe, kompetenter von ihm redend als Worte.