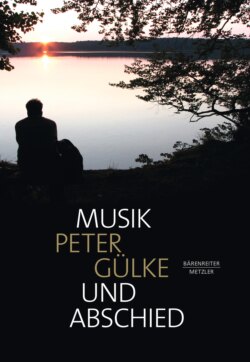Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14
ОглавлениеSprachmächtige Sprachlosigkeit Seit Cavallis »Giasone« waren Ombra-Szenen der bevorzugte Ort dramatischer Tremoli und Abrisse, dunkel drohender Tonlagen, aparter Instrumentenkombinationen, jäher Umschläge, von Seufzern, Verzweiflungsschreien, mühsam erreichter und durchgehaltener Melodiebögen etc. Das erwies sich als Quellgrund des Recitativo accompagnato, auch, weil Prägungen zusammengedrängt werden, die nach größeren Entwicklungen rufen, Arien tragen könnten, sie aber nicht bekommen – symbolisch insofern, als der Tod dazwischentritt, von dem man sowieso nur fragmentarisch reden kann. Übrigens meint »ombra«, lateinisch »umbra«, in Vergils »Aeneis« nicht nur »Schatten«, sondern die Seele Verstorbener.
Als Solo der Primadonna oder dem »prim’uomo« zustehend, wurde die Ombra-Szene im 18. Jahrhundert bei heroischen Stoffen obligatorisch. Dass man ihr zuliebe Handlungsverläufe umbog, die von sich aus nicht auf sie zuliefen, hat viele Gründe – unter anderem das Interesse an einer in widerstreitenden Affektlagen sich aufblätternden Subjektivität, die Lockungen des zum »Schiffbruch mit Zuschauer« gehörigen Schauders und das Anliegen, eine repräsentative Totalität menschlicher Situationen in einen Theaterabend hereinzuholen; für die Autoren der Reiz spezieller, am Rande literarischer und musikalischer Konventionen liegender Herausforderungen.
Zudem verschafften sich Fragen zum Verhältnis von Wort und Ton in einschlägigen Diskussionen, zuweilen überspitzten Distanzierungen von barocken Formalien, immer mehr Geltung. Nirgendwo konnten Normative leichter widerlegt werden als in Ombra-Szenen bzw. im |85| Recitativo accompagnato – schon, weil jene Fragen sich bei jedem Satz neu und anders stellten. Nicht zufällig trieb der Problemdruck zur kurzzeitig aktuellen Sonderform des Melodrams.
In Bezug auf die Folgerichtigkeit im Handlungsgang wirkte erleichternd, dass der Tod die Szene über den Anlass hinaushebt, »horizontale« Verknüpfungen deshalb zurücktreten können: Cäsar beispielsweise hätte bei Händel allen Grund zum Jubel, weil Pompeius aus dem Weg geräumt ist, klagt jedoch wie ein Erstbetroffener; kurz nach dem Hochamt indes gockelt er um Cleopatra. An der Leiche des Kontrahenten ist weniger wichtig, dass er sich nun vor dem endgültigen Triumph, als dass er sich dem Tod gegenüber befindet, der eines Tages sein eigener sein wird; Betroffenheit braucht er nicht zu heucheln.
· · · · ·
Bei der Arbeit an dem für die Karnevalssaison 1772/73 in Mailand vorgesehenen »Lucio Silla« begegneten und ergänzten sich ähnliche Interessen des Librettisten Giovanni de Gamerra und des 16-jährigen Mozart; dafür sprechen innerhalb des Stückes, auch durch Probleme des Genres und solche am Ort bedingt, etliche Ungleichgewichte. Das betrifft schon die kompositorische Situation – jene Interessen waren mit Konventionen schwer zu vereinbaren. Mozart brachte etliche bereits fertiggestellte Rezitative nach Mailand mit, jedoch waren die Texte, weil Gamerra Metastasio zu Rate gezogen hatte, inzwischen verändert worden. So musste Mozart seinerseits ändern – auch etliche Anschlüsse an die Arien, da er diese erst schreiben konnte, nachdem er die Sänger kennengelernt hatte. Der Sänger der Titelrolle musste ausgewechselt werden (»Gestern nachts ist erst der Tenor angekommen, und heute hat der Wolfg: 2 Arien für ihn gemacht, und hat ihm noch 2 zu machen« – so Vater Leopold), zwei Wochen vor der Premiere mussten noch vier Arien komponiert werden; die Primadonna war ebenfalls spät eingetroffen (»ist auch erst gestern abends späth angelangt, und war von Venedig bis Mayland mit der Post à 6 Pferden 8 täge auf der Reise, so voll wasser und D-k sind die weege«). Angesichts solcher Umstände erscheint die Partitur wie ein Mirakel, jede entschuldigende Berufung auf Mozarts 16 Jahre überflüssig.
|86| Da Herrschermilde per se nicht bühnenwirksam ist, muss die Wendung zu ihr es umso mehr sein, muss dramatisch geschärft werden – ein weiterer Grund zum Abstieg in Katakomben, reale und die von Trauer, Verzweiflung, Todesbereitschaft und vorgetäuschten Toden. Hier haben die Autoren sich am wenigsten beirren lassen, auf etablierte Praktiken wenig Rücksicht genommen. Wer weiß, ob man in Mailand Musik wie die der siebten Szene im ersten Akt schon gehört hatte – zumindest eine so dichte Aufeinanderfolge extremer Prägungen, die deren Wahrnehmung kaum Zeit lässt: am Beginn das synkopisch schwergängige, mit tiefen Trompetenterzen und geteilten Bratschen dunkel tönende Andante, worin das Gemäuer der Begräbnisstätte selbst zu klingen scheint, klagende Chromatizismen und schnell abreißende Terzabgänge, ein jäh aufschießendes Allegro assai, ein nahe bei Glucks Hades-Musik liegender Chor derer, die Giunia zum Grab ihres Vaters begleiten, und, dies noch überbietend, ihr Molto Adagio.
Sehr anders, noch schärfer kontrastierend die Szene, in der die Liebenden einander zum vermeintlich letzten Mal begegnen: Wie gefasst und heiter Cecilio auch dem Tod entgegensieht – die A-Dur-Leichtigkeit seines Rondos (Tempo di Menuetto!) bleibt, der verzweifelten Geliebten aussichtslos tröstend zugesungen, nahezu surrealistisch situationsfremd, von abgehobener, für sie rätselhafter Heiterkeit – und wie katastrophisch, nachdem man ihn abgeführt hat, der Sturz in die Wirklichkeit bei Giunias Soloszene, abermals mit jähen Wechseln und auratischen, von Bratschen gegen Flöten oktavierten Terzgängen, con sordino abgedunkelten Klängen! Auch das könnte damals un-erhört gewesen sein, war es als Erfindung des 16-Jährigen jedenfalls und erscheint wie eine tönende Entsprechung zu Mozarts späterem, vom Tod handelnden Brief an den Vater, worin er sich als Leser von Moses Mendelssohns »Phädon« zu erkennen gibt.
· · · · ·
In die Konsequenzen seines in Todesangst geleisteten Schwurs wird Idomeneo spät hereingerissen; zunächst, nachdem er sich an Land gerettet hat, scheint mehr abgehobenes »Unmittelbar-zu-Gott« bei einer Ombra-Szene kaum vorstellbar: Weder ist der Kandidat der Totenfeier schon tot, noch weiß man, wer es sein wird.
|87| Als wolle Mozart die Abgehobenheit bestätigen, hat er für die Wiener Aufführung jene Passage gestrichen, in der Idomeneo seine Mitschuld zu erklären sucht: dass er, auf der Heimfahrt vom zornigen Neptun in äußerste Gefahr gebracht, geschworen habe, den ersten, der ihm an Land begegnet, auf dem Altar des Gottes zu opfern. Die Erklärung war umso nötiger, als hochgestellte Personen es schwer haben, mit ihren Seelenqualen auf der Bühne Eindruck zu machen; da subalterne sich derlei kaum leisten können, ist von ihnen nicht viel Empathie zu erwarten. Mozarts Streichung erschiene noch weniger verständlich, falls Rücksichtnahmen auf die begrenzten Möglichkeiten des Uraufführungs-Idomeneo ihn gehindert haben sollten, die Szene so zu komponieren, wie er es gern getan hätte.
Das Opfergebot fährt in ein komplizierteres Beziehungsgeflecht hinein als bei vergleichbaren Konstellationen in Händels »Jephta« oder Glucks »Iphigenie in Aulis«. Im Jahrhundert der Aufklärung könnte die Themenwahl merkwürdig erscheinen, läge nicht ein Teil der Verantwortung auf den Schultern der irdischen Protagonisten: Inwieweit legitimiert die Todesangst den in Seenot Geratenen, ein beliebiges Menschenleben zur Disposition zu stellen? Die Empörung gegen grausame Götter und verhasste Altäre – »Barbari, ingiusti Numi! Are nefande!« – kommt spät und entlastet einen, der sich zu ihrem Komplizen gemacht hat, ebenso wenig wie vorweggenommene Seelenqualen.
Die freilich waren nicht nur vonnöten, um Mitgefühl zu wecken und Idomeneo als einen auszuweisen, der das Zeug zum milden Herrscher hat. Welchen Gegenstand hätte eine Klage um jemanden haben können, den man nicht kennt, der noch lebt, wenn nicht die Vergegenwärtigung der rituellen Schlachtung – »nel sen trafitto, / nel corpo esangue« (die Brust durchbohrt, der Leib ausgeblutet)? Selbst wenn Mozart dem Sänger nachgegeben haben sollte: Wie sehr steigert die Musik die Vergegenwärtigung zum Trauma – in der synkopisch schweren Gangart am Beginn seiner ersten Arie, dunklem Streicherklang, vielerlei Klageformeln, bei denen Sänger und Bläser wetteifern; in der Hervorhebung von Kernworten (»l’ombra«, »innocente« aufs Opfer bezogen, »sangue«) durch tiefe oder lange Töne, nicht weniger beim Ausbruch ins Allegro di molto mit »Qual spavento, / qual dolore!« etc.
|88| Hier ist von Nachgiebigkeit nichts zu spüren; im Übrigen konnte Mozart, sofern nötig, in verschiedene Richtungen ausweichen. Die Annahme, er habe nur in einer, bei affektiven Höhenlagen, zurückstecken müssen, erscheint fragwürdig, weil die Oper von einer Extremlage in die nächste stürzt. Schon der Blitzschlag der Erkenntnis, dass Idomeneos Sohn das Opfer sein werde, musste affektiv weit über der imaginierten Tötung von jemandem liegen, den Idomeneo nicht kennt.
· · · · ·
»Ja, wie soll ich dieses Letzte aussprechen? Aber das Letzte soll ich eben nicht aussprechen, sondern das ist das Ende, an das wir kommen, die Mauer, an die wir stoßen« (Wittgenstein). Wie oft, in Ombra-Szenen vorsätzlich, erweist Musik sich als letzte Station vor dem Anprall an jener Mauer, wie oft überschattet der Tod die Grenzzonen!
Nach Florestans »O grauenvolle Stille« klopft die Stille zwar in der Pauke, vorausgegangen jedoch ist – dröhnend, stockend, zögernd, suchend, anrennend, rufend, klagend, zu keiner thematischen Gegenständlichkeit gelangend – Musik nahe bei einer Summe aller Ombra-Intonationen, dennoch kein Widerspruch zur Stille: Wir hören sie, Florestan indes hört sie, als von außen kommend, nicht, zu sehr ist sie in ihm, als Vergegenwärtigung des Todes seine eigene, mit ihm identisch – die Paradoxie der eindringlich redenden, wo nicht dröhnenden Stille steht für die eines in der Zisterne lebenden Leichnams.
»Halt!«, schreit die zur Bettgenossin Plutos verurteilte Proserpina in eine Musik hinein, die im Begriff ist, sich zur üblichen Ouvertüre zu runden – in einem unter Goethes Augen entstandenen Melodram; dessen Komponist Carl Eberwein, für etliche Zeit am Frauenplan das musikalische Hausfaktotum, war nie wieder so gut wie hier. Vordergründig gehört der Schrei Proserpinas ihrer Situation und Verzweiflung, zugleich indes verdeutlicht er, dass unangefochten eigenen Reglements folgende Musik im Hades keinen Platz hat. Die Ouvertüre bricht ab.