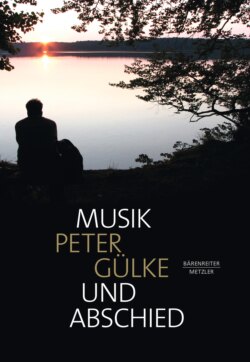Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|75| 12
ОглавлениеZweimal Orpheus Mit Glucks Furien kommt Orpheus besser zurecht als mit Monteverdis Caronte, dieser Kreuzung aus Wachhund, Osmin und Kafka’schem Türhüter, die sich weichere Empfindungen von Amts wegen versagen muss: »Ben mi lusinga alquanto / dilettandomi il core, / sconsolato cantore, / il tuo pianto e’l tuo canto. / ma lunge ah lunge sia da questo petto / pietà, di mio valor non degno affetto.« (Wohl schmeichelt mir ein wenig / und entzückt mein Herz, / untröstlicher Sänger, / dein Klagen und dein Gesang. / Doch fern, sehr fern soll dieser Brust / Mitleid sein, das meiner nicht würdig ist.) Eben noch haben Glucks Furien dreizehnmal »Non!« in Orpheus’ flehentliches »Laissez vous toucher par mes pleurs« hineingebrüllt, da werden sie ihrem Namen und Auftrag bereits untreu, widerstehen dem Lamento samt ostinat anrennendem Lautengeklimper nicht: »Par quels puissants accords, / dans le séjour des morts, / malgré nos vains efforts / il calme la fureur / de nos transports!« (Mit welch machtvollen Akkorden / an diesem Ort der Toten / bannt er gegen unsere vergeblichen Anstrengungen unseren Grimm). Wenig später geben sie den Weg frei, »beschließen die Szene mit einem allgemeinen Ballett und stürzen sich dann in einen Abgrund« – welche eine Wirkung der erst 23, dann 15 Takte von Orpheus gespielten Musik!
Wie anders ging es anderthalb Jahrhunderte vor Wien (1762) und Paris (1774) am 24. Februar 1607 in Mantua zu! Im dritten Akt bei Monteverdi, im zweiten bei Gluck war Musik fällig, der man zutraut, die Pforten der Unterwelt aufsprengen zu können. Der opernerfahrene Gluck schiebt die Dimension der Anforderung beiseite bzw. verengt sie zu der auf die konkrete Situation bezogenen Frage nach Musik, die die Furien mürbe machen kann. Damit gewinnt er jene Eindeutigkeit, bei der man um Verständlichkeit und Projektion ins Große, der Bühne, des Auditoriums nicht bangen muss.
Im kleinen Saal zu Mantua hingegen können kaum mehr Menschen zugehört als mitgewirkt haben, von Oper im Sinne einer etablierten Gattung mit stabilen Konventionen, die bestimmte Lösungswege vorgäben, war man weit entfernt. Von Peri und Caccini abgesehen, spielten |76| Erbschaft und Maßgaben der im Madrigal zu höchster Subtilität entwickelten Textwahrnehmung mindestens ebenso sehr mit wie Erfahrungen mit oft simpel gefügten Intermedien. Insgesamt kann man sich die Umstände, unter denen die beiden Orpheus-Opern präsentiert wurden, nicht unterschiedlich genug vorstellen – in Wien, mehr noch in Paris das große, auch der gehobenen Bürgerlichkeit offenstehende Auditorium, in Mantua vor einem kleinen Kreis geladener, interessierter, vorab eingeweihter Gäste nahezu die Konstellation eines Experimentalstudios.
Je weniger Normative traditionell vorgegeben sind, desto mehr muss immer neu gefragt und begonnen werden, desto stärker die Individualität der Lösungen. Den Anforderungen des offenen Terrains findet Monteverdi sich als skrupulös Arbeitender gegenüber, der nach eigenem Zeugnis für ein Madrigal oft eine Woche, für »Orfeo« ein Jahr gebraucht, sich an der »Arianna« fast zu Tode komponiert hat und schwerlich gesonnen war, hinter die im Madrigal erreichten Maßstäbe zurückzugehen; fünf Madrigalbücher waren bereits erschienen.
Offensichtlich reichte Musik nicht aus, die lediglich die Konfrontation mit Caronte reflektiert; es bedurfte einer, der man zutraut, die Pforten der Unterwelt zu sprengen – innerhalb der alten Mythologie ihr oberster Prüfstand, für Adorno der Eingriff »in den blinden, ausweglosen Naturzusammenhang des Schicksals«, dessentwegen »alle Oper … Orpheus« sei. Insofern ging es nicht um eine bestimmte, sondern um die Musik schlechthin.
Wie um den Anspruch zu verdeutlichen, zerlegt Monteverdi Orpheus’ Attacke in mehrere Musiken mit je eigener Stilistik und Kompetenz, Caronte wird aus verschiedenen Richtungen bestürmt. Dank jener Strategie und als Fokussierung von drei divergierenden Orientierungen wird das in die Mitte des dritten Aktes gestellte »Possente spirto« zum Kernstück des Ganzen. Zunächst versucht Orpheus, Caronte zu imponieren. Er befleißigt sich der damals fast schon verjährten, zumeist Göttern vorbehaltenen Singart, des mit Verzierungen gespickten, hochvirtuosen »cantar parsaggiato« – in den Einzelheiten normalerweise den Ausführenden überlassen, hier eigens ausnotiert. Wäre es nicht so ferngerückt, dass wir mit eigenen Eindrücken vorsichtig sein sollten, könnte man meinen, Orpheus spreize sich, seiner selbst unwürdig, wie ein Pfau. |77| In stehenden Akkorden, vor denen er nachtigallenhafte, von Instrumentalisten imitierte Rouladen, Koloraturen etc. zelebriert, will er Caronte auf sich und sein Singen fixieren – vergeblich: Caronte schweigt.
Daraufhin schaltet Orpheus auf die schlichtere Singart, das »cantar sodo« um, verlegt sich auf Flehen und Schmeichelei (»Sol tu, nobile dio, puoi darmi aita«) und demütig von unten kommende Ansätze. Das verfehlt die Wirkung nicht, Caronte gesteht seine Rührung, verkündet jedoch mit Stentorstimme, Mitleid sei seiner nicht würdig.
Damit ist Orpheus mit seiner Taktik am Ende, sofern es eine war. Es treibt ihn zur dritten, seinerzeit modernsten Singart, dem »cantar d’affetto«, hier einem Sturzbach der Verzweiflung, von Schreien, abgerissenen Sätzen, der in eine Anrufung der Götter des Tartarus mündet: »Rendetemi il mio ben, Tartarei Numi!« Dem schließt sich eine aus nur wenigen Takten bestehende Sinfonia an – und nun geschieht das Wunder: Caronte schläft ein, Orpheus entert den Kahn und quert den Acheron.
Die vom legendärsten aller Sänger, der Inkarnation allen Singens zum Aufsprengen der Hades-Pforten bestimmte Musik ein Schlafmittel, Orpheus lediglich wegen Carontes Schläfrigkeit zu Eurydike bzw. Pluto vordringend – Ursache und Wirkung passen schlecht zusammen, die Invasion im Totenreich erscheint durch banale Umstände verkleinert, die Dignität der Musik beschädigt; die Arbeit der Autoren fragwürdig? Der Einwand übersieht, dass die Musik selbst zum Handlungsträger wird, über die Köpfe der Protagonisten hinweg agiert und dass dies nur anhand ihrer Wirkung ersichtlich werden kann. Wie wäre anders deutlich zu machen, dass Caronte außer Gefecht gesetzt ist? Offenbar steht sein Schlaf als Chiffre für Wehrlosigkeit. Nur Sekunden bleiben ihm, um wegzudämmern, die einlullend dunkle Sonorität der Sinfonia – »pian piano, con Viole da braccio, un Org. di leg. & un contrabasse de Viola da gamba« – währt nur eine knappe Minute. Im Vergleich zur »realistischen« Sphäre der Auseinandersetzung sind wir in eine allegorische verschlagen, Schlaf kann nun mehr sein als Schlaf und eine Sekunde eine Stunde. Die Vermutung liegt nicht fern, dass Monteverdi und sein Textdichter Striggio es im Sinne einer Apologie »reiner« Musik genau machen wollten – insofern diese, solange Orpheus sang, noch zu speziell |78| war, nicht also wie die ans pure Tönen heranreichende, mit der »Lira del ciel« verbundene Sinfonia, die jener »harmonia mundi« als dem Inbegriff von Musik nahekommt, dem nichts widersteht.