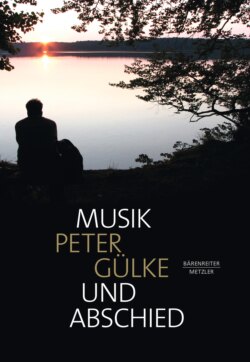Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|71| 11
ОглавлениеGryphius betet
Abend
Der schnelle Tag ist hin / die Nacht schwingt jhre fahn /
Vnd führt die Sternen auff. Der Menschen müde scharen
Verlassen feld vnd werck / Wo Thier und Vögel waren
Trawrt jtzt die Einsamkeit. Wie ist die zeit verthan!
Der port naht mehr und mehr sich / zu der glieder Kahn.
Gleich wie diß licht verfiel / so wird in wenig Jahren
Jch / du / vnd was man hat / vnd was man siht / hinfahren.
Diß Leben kömmt mir vor alß eine renne bahn.
Laß höchster Gott mich doch nicht auff dem Laufplatz gleiten /
Laß mich nicht ach / nicht pracht / nicht lust / nicht angst verleiten
Dein ewig heller glantz sey vor und neben mir /
Laß/wenn der müde Leib entschläfft / die Seele wachen
Vnd wenn der letzte Tag wird mit mir abend machen /
So reiß mich auß dem thal der Finsterniß zu dir.
Am Beginn zwei im genauen Sinn tod-traurige Quartette: Auch in der Formulierung ist der Tag »schnell … dahin«, die Nacht hingegen – nichts da von bergender Dunkelheit, süßen Geheimnissen etc. – »schwingt jhre fahn« und »führt die Sternen auff«; die Menschen sind müde, verlassen ihr Tagwerk, »Thier vnd Vögel« verschwunden – alles geschildert, als sei es umsonst gewesen und gelebt worden, wie immer bei der »vertanen« Zeit wohl vergangene Zeit mitgemeint ist. »Diß Leben kömmt mir vor alß eine renne bahn« bestätigt das Tagesende als Metapher des Lebensendes; sofern man »port« als Gleichnis überlesen hat, sagt »diß Leben« erstmals unzweideutig, dass es noch ein anderes, »jenes« Leben gibt. Die Überschrift erscheint im vorletzten Vers wieder – da ist klar, auf welchen Abend es zuläuft.
|72| Zunächst begünstigt die Weiträumigkeit des sechshebigen Alexandriners die erzählerische Reihung der Bilder, die sich Zeit nimmt – »der schnelle Tag« ist ja »hin«, der Untertext sicher. Das zweite Quartett springt aus der traditionell gesicherten Metaphorik heraus, »port« (Tod) und »der glieder kahn« (Leib) vergrößern den Abstand zwischen Bild und Sinn und ziehen andererseits die Exegese (»gleich wie diß licht verfiel«) nach sich – als ob der Druck des eigentlich Gemeinten übermächtig würde, jener Abstand sich nicht halten ließe. Mit »ich / du / vnd was man hat« scheint er und mit ihm die Ebene der poetischen Gleichnisrede aufgegeben, im Precipitando der Aufzählung und einsilbiger Wörter kommt das Gedicht außer Atem und sperrt sich gegen den vorreglementierten Sprachfluss.
Beim Übertritt in die Terzette wirft es sich Gott in die Arme, gibt der Dichter sich als sprechendes Subjekt zu erkennen, fünf der sechs verbleibenden Zeilen kehren mit »mir« bzw. »mich« den Ich-Bezug hervor. Vorbereitet war es mit »kömmt mir vor« im Schlussvers des zweiten Quartetts, wie der des ersten – »Wie ist die zeit verthan!« – fast ein vorzeitiges Resümee auf der Linie einer strukturellen, der Sonettform eigenen Logik. Als Brücke erweist es sich auch, weil die »renne bahn« im »Laufplatz« aufgenommen wird, auf dem der Sprechende nicht »gleiten« (ausrutschen) möge, und weil bisher alle Quartettverse mit Ausnahme der beiden letzten, wie der Alexandriner vorschreibt, gehälftet sind – Einladung zur Notierung:
Der schnelle Tag ist hin /
Die Nacht schwingt ihre fahn /
Vnd führt die Sternen auff. /
Der Menschen müde scharen
usw.
Dennoch ist das falsch; die Spannung zwischen den hypothetischen Kleinzeilen und den die großen übergreifenden Endreimen – den kurzen fehlen sie – gehört zum sechshebigen Alexandriner. Zunehmend setzt sich die Großzeile auch syntaktisch durch, drei von sechs Terzettversen beginnen mit dem bittenden »Laß«, und die Korrespondenz von »mir« und »dir« an den Terzettschlüssen signalisiert gebethafte Suche nach |73| direkter Begegnung mit Gott, nachdrücklich umso mehr, als drei Reimklänge zusammengebunden werden (»gleiten« – »verleiten«; »wachen« – »machen«; »mir« – »dir«), nachdem zuvor acht Verse der Quartette mit zweien ausgekommen waren (»fahn« – »verthan« – »kahn« – »bahn«; »scharen« – »waren« – »Jahren« – »hinfahren«).
Syntax und sechshebiger Vers kommen also aufeinander zu, das Gedicht wirkt am Beginn erzählender, gesprochener, gegen Ende hin strömender, musikalischer. Nicht nur waren die Anfangsverse dem Alexandriner gemäß halbiert (s. o.), drei Sätze laufen gar von einem in den nächsten Vers hinüber. Das holprige »zu der glieder Kahn« – die gewagteste Metapher – am Beginn des zweiten Quartetts tut der Unterteilung noch Genüge, die dritte Zeile sperrt, die vierte verweigert sich – fast, denn »Diß leben kömmt mir vor / alß eine renne bahn« wäre auch denkbar. Immerhin sind Sprachfluss und sechshebiger Vers nun weitgehend beieinander.
Zwar läuft der erste Vers der Terzette durch wie keiner zuvor, ist aber wegen vieler, dem Fluss dienlicher Einsilbler verdächtig. Immerhin sichern sie ihn; in der folgenden Zeile – »Laß mich nicht ach …« wie bei »Jch / du / und was man hat …« mit zehn einsilbigen Wörtern und einem dreisilbigen am Ende – scheint der Fluss nochmals gefährdet: letzte Barriere vor der Ankunft bei »Dein ewig heller glantz sey vor vnd neben mir«.
Ankunft auch in einem anderen Sinne: Hier wird das Gedicht zum Gebet. Der Nebensatz »wenn der müde Leib entschläfft« steht dem Eindruck, das zweite Terzett bilde einen einzigen Bogen, kaum entgegen. Ganz und gar bestätigen es die beiden letzten Verse: Durch »wenn« eingeleitet, wird die Todesstunde gebetsüblich wiederholt zweimal angesprochen.
Wohl kennt man »So reiß mich auß dem thal der Finsterniß zu dir« aus fast wortgleichen Formulierungen. Hier gewinnt es Leuchtkraft und einen Hauch von Erstmaligkeit als neu erreichte Mündung – paradox gestützte Erstmaligkeit, weil untergründig mitklingt, dass so und ähnlich schon oft gebetet wurde. Der Schluss schießt über die schwer errungene Kongruenz von Syntax und sechshebigem Alexandriner hinaus, nun überspannt ein Satzganzes zwei Verse.
|74| Als direkte Hinwendung duldet das Gebet die Filterung durch Metaphern eigentlich nicht; Gryphius’ Gedicht wird zum Gebet, ist es nicht von vornherein; die Inständigkeit des Betens verdankt sich auch dem Umstand, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als dort anzukommen, dass es als Verlauf, als hierhin mündende Form verdeutlicht: Beten heißt nicht nur anrufen, sondern auch heranholen. Woran die Frage anschließt, inwieweit die Plausibilität der Sageweise und des Gesagten zweierlei seien. Sprich dir die Worte nur oft genug vor, dann glaubst du etwas mehr, dass da einer sei, der dich aus dem Tal der Finsternis reißen kann. »Wenn wir Bach hören, sehen wir Gott aufkeimen, sein Werk ist gottgebärend« (Cioran).
Ohne Osmose von Sagen und Gesagtem geht es nicht ab: Worte, Töne, Farben suggerieren nicht nur, machen nicht nur vorstellig – sie evozieren, schieben sich als verschärfende Optik vor die gemeinte Wirklichkeit, holen sie heran, treiben zur Identifizierung mit ihr. Dem silbrigen Grün mancher Bäume sind wir näher, seit wir Corot kennen; Glaubensinhalte waren dem mit der »Missa solemnis« ringenden Beethoven näher als dem der »Eroica«; Mendelssohn hat, orthodoxen Ohren verdächtig, gesagt, er bemühe sich, fromm zu sein, im »Elias« und »Paulus« war er um Einbürgerung ins Christentum bemüht, im »Elias« auf dem Weg, im »Paulus« sicher wohnend; Wortinhalte, die vom Schwingungsgefüge eines Gedichts getragen sind, haben eine andere Plausibilität, sind wahrer als bloß benennende, die die Alltagsprosa heranspült; Prousts nach der verlorenen Zeit suchendes Ich hätte sich eher auf die Champs-Élysées getraut, wenn es über sie zuvor in einer Beschreibung Bergottes hätte lesen können. Theorien der Kunst mögen noch so aufklärerisch auf Abbildlichkeit bestehen – einen Bodensatz von Beschwörung und Unio mystica führt sie allemal mit sich. Auch dem, der an Tod zu denken wenig Anlass hat, macht Gryphius’ Gedicht den ultimativen Abend wirklicher.