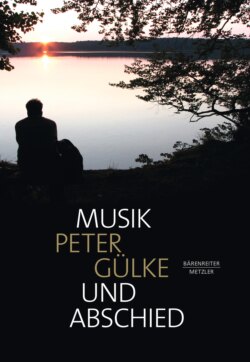Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеTrauermusik für große Damen und Herren Wenn Hochgestellte Einzug hielten oder das Zeitliche segneten, mussten Musiker ran – dort vornehmlich die lauten, hier die guten. Selbst, wo prominente Tode überraschend eintraten und Komponisten vorhandene Stücke umschreiben oder abschnittweise plündern mussten, weil Tage später eine personenbezogene Trauermusik gebraucht wurde, haben wir es überwiegend mit vorzüglicher Musik zu tun – das gilt auch für das Potpourri, das man für Jean-Philippe Rameaus Begräbnis im Jahr 1764 aus Kompositionen von ihm und der seinerzeit vielbenutzten »Messe des morts« von Jean Gilles zusammengestellt hatte. Ob es dem Rang der Komponierenden oder der Verstorbenen, gar dem Respekt, der Liebe zu ihnen zu verdanken sei oder der Eignung der Musik als Dolmetsch von Andacht, Gedenken und Tröstung, muss nicht gegeneinander abgewogen werden. »So etwas kann Philosophie nicht«, bekannte Martin Heidegger in einer Situation, da er trostbedürftig war und sich Schuberts letzte Sonate hatte vorspielen lassen.
· · · · ·
Im April des Jahres 1492 war Lorenzo der Prächtige erst 43-jährig auf seinem Landsitz nahe Florenz an der Familienkrankheit der Medici, der |56| Gicht gestorben. Überraschend kam es nicht: Der »Blitzschlag« im Text, den Angelo Poliziano aus diesem Anlass verfasste, steht metaphorisch für das böse Omen, das sich mit diesem Tod verband – die guten Zeiten von Florenz gingen vorerst zu Ende, der »linke« Eiferer Savonarola agitierte in der Stadt, wenige Jahre später waren die Medici verjagt. Mit Heinrich Isaac war neben dem Dichter ein Musiker gleichen Ranges zur Hand – beide waren als Lehrer von Lorenzos Kindern tätig. Aus Anlass von Lorenzos Tod übrigens hat Isaac noch eine zweite Motette komponiert, gleich Pierre de la Rue auf einen ähnlichen, bei Seneca entliehenen Text: »Quis dabit pacem populo timenti?«
»Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte die Erschlagenen meines Volks!« (Jeremia 8, 23) Neben dem hier anknüpfenden Beginn mögen poetische Qualitäten und der prominente Anlass später geholfen haben, die Kompositionen zu Bezugspunkten zu machen. »Quis dabit oculis nostris fontem lacrimarum«, beginnt der Text zweier im Januar 1514 der verstorbenen Anne de Bretagne gewidmeter Motetten von Jean Mouton bzw. Costanzo Festa. Die Musik des Letzteren taucht später in einer Drucksammlung auf, hier dem Isaac-Schüler Ludwig Senfl zugeschrieben und auf Maximilian I. bezogen; als dessen Enkel Ferdinand I. im Jahr 1564 das Zeitliche segnete, wurde der gleiche Text wenig verändert wieder zweimal komponiert, in einer Trauermusik auf den 1611 verstorbenen sächsischen Kurfürsten Christian II. erscheint er abermals. In solchen Überbleibseln einer einstmals fraglos dichteren Filiation steht die Auswechselbarkeit von Musik, Worten und Namen mindestens ebenso für die Anonymität des Todes wie für einen durch die Umstände erzwungenen Pragmatismus.
Wohl legte das drei verschiedene Texte eröffnende »Quis dabit« den feierlich gedehnten Daktylus nahe, die Folge einer Brevis (Ganzen) und zweier Semibreven (Halben); in der schwergewichtigen ersten Note schwang wohl die Vergeblichkeit der Frage nach dem mit, der Wasser, Tränen, Frieden zu geben imstande wäre. Isaac unterstreicht es in beiden Motetten durch Gleichschritt der Stimmen und hohle Quint-Oktav-Klänge – stärker auf Deklamation gestellt kann ein Satz kaum beginnen; in Zeiten gesteigerter rhetorischer Sensibilität mag das als Ausdruck des |57| Umstands gehört worden sein, dass es einem die Sprache i. e. Musik verschlagen hat, man sie neu finden muss. Auch die zuerst zögernden, dann sich steigernden kontrapunktischen Verzweigungen sprechen dafür. Mit ihnen reagiert die Musik beim Poliziano-Text auf den ausladenden zweiten Satz: »Quis oculis meis fontem lacrimarum dabit, / ut nocte fleam, ut luce fleam?« (Wer wird meinen Augen den Quell der Tränen weisen, damit ich nachts weine, damit ich bei Tage weine?) »Weinen« gibt Anlass zu schweifender Melodik und polyphon gegen- und durcheinander klagenden Stimmen, wonach sich dank der Parallelität von drei kurzen Satzgliedern wieder klare Gruppierungen herstellen: »Sic turtur viduus solet, / sic cygnus moriens solet, / sic luscinia conqueri« (wie die verlassene Turteltaube trauert, / wie der sterbende Schwan klagt, / wie die Nachtigall schluchzt). Danach kann die Musik beim Klageruf »Heu miser, o dolor« kein Ende finden; am liebsten, so scheint es, würde Isaac deutlich gliedernde Kadenzen meiden.
Nach dieser sehr direkt allegorisierenden Klangrede überwiegt die symbolische: »Et requiescat in pace«, die der Antiphon »Salva nos« entnommene Schlusszeile trägt die zweite Strophe als absteigender Ostinato ganz und gar; zudem fehlt der Tenor, offenbar anzeigend, dass Lorenzo nun fehlt. Am Ende kommt Isaac mit dem »in pace« lang liegenden Ton auf die direkte Klangrede zurück.
Es bedarf nicht unbedingt der Vermutung, die Komposition sei unter Zeitdruck entstanden, um zu erklären, weshalb Isaac einige Passagen aus seiner »Salva-nos«-Messe hereingenommen hat. Betrachtungen, die auf singuläre Verbindungen von Wort und Ton ausgehen und den Anspruch der Musik durch derlei Versatzstücke beeinträchtigt meinen, übersehen deren transzendente Beglaubigungen. Zudem: Warum soll Musikern innerhalb ohnehin enger gezogener Grenzen nicht recht sein, was Malern bei der mehrmaligen Verwendung bestimmter Figuren, bildnerischer Lösungen etc. billig war?
· · · · ·
Anne de Bretagne, begehrte Erbin eines begehrten Landes, gehörte zu den Prinzessinnen, die auf dem Schachbrett dynastischer Händel unbefragt hin- und hergeschoben wurden. Zunächst dem späteren Kaiser |58| Maximilian I. versprochen, war sie aus naheliegenden Gründen für den französischen König Karl VIII. interessant; der aber war mit einer Tochter Maximilians verlobt. Um ihn zur Auflösung der Verlobung und zum Verzicht auf Anne zu bewegen, musste Karl das Artois und die Franche-Comté abtreten, was im Hinblick auf den Erwerb der Bretagne hinnehmbar erschien. Vorsorglich bestimmte eine Zusatzklausel, dass Anne, falls er kinderlos sterben würde, den Nachfolger heiraten müsse. Tatsächlich verschied Karl mit 28 Jahren – auf dem Weg zum Ballspielen im Burggraben von Amboise war er gegen den Rahmen einer niedrigen Tür gestoßen. Die Krone kam an seinen Schwager und Cousin Ludwig von Orléans; der jedoch war mit Johanna von Frankreich verheiratet, deren Frömmigkeit als Scheidungsgrund wegen Nichtvollzugs der Ehe herhalten musste. Nachdem dies bewerkstelligt war, nahm der nunmehrige König Ludwig XII. Anne zur Frau.
Sie starb in den ersten Januartagen des Jahres 1514. Die Funeralien sprechen für ihre Beliebtheit, die Überführung von Blois in die Königsgruft von Saint-Denis dauerte fast sechs Wochen – in mehreren Städten wurde Station gemacht, wo ihr Beichtvater jeweils über einen Textabschnitt aus den Klageliedern Jeremiae predigte. Zeremonie und Musik hängen hier besonders eng zusammen: Drei jener Abschnitte (»Defecit gaudium cordis nostri; versus est in luctum chorus noster; cecidit corona capitis nostri«) hat Mouton in seine Motette hineingenommen. Sie bilden das Mittelstück, nachdem im ersten Teil die Frage, wer den Tränenquell der Tag und Nacht Weinenden offenhalten werde, rhetorisch aufgesplittet war: weshalb die Bretagne weine, die Musik schweige, Frankreich Trauerkleider trage und sich in Kummer verzehre. Vom zögernden Nacheinander der Stimmen ausgehend, entfaltet Mouton dies zu groß dahinflutender, die Textglieder ineinander schiebender Polyphonie und kehrt am Ende mit »maerore consumeris«, zudem in Wiederholungen, zur Verhaltenheit des Beginns zurück.
»Heu nobis, Domine« am Beginn des Mittelstücks mutet wie ein Schrei an, »defecit Anna« danach schlicht akkordisch wie von einem gesagt, der es kaum auszusprechen wagt und wiederholen muss, um zu begreifen, was er sagt. Das setzt sich in Zitaten aus den Klageliedern fort – »die Freude unseres Herzens tot, traurig unser Lied, |59| herabgefallen der Kranz vom Haupt unserer Königin«; herabgefallen fast bis zum Nicht-mehr-singen-können erscheint auch das »Lied«.
Die Knaben zum Wehklagen aufgerufen, die Greise zum Jammern, die Sänger bzw. Priester zum Trauern: Als Chor müssen sie sich, von der Höhenlage der Knaben in die tieferen der anderen hinabsteigend, erst neu finden und – »plangite nobiles et dicite« – vorsagen lassen, womit sie, zunächst an der Nennung der Verstorbenen hängenbleibend, dann schwer zu Ende kommen: »Anna requiescat in pace.« Im stillen Ende scheint das Singen, polyphon zerfasernd, sich zurücknehmen zu wollen. Was für eine ebenso logische wie durcherlebte Kurve: vom verzweifelten Fragen des ersten Teils zum Tremendum des benannten Todes im zweiten – dort der Name der Verstorbenen in Zitate gebettet – zur Aufforderung im dritten!
· · · · ·
Anders als Grabsteine, Skulpturen und Bilder taugen Trauermusiken zur Stabilisierung des Gedächtnisses, gar Verewigung nicht, anders als die den Verstorbenen zugewendeten Texte spricht Musik vom Toten kaum, umso kompetenter vom Tod. Nicht nur aus pragmatischen Gründen also wurden sie mehrmals verwendet.
Thomas Morleys »Dirge Anthems« sind offenbar für die 1603 verstorbene Elisabeth I. komponiert und später wieder benutzt worden. Bei den Feierlichkeiten für Queen Mary im Jahr 1694 ersetzte man ein damals nicht auffindbares – »Thou knowest, Lord, the secrets of our life« – durch ein von Henry Purcell über denselben Text komponiertes, den dritten seiner »Funeral Sentences«. Deren direkte Veranlassung kennen wir nicht; möglicherweise hat er vorsorgen wollen – eine Gelegenheit würde sich finden. Die erste war sein eigener Tod wenige Monate nach dem der Queen. Der Vortrag der Texte am Grab gehörte zum Ritual, ob gesprochen oder gesungen.
Ähnlich mag Thomas Tomkins bei seinen »Burial Sentences« vorgesorgt haben, die er verstecken musste, weil der puritanische Cromwell geistliche Musik als luxusverdächtig verbot. Am Beginn des Jahres 1649 war Charles I. hingerichtet worden, kurz danach komponierte der königstreue Tomkins eine bewegende »Sad Pavan for These Distracted |60| Times« fürs Virginal, offenbar als geheimes Gedenken seines Dienstherrn. Zuvor hatte John Coprario im Jahr 1612 nach dem Tod des Prince of Wales gegen die pauschalierende Anonymität von Trauermusik sieben je an die Nächstbetroffenen gerichtete Klagelieder komponiert, mit wenig Glück: Die sieben Stücke (fast ließe sich vom ersten Liedzyklus der Musikgeschichte sprechen) ähneln einander textlich und musikalisch zu sehr, am ehesten hebt sich das an die junge Prinzessin Elisabeth gerichtete im eigenen Ton ab.
Schlimme Zeiten – so bald nach Englands Aufstieg zur Weltmacht! Weder hiermit noch mit der Individualität der Protagonisten sollte man allzu direkt in Verbindung sehen, dass Melancholie mehr als je zuvor zur Signatur jener Jahrzehnte wurde. Reflektiert wurde sie längst, seit der Antike vornehmlich auf zwei Gedankenspuren – als gestörtes Gleichgewicht der Körpersäfte und als Mitgift genialer Begabungen. Nun drängte sie allenthalben vor, unter anderem in Vanitas-Symbolen nicht nur der bildenden Künstler, in drastischen Demonstrationen des »Media vita in morte sumus«, in Shakespeares tatenarmem Hamlet, Robert Burtons »Anatomy of Melancholy« oder Miltons verwirktem, verlorenem Paradies, bei den »metaphysical poets« John Donne, George Herbert, Andrew Marvell.
Am direktesten redet sie in Musik, besonders der von John Dowland. Mitunter komponiert er Texte wie »In darkness let me dwell«, eine nachtschwarze Radikalisierung des späteren, empfindsam herabgedimmten »Come, sweet melancholy«: Angst möge der Quellgrund sein, Verzweiflung als Dach möge alles Licht abhalten, schwarze Marmorwände mögen weinen, dissonante Musik möge den Schlaf verscheuchen, all dies mit meinen Schmerzen verheiratet, in mein Grab gebettet – »O lasst mich lebend sterben, bis der Tod kommt, lasst mich im Finstern wohnen.« Diesem Katarakt von Leidenswollust verpasst der Liedmeister, der größte vor Schubert, eine zwar nicht misstönende, doch liedferne Musik, überschreibt eine Pavane »Semper Dowland semper dolens«, versammelt sieben andere unter dem Titel »Lachrimae«, unterscheidet bei den Überschriften »alte«, »alte und zugleich neue«, »seufzende«, »traurige«, »rinnende«, »liebende« und »wahre Tränen« und erfindet alle Pavanen vom Quartabgang im Lied »Flow my tears« aus, dessen Text, am Ende in die Worte »Hark you shadows that in darkness dwell, / learn to condemn |61| light« mündend, die dunkle Tonlage fünf Strophen lang durchhält. Selbst wenn Dowland als Leidensmann posiert hätte und das ästhetische Ich der Musik vom empirischen abstünde – gleichgestimmte Seelen, empfänglichen Zeitgeist konnte er voraussetzen.
Melancholie und Trauer sind Zwillingsschwestern; das führt auf die Frage nach der Rolle solchen Zeitklimas bei den »Funeral Sentences« des jungen Purcell, die zur dichtesten, eindringlichsten Trauermusik gehören, die wir haben. Hier wird, alle mehrstimmigen Möglichkeiten extensiv nutzend, meditiert, gepredigt, gefleht, und nie so, dass waghalsige kontrapunktische Fügungen oder Harmoniegänge sich eigenwertig aufdrängten. »Man that is born of a woman hath but a short time to live, and is full of misery« quält sich aus einem dunklen, später ins Dur aufgehellten Moll-Klang polyphon nach oben und fällt mit »full of misery« ins Dunkel zurück; »he cometh up« steigt in »hoffnungsvollen« Entfaltungen nach oben, »and is cut down« stürzt nach unten; »he fleeth as it were a shadow, and never continueth in one stay« erscheint »endlos«, zugleich »schattenhaft« fortgesponnen.
Purcell wechselt die Satzweisen ständig; homophon deklamierend spricht der Chor wie mit einer Stimme, in eindringlichen Anrufen den Satz zusammenraffend, da die Musik polyphon auseinanderzulaufen drohte und der Adressat vielleicht nicht mehr zuhörte. Immer wieder tritt sie aus sich selbst heraus, wendet sich ihm direkt zu: »O Lord …, O Lord God most holy …, O God most mighty« etc. Selten wurde so quälerisch-eindringlich gefleht wie in den chromatischen Gängen bei »deliver us not into the bitter pains of eternal death«. Historisch einordnende Auskünfte, wieviel Wagnis da »schon« aufschiene, bleiben hoffnungslos hinter dem zurück, was hier geschieht, auch hinter der Zerknirschung, dem verzweifelten Bitten bei »suffer us not, at our last hour, for any pains of death, to fall from thee«.
Diese Musik setzt Gott als ansprechbaren Partner voraus, gar als einen, der nicht widerstehen darf, die Bitten erhören muss; hierauf vertrauend, lässt sie alle Zeremonie und Förmlichkeit hinter sich. Spricht aus ihr nicht die Gewissheit, Geleit ins Jenseits geben zu können, auch dort noch zu klingen, als Anwältin wahrgenommen zu werden?
· · · · ·
|62| Gott in Haftung genommen – das gehört nicht weniger zu den detaillierten Vorbereitungen des am 3. Dezember 1635 verstorbenen Heinrich, »ganzen Hochlöblichen Stammes Aeltesten Reuß, Herr von Plauen, Herr zu Greitz, Cranichfeld, Gera, Schleitz und Lobenstein, Posthumus genannt.« Den Beinamen erhielt er, da erst nach dem Tode des Vaters geboren; die detaillierte Aufzählung mag nötig gewesen sein, weil die Ländereien winzig waren. Dorther stammte auch der beste Helfer, den der Fürst für die Funeralien finden konnte, Heinrich Schütz.
In der Johanneskirche zu Gera steht sein Sarg, den es so kein zweites Mal gibt – nach Anweisung rundum, auf dem Deckel, an den Seiten, dem umlaufenden Mittelstreifen, auf Sargdeckel und Sargtrog mit 13 teilweise ausführlichen, den bei Begräbnissen meistgebrauchten Bibelzitaten beschriftet. Weitere, die nicht unterkamen, hat der Fürst für die Trauerfeier bestellt. Die geballte Ladung, Schütz zur Komposition nahegelegt, könnte den Eindruck erwecken, hier klopfe eine beschwörende, nahezu aggressive Frömmigkeit an die Pforte des Jenseits – sofern man die Glaubensinbrunst jener Zeit übersähe, der wir die schönsten Kirchenlieder verdanken, einer Zeit, da die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges genug Anlass boten, das Heil anderswo als hienieden zu suchen. Als Heinrich Posthumus starb, lag der Prager Fenstersturz 17 Jahre zurück, hatte Tilly das Magdeburger Blutbad schon ausgerichtet, war Gustav Adolf von Schweden den Protestanten bereits beigesprungen und bei Lützen zu Tode gekommen, Wallenstein wenig später ermordet. Bitten um Erbarmen, die Rede von Angst, Not und Trübsal und ird’schem Jammertal waren nicht vonnöten, damit einer »mit Fried und Freud« dahinzufahren begehrte. All dies bestätigte die in den Glaubenskriegen gewachsene, im Protest gegen die etablierte Kirche gehärtete, in jedem Sinn verteidigende, verzweifelt tiefe Gläubigkeit jener Zeit. Partnerschaft, wechselseitige Verpflichtung zwischen Mensch und Gott war so sehr zum Teil ihres Gottvertrauens geworden, dass trotz unsäglichen Elends die Frage zurückstand, warum er es zulasse.
Dies zu vergegenwärtigen erscheint notwendig, um zu verstehen, dass einer es mit der Ars moriendi so genau nimmt, einschlägige Fürbitten so konzentriert versammelt, als könne er den Angerufenen zu Gegendiensten verpflichten. Im ersten der drei Teile von Schütz’ |63| »Musikalischen Exequien« läuft es, eingeleitet durch »ich lasse dich nicht, du segnest mich denn«, auf ein Zwiegespräch mit dem Gekreuzigten hinaus. »Ich lasse dich nicht« singt der Sopran erst fünf-, dann viermal, ehe er bei »du segnest mich denn« ankommt. Gewiss spielt die rhetorische Gepflogenheit mit, der erwarteten zweiten Satzhälfte über mehrere Anläufe Gewicht zu verschaffen, indes wohl auch, dass der Gläubige auf den Segen, den Gott erteilt oder verweigert, angewiesen sei, jedoch androhen kann, an Gott angeklammert zu bleiben, bis er den Segen bekommt. Wie gern würden wir Heinrich Posthumus fragen, ob die Zurüstungen nicht nur bei der Hinnahme von Sterben und Tod, sondern auch darüber hinaus geholfen haben!
Von der Aufgabe, die Zitatenreihe einem musikalisch plausiblen Ganzen zugrunde zu legen, hätte Schütz wie später Haydn anlässlich der »Sieben Worte des Erlösers am Kreuz« sagen können, sie sei »keine von den leichtesten« gewesen, direkter gesagt: fast unlösbar schwer. Das betrifft die Textmasse ebenso wie die Textart: Welcher Dramaturgie, welcher Gedankenlinie würden sich Formulierungen fügen, deren jede genug Gewicht hat und bekannt genug ist, um für sich stehen zu können? Mehrmals, wenn er zum nächsten Zitat überwechselt und dem vordem Gesagten keinen Raum bzw. Nachhall gönnen kann, scheinen die Schwierigkeiten auf.
In solchen Eindrücken freilich sehen wir an der erzwungenen Entscheidung gegen andachtfördernde Wirkungen vorbei, die das klingende Medium schon als solches übt, an der Radikalität, mit der Schütz seine Musik als dienend begriff; deshalb kommen wir im ersten, umfangreichsten Teil der »Exequien« mit Erwartungen zum Beispiel in Bezug auf Korrespondenzverhältnisse nicht weit. »Daß sie ihr eigenes Formgesetz nicht finden durch Beziehung auf musikalische Formkategorien, die ihnen vorgegeben wären, sondern durch Entäußerung, Versenkung in ein ganz Anderes« – genau das trifft hier zu, wenngleich auf Schönbergs »George-Lieder« bezogen, von Theodor W. Adorno formuliert, der Schütz schlecht genug kannte, um über ihn urteilen zu können als einen, den kennenzulernen nicht lohnt.
Wenn tatsächlich »Entäußerung, Versenkung« solcher Art stattfindet, dürfte kein musikalisches Detail betrachtet werden ohne Bezug |64| auf textliche Aspekte; abseits vom Verdacht, das eine mit dem anderen entschuldigen zu wollen, fällt das schwer. Im Wissen, dass er es nicht durchhalten muss, versucht Schütz sich zunächst am Paradoxon musikalischer Textdeutung ohne eigenwüchsig musikalische Formung; wo und wie immer möglich sollen die Worte übersetzt, auf tönende Podeste gehoben, Eindrücke halbwegs autonomer Musik indes vermieden werden. Sicherlich waren Schütz’ wortreiche »Ordinantzen an den Günstigen Leser« unter anderem als Rechtfertigungen gemeint. Nicht zufällig ist das Experiment ohne Nachfolge geblieben, anders als das einige Jahre zuvor als Nachruf auf Johann Hermann Schein komponierte, leichter übertragbare »Das ist je gewißlich wahr« aus der »Geistlichen Chormusik«. Als alter Mann bestellte Schütz bei seinem Schüler Christoph Bernhard für sich eine – verschollene – Sterbemotette.
Vornan in den »Exequien« stehen übliche Madrigalismen – aufwärtsgehende Linien bei »Leben«, abwärtsgehende bei »Sterben«; »Wandel im Himmel« auf steigende, »verklären« in Dezimen auf ausladende Melismen; sehr programmatisch »Wolle« auf eine »flockige« Figur und »gehet« auf eine schrittähnliche Wendung; der »kleine Augenblick« in kleinen Werten und »hoch« siebzehnmal auf einen aus der Quart oder Quint angesprungenen Hochton; »Müh’ und Arbeit« in »mühevoll« verschachtelter rhythmischer Imitation.
Zu semantischen Verdeutlichungen kommen deklamative – unter anderem in eng gefügten Imitationen, als wolle eine beredte Stimme die andere nicht allein lassen, oft in fixierten, rhythmisch sperrigen Formeln, frei schwebender Rhythmik, die ein Ausruhen bei kompakten, regelmäßigen Gruppen selten erlaubt und das Ohr auf den Text verweist; Takteinteilungen in modernen Ausgaben – zeitgenössische hatten keine Taktstriche – und daran orientierte Dirigierweisen überdecken, dass es von kleinen, oft tänzerisch beschwingten »Taktwechseln« wimmelt und die Deklamation sich – bei engen Spielräumen in Tempi, Bewegungsformen und Harmonien – gegen normierende Gangarten sperrt; von dem auf e gesetzten »neunten Ton« entfernt sich der erste Teil selten.
Der auferlegten Selbstzurücknahme entsprechend gibt die Musik sich nie offen originell; in der Machart sehr wohl singulär, soll sie in der Anonymität der Liturgie dennoch aufgehen; ähnlich wie hier sind |65| die Worte zuvor schon oft deklamiert worden. Dies bestätigen Bezugnahmen auf bekannte Choräle: »Nun freut euch, liebe Christen g’mein«, »Ich hab mein Sach’ auf Gott gestellt«, »Nun lasst uns Gott dem Herrn«, »Mit Fried und Freud ich fahr dahin«, »Wenn mein Stündlein vorhanden ist« etc. In der Form, in der sie anklingend vorbeiwandern, scheint die Intention auf, um den Sarg des Verstorbenen eine Totalität musikalischer Andachtsübungen zu versammeln. Manifeste Originalität hat da nichts zu suchen.
Wohin mit dem Stück nach dem minutiös geplanten Begräbnisgepränge? Schütz’ »Ordinantzen« spiegeln die Sorge hinsichtlich weiterer Aufführungen ebenso wider wie hinsichtlich der Gattungsbestimmung – klare Zuordnungen haben das Fortleben einer Musik noch stets befördert. Arg sibyllinisch spricht er von dem Stück als »in ein Concert gefasset / vnd auffgesetzet / in Form einer Teutschen Missa, nach art der Lateinischen Kyrie, Christe, Kyrie Eleyson, Gloria in excelsis, Et in terra pax etc.« – und gibt zu fragen auf, ob die Disposition der lateinischen Messe hintergründig mitspiele.
Allerdings verspricht dieser Bezug angesichts der Unterschiedlichkeit der Texte nicht viel. Immerhin scheint in Schütz’ Auskunft das Ungenüge durch, das er angesichts der verordneten Parataxe gewichtiger Sentenzen empfunden haben muss: Weil sie aufhäuft, Verklungenes im Erklingenden mitführt, ist Musik allemal mehr als Parataxe. Im Übrigen war er im zweiten und dritten Teil, der Motette »Herr, wenn ich nur dich habe« und dem »Canticum B. Simeonis« so sehr Herr im eigenen Haus, dass es naheliegt, nach einem hinter jener Reihe verborgenen Hinweg zu fragen.
Mit alternierenden Soli und Chor (»Capella«) gibt Schütz eine Gliederung vor, deren Wechsel nicht immer mit denen von einem Zitat zum nächsten korrelieren. Zwei Intonationen, zu Beginn »Nacket bin ich vom Mutterleibe kommen«, später »Also hat Gott die Welt geliebet«, separieren einen ersten Abschnitt vom Übrigen, der durch drei identisch ansetzende Chorabschnitte als für sich stehend, dank allgemeinerer Aussagen zugleich als Exordium ausgewiesen scheint und mit dem »Erbarm dich über uns« des Chores tatsächlich Nähe zum Kyrie des Messordinariums hält, Exposition des Kommenden insofern, als die beiden |66| Solo-Abschnitte zwischen den Chören nur zweistimmig imitieren, der Gegensatz Tutti-Solo also betont wird.
Das ändert sich mit dem Eintritt in den »Hauptteil« – in Satzweise und Deklamation liegen Soli (»Auf daß alle, die an ihn gläuben«) und Chor (»Er sprach zu seinem lieben Sohn«) nahe beieinander, unterscheiden sich dem meditativen Text zuliebe danach wieder stärker (»Das Blut Jesu Christi« bzw. »Durch ihn ist uns vergeben«). Dergestalt »atmet« der Satz, entfernt sich von der eingangs exponierten Konstellation – und nähert sich wieder, kommt in einem Solo-Abschnitt gar bei einem Choralsatz an (»Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand«) und wenig später, weil Schütz bei »aber sie sind in Frieden« auf einen erst später fälligen Text vorgreift, episodisch beim motettischen Nebeneinander mehrerer Texte. Im Übereinander von Hiob 19, 25/26: »Ich weiß, daß mein Erlöser lebt« und dem Choral »Weil du vom Tod erstanden bist« verflicht Schütz Soli und Chor auf eine Weise, die altniederländische »Amen«-Entfaltungen erinnert.
Den Schluss indes bildet dies nicht. Noch fehlt von den eingravierten Texten »Ich lasse dich nicht«. Schütz kehrt nach dem choralhaften Zuschnitt zuvor zum durchbrochenen Satz zurück und arbeitet dem Beginn der folgenden Motette zu – textlich, da an Jesu Zuspruch »da bist du selig worden« deren Beginn (»Herr, wenn ich nur dich habe«) direkt anschließen kann, musikalisch, indem der Schlussklang E sich als Dominante zum A-Dur des Motettenanfangs öffnet, welches so eindeutig bisher nur einmal erklungen war. Damit nicht genug: Mit »Herr, wenn ich nur dich habe« nimmt die Motette in ähnlicher Deklamation einen im ersten Teil bereits komponierten Text auf, der dort – zufällig? – an die mehrtextige Episode anschloss. In achtstimmig-gegenchöriger Entfaltung wird hier nachgetragen, was die Musik dort schuldig geblieben war.
Über die Finalität der Motette im Verhältnis zum ersten Teil greift das »Canticum B. Simeonis« abermals hinaus, dem Begräbnisritual gemäß durch »Herr, nun lässest du deinen Diener (in Friede fahren)« als Intonation eingeführt und durchweg mehrtextig-mehrchörig disponiert. Mit dem Geleit dieser unerhörten, dem frommen Flickenteppich endgültig entkommenen, die fürstlichen Vorgaben auf eigene Weise erfüllenden Musik konnte Heinrich Posthumus wahrlich »in Frieden fahren«.