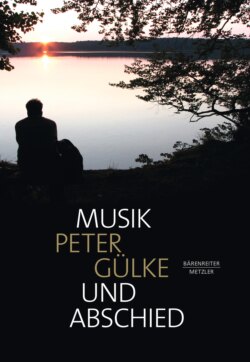Читать книгу Musik und Abschied - Peter Gülke - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13
ОглавлениеTage des Zorns Wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine naiv gläubige Seele, stünde an der Bahre des nächsten, geliebtesten Menschen, für sie würde das offizielle Requiem zelebriert, womit mir das »Dies irae« auferlegt, die Tote beim Jüngsten Gericht vor dem Allmächtigen zitternd vorzustellen, bei dessen Urteil laut Augustinus auch frommer Lebenswandel nicht zählt, dann wird mir übel. Lukas 14, 26 verstärkt die Übelkeit: »So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sein Leben, der kann nicht mein Jünger sein.« Matthäus 10, 37 sagt’s ähnlich.
Da stelle ich die Tote mir lieber im ägyptischen Totengericht, vor den 42 Göttern in der »Halle der beiden Wahrheiten« vor, da wird das Deuteronomium mir wie eine Gutmenschen-Botschaft, eine Betreuung durch Torquemadas Knechte wie Massage im Wellness-Klub erscheinen und der widerwärtigste Ablasshandel plausibel; dann fühle ich mich zu Atheisten eingeladen, über die einer gesagt hat, sie wären die konsequentesten Monotheisten, weil ihnen selbst ein Gott noch zu viel sei; dann wird mir Baudelaires Auskunft sympathisch, Gott sei »das einzige Wesen, das, um zu herrschen, nicht einmal da zu sein braucht«.
Wirksamer können Machtausübung und Seelenfolter nicht platziert sein, daran ändert die Anrufung des milden Jesus (»Jesu pie«) nichts, abgesehen davon, dass die Offenbarung Johanni (19, 11 ff.) einen anderen Weltenrichter kennt, auch davon, dass die einst als knapp bevorstehend avisierte Parusie auf sich warten lässt; Gläubige müssen in gerichtstauglicher Verfassung demnach seit 2000 Jahren zittern, manche müssen es als Namen mit sich herumschleppen: »Fürchtegott«. »Preces meae non sunt dignae, / sed tu bonus fac benigne, / ne perenni cremer igne.« |79| (Wenig gilt vor dir mein Flehen; / doch aus Gnade lass geschehen, / Dass ich mög’ der Höll’ entgehen).
Es sei denn, man glaubte dem Schreckensszenario nicht, beruhigte sich entgegen der liturgischen Akkreditierung damit, dass es sich bei der Sequenz um Dichtung handele, bei der die Fantasie ausfahren darf; oder man wisse sich im Glauben unanfechtbar geborgen, sodass es auf Details nicht ankommt, sei der Gnade Gottes sicher und akzeptiere die Kompetenz der gegenreformatorischen Würdenträger, die das Gedicht ins Requiem hineingeschoben haben.
Allerdings verfängt die Entgegensetzung von ritueller Strenge und poetischer Freiheit zu Zeiten des Dichters – vermutlich der um 1260 verstorbene Thomas a Celano – nicht, und wo läge angesichts der grellfarbig ausmalenden Darstellung die Grenze zwischen minutiös gewogenen und nicht ernst genommenen Details? Die »Logik des Schreckens« (Kurt Flasch) redet unverblümt: »Confutatis maledictis / flammis acribus addictis, / voca me cum benedictis« – in einer Übersetzung authentischzynisch zugespitzt: »Wird die Hölle ohne Schonung / den Verdammten zur Belohnung, / ruf mich zu der Sel’gen Wohnung.«
Das übertrifft ägyptische und griechische Totengerichte weit, Pardon wird nicht gegeben; »maledicti«, zu denen man auch gehören könnte, verdienen kein Mitleid, mögen in der Hölle braten. Was ist das für ein Gott, mit dem Esau es verdorben hat, schon ehe er geboren ist, der den Gläubigen des Mittelalters suggerieren konnte, acht von zehn würden ohnehin in der Hölle landen? Das Fegefeuer, als Läuterung ermöglichende, obzwar nicht garantierende Durchgangsstation war schon vom Kirchenvater Origenes zwischen Hölle und Himmel geschoben worden – der halb subversive, ein wenig milde Humanität nachreichende Akt spielte bei der liturgischen Nobilitierung des »Dies irae« offenbar ebenso wenig eine Rolle wie die Ausnahmen vom manichäischen Entweder-Oder von Rettung oder Verdammnis – Lazarus etwa.
Ein Blick auf Dantes »Inferno« verdeutlicht die Dimension des Rätsels, vor dem wir stehen, da wir in Werken solchen Anspruchs, ganz und gar dem Weltgedicht der »Divina Commedia«, allemal humane Botschaften suchen. Der durch Schrecken des Krieges und Naziverbrechen verstörte Arno Schmidt ertrug die Lektüre kaum, schrieb einen Brief |80| an »Herrn Dante Alighieri, Reichssicherheitshauptamt« und nannte das »Inferno« »Handbuch für KZ-Gestaltung«. Vermutlich hat die offizielle Sanktionierung der Höllenstrafen Inquisition, Folterung und Ketzerverbrennung zu legitimieren geholfen; unser Befremden angesichts der volksfestartigen Autodafés von drei Jahrhunderten sollten wir nicht einseitig historisch zu erklären, i. e. zu beschwichtigen versuchen.
Wie konnte man die Schreie der Gequälten im Zeichen von »die Hölle ohne Schonung / den Verdammten zur Belohnung« überhören? Von der Schuldfrage abgesehen dürfte die Bogerschaukel in einer nach Dies-irae-Maßgaben up to date gebrachten Dante-Hölle nicht fehlen. Steht Gott als der ganz Andere und Allmächtige über unseren Begriffen von Gut und Böse, können wir sie nicht auch von ihm herkommend denken? Seit Kierkegaard Gottes Allmacht anhand der Geschichte von Abraham und Isaak demonstrierte, wissen wir genau, dass es eine Antwort nicht gibt, »das Glaubensverhältnis zu Gott ist ihm … so etwas wie ein Zunichtewerden« (Odo Marquard). Soviel beste und schlimmste Gründe dafür sprechen, den Vergleich zu scheuen – im Ausgeliefertsein der schon durch ihr Vorhandensein Schuldigen, in der Abwesenheit jeder Berufungsinstanz ähnelt das im »Dies irae« vorausgesagte Jüngste Gericht der Rampe von Auschwitz. Im Namen derer, die im Sarg liegen, pfeife ich auf die qua Prozedur vorweg befleckten Seligkeiten des ewigen Lebens.
· · · · ·
Der Versuch, Arno Schmidts Blick mit der Beglaubigung zusammenzudenken, die jegliche Musik den Worten beschert, verdeutlicht das Dilemma der Komponierenden. Beglaubigung liegt nicht weit von Parteinahme, die Macht der Musik nährt sich auch aus der Unfähigkeit, Gegenstände gleichzeitig hinzustellen und zu dementieren. Doppelbödigkeit ist ihr, sofern nicht auf Außenliegendes bezogen, höchstens im Nebeneinander schroff unterschiedlicher Komplexe oder jäh wechselnder Konstellationen zwischen Ton und Wort erreichbar. Die vom Ende des 17. bis ins 19. Jahrhundert beim »Rex tremendae maiestatis« obligatorischen, »f« oder »ff« zelebrierten Punktierungen, im absolutistischen Zeitalter Drohpotenzial von Monstern und Monarchen, können zunächst nur exponiert, furchteinflößende Majestät also bejaht, nicht |81| sogleich dementiert werden. Bestenfalls bleibt der Ausweg der Überdosis, die jedoch selten als solche und kritisch wahrgenommen wird.
Zu den Privilegien der Musik gehört überdies, nicht im Sinne diskursiver Logik präzise »meinen« zu müssen. Wer vermöchte zu sagen, was Verdi sich bei den exzessiven Darstellungen vom »Dies irae«, des »Rex tremendae maiestatis« oder der »Tuba mirum« gedacht hat, die die Toten aus den Gräbern ruft, wieviel Bekenntnis und Bejahung steht dahinter?
Dennoch werden Musiker nicht zu Komplizen der Orgien von Furcht und Zittern; sie können den Weltenrichter auch deshalb unbesorgt hinstellen, weil Menschen ihm verzweifelt ins Gewissen reden (»Quam olim Abrahae promisisti«, »qui latronem exaudisti« etc.), den barmherzigen Gott sehen bzw. entgegensetzen – unverwandt, so ausführlich, dass dieser andere nicht weniger Realität gewinnt als jener, der ohne Rücksicht auf Verdienst und Glauben richtet. Der freundliche wird so eindringlich beschworen, dass ihm im Sinne einer Theologie der Gegenseitigkeit – »Ich weiß, daß Gott ohne mich / nicht einen Nu könnt’ leben« (Angelus Silesius) – nichts anderes übrig bleibt, als vorhanden zu sein. Musik hilft nicht nur, »Jesum pium« anzurufen, sie hilft ihn zu erschaffen.
Dabei wechselt ihre Stellung zum Text ständig zwischen erzwungenem Notopfer und inniger Identität. Jan Dismas Zelenka verdeutlicht die Ewigkeit im »Requiem aeternam« in einer so wunderbar verschlungenen, weit ausladenden Polyphonie, dass das Gewicht der beim nachfolgenden »Rex tremendae maiestatis« obligatorischen Droh-Punktierungen von vornherein gemindert erscheint; beim »Tuba mirum« fehlt die Posaune und selbst eine plausible Vertretung, Zelenka macht heitere Musik, als ob vom Weckruf nichts zu fürchten wäre, ähnlich eine liebliche beim »Liber scriptus«, dem Protokoll der himmlischen Sicherheitsdienste. Wie bei der Polyphonie am Beginn vertieft sich Zelenkas Musik beim »Lacrimosa« bei breitgelagerten Klängen in sich selbst, als wäre das Wort lediglich Stichwortgeber für etwas, was essenziell ihre Sache ist. Die »peccata« bekommen die ihnen gemäße Klage-Chromatik, die Bitte um Frieden indes komponiert Zelenka, dem Richtherrn quasi auf den Leib rückend, als ungeduldiges, durch atemholende Pausen interpunktiertes Drängen. Kaum zufällig hat die Musik im Nachspiel zum »Agnus Dei« das letzte Wort.
|82| Noch deutlicher komponiert Mozart Worte als die der Menschen, deutlich unterscheidend zwischen ihren ganz eigenen und liturgisch verordneten, nicht selten, wie beim Schrei im »Rex tremendae maiestatis«, beides nah beieinander. »Salva me« ist selten so kindlich-anrührend gesagt worden wie hier im Schutz der als »fons pietatis« beschworenen Majestät. In der Verhaltenheit des »luceat eis« verliert das ewige Licht alle rituelle Selbstverständlichkeit und erscheint ins angestaunte Wunder zurückverwandelt. Wie bei Zelenka und etlichen anderen macht die Polyphonie die von ihr getragenen Worte und Wortinhalte unentrinnbar, auch im lapidaren »Quam olim Abrahae«.
Wo immer möglich, schärft Mozart Gegensätze, verstärkt vorgegebene Positionswechsel und unterscheidet, soweit das Fragment erkennen lässt, zwischen Passagen, wo musikalische Prägungen in angemessenen Ausarbeitungen zu ihrem Recht kommen, und anderen, wo der dramatische Furor es verhindert. Ohne dies könnte der »Recordare«-Komplex kaum jene Inständigkeit gewinnen, die die Drohpotenziale fast überstrahlt. Zuweilen scheinen ironische Distanzen auf – so im »Tuba mirum«, wenn Mozart den Sänger die Posaune des Jüngsten Gerichts imitieren lässt, ihm die eher dem Instrument gehörige Dreiklängigkeit zuteilt und dem Instrument die dem Sänger zukommende, engschrittige Melodie.
Um Verdis Requiem opernhaft zu schelten, bedurfte es etlicher Befangenheit in lauwarmer Gefühlsreligion und deren cäcilianischen Früchten – beides verdächtig, geistliche Musik auf eine Stilistik hinbiegen zu wollen, in der die Konfrontation von sündigen Erdenwürmern und göttlicher Allmacht entschärft wäre. Sie verlangt jedoch alle verfügbaren Darstellungsmittel, auch, weil die weltlichsten die authentischsten sind – vorsätzlich fromme Musik grenzt an Anbiederei. Auf die Weise, in der Verdi seine eigenste Sprache spricht, kann es gar nicht genug Oper sein: »Der Italiener hat doch ein gutes Recht, zu fragen, ob er mit dem lieben Gott nicht Italienisch reden dürfe« (Hanslick).
Er stellt das »Dies irae« als gigantische Szenerie, ein Pandämonium hin, worin überweltliche Anonymität und um Gnade bettelnde Menschheit weit auseinander stehen und von vielen Seiten mit verteilten Rollen, oft auch durcheinander geredet wird. Als ein einziges großes Ganzes |83| und ultimative Bühne weist die Szenerie sich unter anderem dadurch aus, dass »Dies irae« immer wieder, auf vielerlei Weise ertönt, bald von oben dröhnend, bald unten »con voce cupa e tristissima« geflüstert, als müssten die Betroffenen die Situation, das Tremendum immer neu vergegenwärtigen. Zu Beginn überfällt es uns brutal als Schreckensschrei, wonach die Soli es kaum auszusprechen wagen, melodielos skandierend wie später »Quantus tremor«. Hier wird die Musik selbst zum szenischen Versatzstück, da Verdi sie – später mehrmals – zurückzutreten, danach sich neu zu finden zwingt. Wenn die Altistin zu erlöschender Musik – »sempre piu p, morendo, perdendosi« – »nil« wiederholt, scheint ihr erst nachträglich klar zu werden, was sie zuvor in großen Melodiebögen gesungen hat.
Ähnliches geschieht bei »Quid sum miser tunc dicturus« – »Was werde ich Armer sagen, welchen Fürsprecher rufen, da selbst der Gerechte nicht sicher ist?« –, am Ende in hilflos verlorene Fragen unter die Soli aufgeteilt. Danach bricht »Rex tremendae maiestatis« drastisch brutal ein – und findet bei den Verlorenen »ppp« ein kaum noch vernehmbares Echo. In solchen Lösungen erweist die Musik sich als Röntgenaufnahme des Textes, legt unbarmherzig bloß, was in die Terzinen poetisch eingefriedet, im mehrfachen Sinn aufgehoben war.
Zugleich bringt sie die Dramaturgie zum Vorschein: Eng gedrängte, fast unerträgliche Kontraste legitimieren die ausladende, vielzüngig redende Kantabilität des »Salva nos, fons pietatis« und sängerische Erfüllungen im anschließenden »Recordare«, einer Mahnrede (»Gedenke, barmherziger Jesus …«), deren Inständigkeit eine ostinate Figur der Celli verdeutlicht. Bei »Tuba mirum« vier Trompeten »in orchestra«, vier weitere »in lontananza ed invisibile«: Auch äußerlich Szenisches scheut Verdi nicht – auch nicht im Zulauf auf ein Tutti, einer Gewalttat, gegen die der Chor kaum Chancen hat, der gegen »Posaunen des Jüngsten Gerichts« keine haben soll. Beim »Confutatis maledictis« lässt er den Bassisten mit Stentorstimme trompeten und gönnt ihm keine Melodie, umso mehr bei »Voca me cum benedictis«. Und aus dem »Lacrimosa«, der summierenden, ins »Dona eis requiem« mündenden Vergegenwärtigung des »tränenvollen« Tages, macht er ein weitläufiges, am Ende choralhaft heimgeholtes Finale.
|84| Kannte Verdi vergleichbare, nördlich der Alpen komponierte Musik? Wenn es so war, läge eine Charakterisierung als »Gegen-Requiem« nahe, Opposition gegen cäcilianisch-verdaulichen Glaubenskitsch, »Furcht und Zittern« im Sinne Kierkegaards gegen freundlich frisierten Schleiermacher.